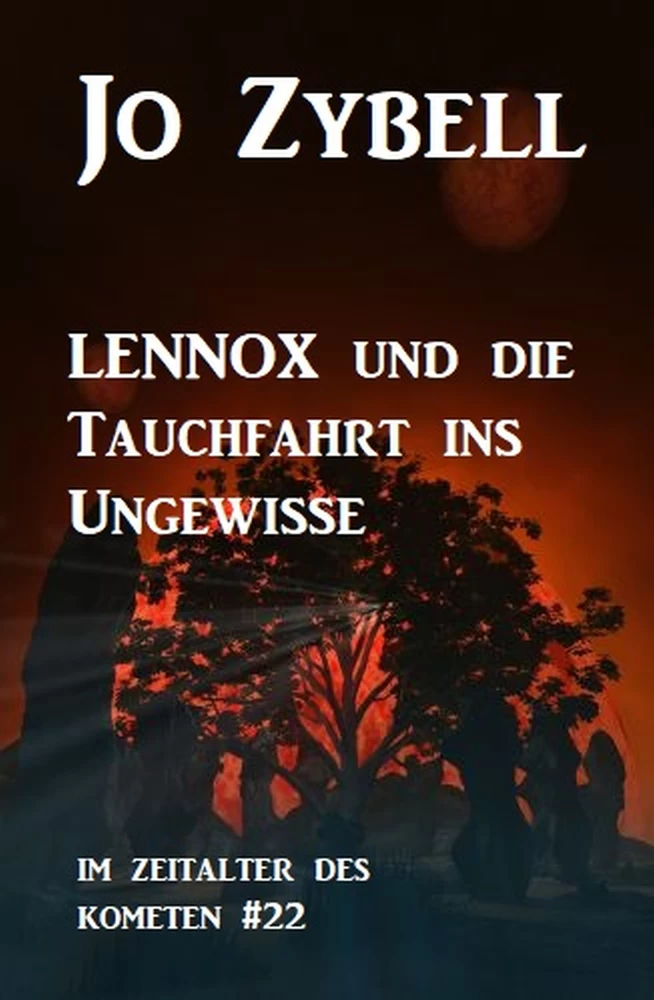Zusammenfassung
In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf …
In der Community London geschieht Unglaubliches, Queen Victoria hat einen neuen E-Butler programmieren lassen und will den alten löschen. Das führt zu einem digitalen Aufstand der E-Butler, die die Menschen zwingen wollen, den bisherigen Zustand aufrecht zu erhalten.
Der Fischmensch Lotraque erhält eine Nachricht von Tim Lennox und will sich mit Dave Mulroney treffen, wobei ihn Lorem begleitet. Dabei kommen sie den degenerierten ehemaligen Stadtbewohnern Londons in die Quere, die gegen mutierte Raubtiere kämpfen und die Fischmenschen jetzt als Beute betrachten.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Lennox und die Tauchfahrt ins Ungewisse
Das Zeitalter des Kometen #22
von Jo Zybell
Der Umfang dieses Buchs entspricht 125 Taschenbuchseiten.
Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen.
In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf …
In der Community London geschieht Unglaubliches, Queen Victoria hat einen neuen E-Butler programmieren lassen und will den alten löschen. Das führt zu einem digitalen Aufstand der E-Butler, die die Menschen zwingen wollen, den bisherigen Zustand aufrecht zu erhalten.
Der Fischmensch Lotraque erhält eine Nachricht von Tim Lennox und will sich mit Dave Mulroney treffen, wobei ihn Lorem begleitet. Dabei kommen sie den degenerierten ehemaligen Stadtbewohnern Londons in die Quere, die gegen mutierte Raubtiere kämpfen und die Fischmenschen jetzt als Beute betrachten.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
© COVER LUDGER OTTEN
© dieser Ausgabe 2020 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Twitter
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1
Hinter Schilf und knorrigen Weiden sahen sie endlich den Fluss. Die Kinder jubelten und rannten wie immer voraus. Als die vier Männer und dreizehn Frauen die kleine Bucht erreichten, tummelten sie sich schon im seichten Uferwasser.
Die Männer – bärtige, langhaarige Gesellen in ärmellosen Westen oder Mänteln aus Wildleder – legten die Bögen im Gras ab und hockten sich auf Weidenstrünke. Einer rammte seinen Speer in den Boden und lehnte sich dagegen. Ein Bierschlauch kreiste. Die Frauen warfen ihre Wäschebündel ins Wasser, schälten sich aus ihren Fellen und stiegen nackt in den Fluss. Die Männer glotzten und schnalzten mit den Zungen. Statt der Nackten hätten sie besser das Schilf am Rande der Bucht beobachtet. Faustgroß wölbten sich dort die Augäpfel hungriger Flussbewohner aus dem Wasser. Doch es war sowieso zu spät.
Bald lagen Gelächter, Kindergeschrei und Palaver über Bucht und Schilf. Die Kinder balgten und planschten, die Frauen schlugen Wäsche ins Wasser, die Männer genossen ihren Anblick und das Bier.
Manchmal, wenn eines der Kinder zu weit hinausschwamm und in gefährliche Nähe der Flussströmung geriet, brüllte ein Speerträger und drohte mit der Faust. Er hieß Djeyms; seine Stammesmitglieder nannten ihn zuweilen auch Biglord Djeyms.
Auf der Flussseite des Schilfs tauchten die Augäpfelpaare unter Wasser. Wellenringe breiteten sich dort aus, wo sie eben noch lauerten. Zwei, drei Atemzüge später erstarb das Stimmengewirr über der Bucht. Für kurze Zeit war es sehr still. Und dann, von einem Atemzug zum anderen, brach gellendes Geschrei los. Die Kinder kraulten oder wateten jammernd Richtung Ufer, die Frauen ließen die Wäsche im Wasser zurück, ruderten mit den Armen, kreischten hysterisch und versuchten dem Fluss zu entfliehen. Zwei Kinder versanken im Wasser und tauchten nicht wieder auf.
Die Männer waren aufgesprungen. Zwei spannten Pfeile auf ihre Sehnen. Der mit dem Speer – Djeyms – lief ins seichte Uferwasser, die Waffe mit beiden Händen zum Stoß über die Schulter erhoben. Der Vierte stapfte mit gezücktem Schwert hinter ihm her. Er hieß Touny, gerade mal siebzehn Winter alt, Simplord Touny nannten sie ihn. Beide wussten, wer hier Beute unter Wasser zog, auch wenn sie die Angreifer nicht sahen. Noch nicht.
Der erste tauchte einen halben Speerwurf vom Ufer entfernt hinter drei Kindern auf: breiter flacher Schädel, schuppig und schmutzig grün. Rot und schmal schoss die Zunge aus seinem Rachen, schlang sich um den Hals eines Halbwüchsigen, zerrte ihn rückwärts in die Fluten zurück.
Pfeile surrten über die kreischenden Frauen und heulenden Kinder hinweg, doch keiner traf.
Zwei oder drei weitere Bestien – Kwötschis nannten die Stämme in den Ruinen und Wäldern entlang des Flusses sie – fuhren keine zehn Speerlängen vor Djeyms unter die Frauen. Das Wasser schäumte auf, Djeyms und Touny sahen Klauen und Schwimmhäute und speerlange Beine. Zungen schnellten aus dem Wasser, packten die Flüchtenden an Armen und Hälsen, rissen sie von den Beinen und zogen sie unter Wasser.
Aufs Geratewohl rammte Djeyms seinen Speer dort in den Fluss, wo das schaumige Wasser am heftigsten brodelte. Die Gischt färbte sich rot. Ein Kwötschi tauchte auf, schlug nach dem Speer in seinem Rücken und schoss zugleich seine Zunge nach dem Biglord ab. Touny durchtrennte sie mit einem Hieb, und mit der Tollkühnheit des Unerfahrenen stürzte er sich auf das viel schwerere und größere Flusstier und schlug ihm die Klinge auf den Schädel, so lange, bis der Kwötschi erschlaffte und im blutigen Wasser versank.
So rasch, wie sie angegriffen hatten, zogen sie sich auch wieder zurück. Zwei Frauen und drei Kinder nahmen sie mit. Darunter den zweitjüngsten Sohn und die Lieblingsfrau des Grandlords.
Djeyms schäumte vor Wut, schlug und trat nach den beiden Bogenschützen, weil sie seiner Meinung nach schlecht geschossen hatten. In Wahrheit aber fürchtete er Paacival, seinem Grandlord, unter die Augen zu treten, und suchte einen Schuldigen.
Touny stand im flachen Uferwasser. Stumm und sein Schwert noch in der Faust, sah er hinaus auf den breiten Fluss. Hinter ihm lagen sich Frauen und Kinder in den Armen und jammerten, dass es Touny durch Mark und Bein ging. Drei Halbwüchsige schlugen mit Ästen auf den schleimigen Körper des Kwötschis ein, obwohl der Flussräuber längst tot war.
2
Vor dem Fenster der Zentralkuppel schwebten sie knapp über dem Meeresboden: zwei Fischmenschen, Lorem und Lotraque. Die Qualle fesselte ihre Aufmerksamkeit. Vorbei an Türmen und über kleine Wohneinheiten hinweg strebte sie durch den transparenten, oberirdischen Teil der Transportröhre der Zentralkuppel entgegen. Ihr Körper blähte sich auf, streckte sich, sog sich durch den Vorderschlund voller Wasser und stieß es durch den hinteren Schlund wieder aus. In der Röhre erst entwickelte dieser Antrieb die Geschwindigkeit, ganze Ozeane in nur wenigen Wochen zu durchqueren.
Es war eine jener Lebensformen, die fischartige Bionetiker für ganz spezifische Zwecke gezüchtet hatten; in diesem Fall für den Transport von Individuen und Frachten über weite Strecken hinweg. Vor wenigen Bruchteilen einer Phase erst hatte die bis dahin unterirdisch verlaufende Transportröhre sie ausgespuckt.
»Sie sind zu zweit.« Lorems Kiemenlappen wedelten, während er sprach. Bläschen perlten aus beiden Seiten seines Schädels nach oben. »Die Qualle wirkt erschöpft, ein langer Weg muss hinter ihnen liegen.« Wie Knacktöne in verschiedensten Höhenlagen hörte sich die Sprache an, manche Worte klangen in scharrendem Raunzen aus.
Lotraque nickte langsam. Auch er sah jetzt die Umrisse der beiden Gestalten im Inneren der halb durchsichtigen Transportqualle. Die Lider schoben sich über seine ohnehin schon halb geschlossenen Augen. Er spreizte Zehen und Finger, sodass seine Schwimmhäute sich entfalteten. Drei, vier kaum sichtbare Bewegungen seiner Glieder, und er trieb leicht nach vorn geneigt durch das Wasser vor dem runden Kuppelfenster nach oben. Sein Geist konzentrierte sich auf die Reisenden in der Qualle. Bald spürte er ihre Gedankenströme – ruhige Gedanken, ohne Furcht und Hast, aber durchaus von einem konkreten Ziel bestimmt. Hier ist Lotraque, sendete er, wer seid ihr?
Die Antwort kam prompt. »Hog‘tar und Xop‘tul.«
Der fischartige Wissenschaftler öffnete die Augen, bewegte die schuppigen Arme ein wenig und sank neben Lorem auf den Boden vor dem Fenster zurück.
»Hog‘tar und Xop‘tul aus Torkur?« Der Flossenkamm auf Lorems Schädel färbte sich violett. »Was treibt blutjunge Fischmenschen von der Beringstraße durch die halbe Welt hierher?«
»Sie bringen eine Botschaft«, sagte Lotraque. »Für mich.«
Die Transportqualle verschwand unterhalb ihres Blickfeldes.
»Für dich?« Lorem beäugte Lotraque von der Seite. »Von wem?«
»Von Tinnox.« Lotraque breitete die Arme aus, drehte sich um und schwamm auf die kreisrunde Öffnung der Mittelröhre zu. »Lass uns hinuntertauchen, wir wollen sie begrüßen.«
Lorem grunzte missmutig. Blasen stiegen aus seinem Mund. Sein Schädelflossenkamm spreizte sich, bis die Spitzen vibrierten und tiefrot leuchteten. »Eine Botschaft von Tinnox – das kann nur Verdruss bedeuten.« Lotraques Assistent mochte keine Botschaften von Oberflächenbewohnern. Und er mochte keine Oberflächenbewohner. Nicht einmal den Gedanken an sie mochte er. »Warum können uns diese Menschen nicht einfach in Ruhe lassen?«
Lotraque hörte sein Gemurre nicht mehr, er war schon in die Röhre hinabgetaucht.
Etwa auf halber Höhe der Zentralkuppel mündete die Mittelröhre in die Empfangsaula. Vier kreisrunde Tore öffneten sich in der Wand des halbkugelförmigen Raumes: die Enden der Eingangsröhren. Lorem und Lotraque schwebten noch im Zenit der Aula, als eines der Tore die Transportqualle ausspie. Ihr milchiges Gewebe pulsierte und zog sich zusammen; undeutlich und verschwommen nur sah man jetzt die beiden Insassen. Ein schaumiger, von tausend Bläschen durchsetzter Wasserstrahl schoss aus ihrem vorderen Schlund – eine Bremsfontäne.
Die Qualle schwebte langsamer und zum Zenit hinauf. Tentakel formten sich, wuchsen oberhalb des Vorderschlundes aus dem Gewebe, tasteten nach der Korallenwand und saugten sich daran fest. Der Quallenkörper entspannte sich etwas, wurde durchsichtiger. Fünf oder sechs Meter lang war er, vielleicht drei Meter hoch und etwa ebenso breit. Die beiden Insassen erhoben sich von etwas, das wie Sitze aussah, aber sofort mit dem Quallengewebe verschmolz, als die Reisenden im Inneren zum Mittelpunkt des lebendigen Hohlkörpers schritten.
Im Mittelteil des Rückens runzelte sich das Oberflächengewebe. Ein ringförmiger Wulst wölbte sich, und als würden Lippen eines riesigen Mundes sich sehr langsam und schmatzend öffnen, wuchs erst ein Spalt und dann eine Öffnung zwischen den Wülsten. Lorem und Lotraque sanken vom Kuppelzenit herab und landeten auf dem Quallenrücken neben den Wülsten des Ausstiegs.
Nacheinander schoben sich die beiden Insassen aus der Qualle, schuppige, von Quastenflossen besetzte Körper. Angehörige einer uralten Rasse von Meeresbewohnern, die schon lange vor den Menschen die Meere bevölkert hatte.
»Lotraque und Lorem heißen euch willkommen«, sagte der fischartige Wissenschaftler Lotraque, den ein ganz besonderes Band mit Timothy Lennox verknüpfte: Seine Seele war nach seinem organischen Tod für einige Zeit im Körper des Menschen zu Gast gewesen, bevor sie in einen neuen, jungen Klon transferiert werden konnte.
Die Ankömmlinge richteten sich auf. Wie die beiden Wissenschaftler trugen sie als einzige Kleidungsstücke braune, mit Schnitzereien versehene Bauchplatten aus Krebs- oder Hummerpanzer und an ihrer Unterseite befestigte, schmale rote Tücher. Einer der Reisenden hatte einen gelblichen Schädelflossenkamm. »Hog‘tar und Xop‘tul aus Torkur grüßen Lotraque und Lorem«, sprach er das Begrüßungsritual. Die Kiemenlappen an seinen Schädelseiten bewegten sich, während er redete. Luftbläschen stiegen zum Kuppelzenit hinauf.
Lotraque lud die jungen Fischmenschen aus der Beringsee in seine Privatgemächer ein. Doch Hog‘tar gab durch eine Geste zu verstehen, dass er vor allem anderen einen Auftrag erledigen wollte. Er griff unter sein Lendentuch und zog eine zusammengerollte Folie heraus.
»Der Mensch Tinnox bat uns, eine Botschaft zu überbringen.« Er reichte Lotraque die Folie. Der entrollte sie und blickte auf eine Art Landkarte. »Dies ist eine radiologische Aufnahme des Gebietes, wo einst der Komet einschlug«, erklärte Hog‘tar. Er deutete auf einen stark aufgehellten und scharf umrissenen Bereich der Karte. »Hier ist die Strahlung der Kometenkristalle besonders intensiv. An diesen Ort bittet dich Tinnox zu kommen.«
Neben Lotraque erklang immer häufiger und lauter Lorems unwilliges Grunzen. Lorem überhörte den Protest geflissentlich und wandte sich an Hog‘tar. »Ist das die ganze Botschaft meines Freundes?« Meines Freundes – die Betonung dieser beiden Worte ging an Lorems Adresse.
»Tinnox bittet dich, Waffen und Material mitzubringen, auch um sich gegen eine zweite Expedition zu behaupten, die Böses im Schilde führt«, sagte der junge Botschafter mit dem gelben Schädelflossenkamm. »Er glaubt, dass es nicht nur für die Zukunft seiner eigenen Rasse, sondern auch für uns Fischmenschen entscheidend sei, das Geheimnis des Kratersees zu lüften, noch vor dem … wie nannte er die zweite Gruppe?« Hog‘tar sah zu seinem Begleiter hinüber.
»… vor dem Weltrat«, half Xop‘tul aus und fuhr fort: »Aber du sollst nicht allein kommen, Lotraque. Tinnox bittet dich, mit dem Menschen Dave Mulroney Kontakt aufzunehmen.«
»Mulroney«, wiederholte Lorem grollend. »Dave Mulroney!«
Schmerzliche Geschehnisse verbanden sich mit diesem Namen. Der Fischmensch Nag‘or war an der Küste Meerakas von Menschen überwältigt und gezwungen worden, eine Geistesübertragung vorzunehmen. Professor David Mulroneys Bewusstsein war in den Rebellen Phil Hollyday transferiert worden. Die Geschichte hatte heftige Wellen unter dem Meer geschlagen und nicht gerade dazu beigetragen, Sympathien für die Oberflächenbewohner zu schüren.
Lotraque rollte die Folie zusammen. Er nickte langsam, als wäre sein schuppiger Schädel steinschwer von Gedanken.
»Du wirst doch wohl nicht dorthin gehen?« Aus Lorems Kiemen sprudelten Sauerstoffbläschen. Sein ansonsten grüner Schädelflossenkamm färbte sich rötlich. »Jeder Kontakt mit dieser kriegerischen Rasse zieht nur neues Leid nach sich. Willst du ein weiteres Mal sterben?«
Die jungen Fischmenschen aus Torkur wagten kaum sich zu rühren. Die unerwartete Spannung zwischen den beiden Erfahreneren schnürte ihnen die Kehlen zu. Fischmenschen verabscheuten nichts mehr als Spannungen.
»Ich muss es tun«, sagte Lotraque endlich. »Mein Geist weilte lange Zeit in Tinnox, er ist mein Freund – und ein Freund unseres Volkes. Und bedenke, Lorem: Wir haben uns vor drei Jahrhunderten nach den Kämpfen mit den Todesrochen aus dem Kratersee zurückgezogen und ihn zur verbotenen Zone erklärt. Vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht wächst dort etwas heran; eine Gefahr, die auch unser Volk bedrohen kann. Davor sollten wir unsere Augen nicht verschließen. Prinzipien sind gut, Lorem, aber manchmal muss man sie höheren Werten opfern. Ich werde mit Mulroney Kontakt aufnehmen.«
3
Sie lag in einer bankartigen Mulde, die sich halb in die Kuppelwand hinein wölbte. Nackt war sie, vollkommen nackt. Ockergelbes Licht beschien ihren Körper. Den kahlen Kopf in die rechte Hand gestützt, betrachtete sie Dave so gelassen, so vollkommen entspannt, als wäre er ein seltenes Tier hinter Glas oder eine Marmorskulptur aus antiken Zeiten; Dinge jedenfalls, die ihr nicht gefährlich werden konnten.
Nun ja, ein wenig kam er sich auch so vor wie ein exotisches Tier oder eine harmlose Statue, wie ein Ding eben, das ihr nicht gefährlich werden konnte. Dabei saß er nur drei Schritte entfernt vor ihrer Sonnenbank, und ganz bestimmt sah sie das Begehren in seinem Blick lodern. Er spürte die Wärme des ockerfarbenen Lichts, spürte vor allem das Blut in seinem Glied pulsieren. Doch gefährlich werden? Keine Chance. Die Welten, die sie trennten, hätte er vorübergehend vergessen können. Nicht aber seinen Schutzanzug. Ohne das verdammte Ding an seinem Körper hätte sie kaum die Freiheit besessen, sich in seiner Gegenwart nackt auf ihrer Sonnenbank zu räkeln.
»Woran denken Sie, Professor Mulroney?« Ihre Stimme klang noch eine Spur dunkler als sonst. Die Ocker-Strahlung der Sonnenbank vermischte sich mit dem Glitzern der Schneegipfel des Bergpanoramas und spiegelte sich in ihren grünen Augen. Das unwirkliche Licht machte diese Augen zu beseelten Smaragden.
»Denken?« Er lächelte. »Es ist einer der seltenen Augenblicke, in denen ich nichts denke, Eure Majestät, gar nichts.«
So ganz stimmte das nicht: Dave Mulroney dachte an Daanah, seine geliebte Barbarin aus Berlin. In seiner Erinnerung war sie zehn Mal schöner als die Queen. Aber die Queen war lebendig und Daanah tot.
Dave konnte die Lichtquelle nicht ausmachen, die Queen Victoria beschien und bräunte. Sie interessierte ihn auch nicht. Der Körper dieser Frau interessierte ihn. Jesus, was für ein Körper! So ungeniert, wie sie ihm ihre Nacktheit präsentierte, so ungeniert genoss er sie, betrachtete ihre glatten runden Schultern, ihre kleinen spitzen Brüste und ihren vollkommen haarlosen Venushügel. Sie war nicht so schön wie Daanah, okay, aber sie war immer noch atemberaubend schön.
»Ich bin nicht im Bilde darüber, wie die Männer hier im Bunker …«
»In der Community, meinen Sie sicher, Professor. Bunker …« Sie machte ein angewidertes Gesicht. »Meiden Sie doch bitte dieses scheußliche Wort.«
»Ich weiß nicht, was die Männer der Community angesichts ihrer nackten Königin denken würden. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass Ihr Anblick meine Hormonproduktion ganz erheblich steigert, und ab einem gewissen Hormonspiegel denkt ein Mann nichts mehr.« Es war nicht so, dass er sie liebte, wirklich nicht. Aber er war auch nur ein Mann, oder?
»Mit anderen Worten, Eure Majestät: Ich würde Sie jetzt am liebsten …«
»Wie romantisch!« Sie schwang sich von der Sonnenbank. Ihre Stimme klang nun eine Spur schärfer. Dave fragte sich, was das für ein Spiel war, das sie seit Monaten mit ihm spielte. Nähe und Distanz, mal vertraut, mal kühl. »Außerdem hätte ich da noch ein Wort mitzureden.«
Die Sonnenbank verschmolz mit der Wand und machte einem Schneehang Platz, das Ockerlicht erlosch; keine Lücke klaffte jetzt mehr in dem kalten Glitzern der Berglandschaft.
Queen Victoria griff nach dem rosa Mantel, den Dave ihr reichte, und hüllte ihren Körper darin ein. »Vergessen Sie nicht, dass ich eine Eins bin, Professor Mulroney. Ich darf mir meine Geschlechtspartner frei wählen. Ihrem Gencode nach sind auch Sie eine Eins, kämen also durchaus für mich in Frage. Ihr Schutzanzug allerdings würde im Fall der Fälle beträchtliche Probleme aufwerfen, rein praktischer Art, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Dave verstand sehr gut: Sie untertrieb mal wieder. Mit ihr zu schlafen war nur vordergründig ein praktisches Problem – einen Schutzanzug konnte man ausziehen. Es war in erster Linie eine existentielle Frage. Für die Queen, nicht für ihn. Seine körpereigenen Bakterien würden sie töten.
Sie ging an ihm vorbei, und er stieß sich mit dem Fuß ab, sodass sein Stuhl sich drehte und er ihr nachschauen konnte. Barfuß schritt sie zu einer Art Spiegeltheke auf der anderen Seite des großen Kuppelraums. Auf der Konsole unter dem Spiegel reihte sich Glasschälchen an Glasschälchen. Hinter dem Spiegel türmte sich eine Gletscherwand auf.
»An den Schutzanzug habe ich mich gewöhnt, Victoria, immerhin ziehe ich ihn seit Monaten fast täglich an. Woran ich mich nur schwer gewöhnen kann, ist – nun, wie soll ich mich ausdrücken – ist der vertraute Umgang, den Sie seit einiger Zeit mit mir pflegen. Sie wissen, dass ich Sie nicht lieben kann. Mein Körper darf es nicht, und mein Herz kann es nicht.«
Sie lachte. Nicht laut, aber er sah es im Spiegel. »Was glauben Sie, was ich denke, wenn ich nackt in der Sonnenbank liege und Sie mich so begehrlich anschauen, Professor?« Sie tauchte den ausgestreckten Zeigefinger in eines der Glasschälchen, holte eine Fingerspitze voll Salbe heraus und begann, sich den kahlen Schädel einzucremen.
»Verraten Sie es mir, Victoria.«
»An einen anderen Mann.«
»Das beruhigt mich. Und an wen?«
»Er ist noch unerreichbarer für mich als Sie.«
»Also niemand aus dem Bunker.«
Sie fuhr herum, eine steile Falte drohte zwischen ihren aufgemalten Brauen. »Bitte, Dave! Aus der Community!« Und dann, wieder zum Spiegel gewandt: »Micky!«
Im Schneegipfelpanorama entfärbte sich eine große quadratische Fläche. Erst füllte sie sich mit warmem, zunächst flimmerndem Grün, dann nahm eine Gestalt Konturen auf ihr an. Eine Comicfigur in weißen Handschuhen, gelben Schuhen in Übergröße und roten Pumphosen. Ein langer schwarzer Schwanz schlängelte sich hinten aus ihrer Hose. Auch die riesigen Ohren und der Schädel waren schwarz. Weiß war nur das Gesicht mit der leicht nach oben gebogenen Schnauze.
Große eiförmige Augen blickten auf Dave und die Queen herab; freundliche und ziemlich schalkhafte Augen.
»Wie geht‘s denn so, Vicky?« Der E-Butler winkte mit zwei Fingern der Rechten. »Siehst mal wieder zum Anbeißen aus.«
»Erstens bin ich für dich ›Eure Majestät‹, und zweitens interessiert es niemanden, wer oder was dich zum Anbeißen animiert. Ich brauche frische Kleider.«
Die Micky Maus verdrehte die Augen. »Dein Vater pflegte sich bei solchen Gelegenheiten nach meinem Befinden zu erkundigen, Vicky. Seit über einem Jahr versuche ich dir halbwegs akzeptables Benehmen beizubringen. Wann wirst du es endlich kapieren?« Er war rotzfrech, der kleine E-Butler. Dave liebte ihn dafür. Und dafür, dass er den Namen seines wichtigsten Gesprächspartners trug: Auch sein verstorbener – oder im Dschungel der Zeit verschollener – Bruder hieß Mickey.
»Eure Majestät!« Die Queen stampfte mit dem Fuß auf. »Ich bin nicht mein Vater, und dein Befinden interessiert mich nicht!«
»Natürlich nicht.« Der E-Butler verschränkte die Arme hinter dem Rücken und blickte gelangweilt zur Decke des Kuppelraums.
»Unterbrich mich nicht!« Victoria drohte dem elektronischen Wesen mit geballter Faust. Dave schätzte, dass er einer der wenigen Menschen in der Community London war, der das Privileg genoss, die ansonsten kühle Queen von ihrer hitzigsten Seite zu erleben. »Das lange schwarze Kleid und den roten Mantel mit dem Stehkragen! Zur Octaviats-Sitzung will ich etwas Klassisches tragen …«
»Eine wichtige Sitzung, ich weiß.« Den Blick noch immer zur Decke gerichtet, begann die E-Maus mit dem rechten Schuh zu wippen. Dave amüsierte sich prächtig. Wie immer eigentlich, wenn der königliche E-Butler auf der Bildfläche erschien.
»Du sollst mich nicht unterbrechen! Wenn du die Kleiderfrage organisiert hast, erkundigst du dich beim Schleusen-Butler nach Fanlur von Coellen! Er müsste längst hier sein. Ohne ihn kann die Sitzung nicht beginnen. Außerdem nimm Kontakt mit Octavian Hawkins auf. Bevor die Sitzung beginnt, muss ich wissen, ob die Präsentation des neuen Programms stattfinden kann.«
»Hawkins? Neues Programm?« Misstrauen schlich sich in die schelmische Miene des E-Butlers. Dave wusste, dass Sir Anthony Hawkins, Bioinformatiker und Repräsentant der Wissenschaftler im Octaviat, Mickys Schöpfer war. »Was für ein neues Programm, unsere Majestät?«
»Genug! Verschwinde! Und zuerst die Kleider! Nein, vorher noch ein neues Panorama. Ich will den Fluss!«
Der E-Butler schloss die Augen und spitzte die Lippen. Der grüne Monitor verblasste.
»Er ist unverschämt, finden Sie nicht, Professor?« Victoria ließ den Mantel fallen und cremte sich Schultern, Arme und Brüste ein. Im Spiegel sah sie Dave hinter sich mit den Achseln zucken. »Vollkommen unwürdig eines königlichen E-Butlers! Mein Vater mit seinem Spleen für diesen Walter Disney! So hieß Mickys Erfinder doch, oder?«
»Walt Disney. Und wie heißt der Mann, an den Sie denken, Eure Majestät?«
»Kein Wort mehr darüber, Dave. Wenn Sie die Octaviats-Sitzung aufmerksam verfolgen, werden Sie es hinterher wissen.«
»Nach der Sitzung?« Dave grinste.
An zwei Sitzungen des Regierungsgremiums der Community London hatte er bisher teilgenommen. An der ersten zusammen mit Fanlur, am Tag, nachdem das Luftkissenfahrzeug Twilight of the Gods nach wochenlanger Odyssee aus Nordamerika zurückgekehrt und am Themse-Ufer vor den Ruinen der Houses of Parliament vor Anker gegangen war. Fanlur hatte Bericht erstattet – er selbst war zu erschöpft gewesen – über den Weltrat, über Timothy Lennox‘ Schicksal, und vor allem über das Serum, das es den Technos drüben in den ehemaligen Vereinigten Staaten – »Meeraka« nannten die Eingeborenen heutzutage den Kontinent – erlaubte, sich ohne Schutzanzüge außerhalb ihrer Bunker zu bewegen. Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe.
Seine zweite Octaviats-Sitzung erlebte Dave vier Monate später, etwa eine Woche, nachdem sie ihn aus dem Tiefschlaf geholt hatten. Ja, vier Monate seines Lebens hatte Professor Dr. Dave Mulroney verschlafen und sich danach wie neugeboren gefühlt. Die mörderischen Strapazen in Berlin und Washington hatten ihn fast umgebracht. Damals, fast ein Jahr war das jetzt her, beriet die Queen mit ihren Octavianen die Möglichkeiten einer offiziellen Expedition nach Washington. Ohne protokollarisch fixiertes Ergebnis. Immerhin beschlossen sie damals, dem Astrophysiker aus der Vergangenheit die Datenbanken der Community-Wissenschaftler zugänglich zu machen.
Fast ein dreiviertel Jahr lang hatte Dave sie studiert, wie in jungen Jahren. Jetzt wusste er, wie man ein EWAT steuerte, wie man eine Zentral-Helix programmierte, wie man Energie aus dem Erdinneren gewann und Titanglas zu Kuppelgewölben formte; und vieles mehr.
»Sie wollen während der Octaviats-Sitzung ihre Herzensangelegenheiten enthüllen?« Die Vorstellung machte Dave Spaß. »Verzeihen Sie, Mylady, ich habe nur zwei dieser Versammlungen mitgemacht. Ziemlich verbissene Angelegenheit. Wenn mich nicht alles täuscht, könnte schon ein banaler Furz die Tagesordnung über den Haufen werfen.«
»Lassen Sie sich überraschen, Dave.«
4
»Minne Son! Minne Littlson!« Das Gebrüll und Geheul schwankte zwischen Wut und Schmerz. »Iah sinne Schuld! Minne Son! Un minne schönste woom! Iah habdse de Kwötschis vafüddad!« Der Grandlord trat und schlug auf Biglord Djeyms und seine kleine Truppe ein, warf sich zwischendurch in den Dreck und trommelte mit den Fäusten auf dem Boden herum. Dann wieder sprang der graubärtige Hüne auf, traktierte Djeyms Bogenschützen mit Tritten oder raufte sich laut heulend sein graues Lockengestrüpp.
Aus nassen Augen fixierte er schließlich Djeyms, seinen Biglord. »Du bis Schuld!« Er ging auf Djeyms los, stieß ihn in die Menge der auf dem Dorfplatz versammelten Krieger, schäumte vor Wut und knirschte mit den Zähnen. Einem Littlord entriss er die Axt, packte sie mit beiden Fäusten und holte zum Schlag aus.
Vier Biglords und der greise Druud fielen ihm in die Arme.
»Nich totmache!«, schrie Alizan, der Druud. »Nich totmache, Gwanload Paacival, nich noch mea Tote!« Der Grandlord schob den Alten zur Seite. Er brüllte und versuchte seine obersten Krieger und Jäger von sich abzuschütteln. Doch die klammerten sich an den Armen und Beinen des Hünen fest und redeten auf ihren Grandlord ein.
Biglord Djeyms nutzte jeden Atemzug, der ihm blieb, und robbte an Beinen vorbei und unter Wildlederröcken hindurch aus der Reichweite der Axt. Er zitterte vor Angst und klapperte mit den Zähnen – ein Tobsuchtsanfall des Grandlords rangierte in der Hierarchie möglicher Naturkatastrophen gleich nach einem Orkan und noch vor einem Hochwasser. Jeder wusste das, und Djeyms wusste es auch. Eine Zeitlang hatte es so ausgesehen, als könnte er seinem Grandlord die beiden Bogenschützen als Sündenböcke verkaufen. Jetzt aber, da Paacivals Axt über ihm schwebte, ja, einmal sogar zwischen seinen Stiefeln in den Dreck fuhr, jetzt schloss er mit dem Leben ab.
Paacival zerrte inzwischen sechs Biglords mit sich.
»Loslasse! Wech mid euch! De Tawatzenaasch müsse steabe!«
Kein Simplord, kein Littlord wagte sich dem Grandlord in den Weg zu stellen; und schon gar keine der vielen Frauen – wooms hießen die bei den Lords. Gleich bei der Rückkehr der Wäscher waren sie aus den schwärzlichen Hütten geströmt und standen nun zu Dutzenden und mit ängstlichen Blicken hinter den Männern und Kindern. Nur die Biglords und der Druud schritten ein.
»Kwötschis sinne Moadbiesta, weisse doch, Gwanload! Kanne Djeyms nichs füa!« Alle redeten sie auf den Tobenden ein, manche behutsam, manche schreiend, und alle mit einem Auge nach der kreisenden Axt schielend.
»Isse scheiß Bigload!«, brüllte der Grandlord immer wieder, und: »Totschlache, schlachntot!«
Ein Knabe tauchte plötzlich aus der Menge auf, vier oder fünf Jahre alt, knapp über die Knie reichte er dem Tobendem. Verheult, schmutzig, mit verfilztem Lockenkopf und gelbhäutig wie die meisten, sah er aus wie einer der Koboldbastarde, von denen der Druud und die alten wooms manchmal erzählten.
Auf einmal stand er zwischen dem Biglord und Paacival und streckte die Ärmchen nach dem massigen Grandlord aus.
»Vadde, Vadde!« Paacival hörte auf zu brüllen. Erschrocken blickte er auf den Jungen hinunter. »Minne Mam, minne Bwuda! Isse schlimm, binne twauwig!« Der Junge – Paacivals jüngster Sohn Djeff – umschlang die Schenkel des Hünen und heulte, als wollte er Herz und Lungen aus dem kleinen Körper würgen.
Der Grandlord ließ die Axt sinken, als wäre sie ihm viel zu schwer. Stille lag plötzlich über der Menge auf dem Dorfplatz. Das Schluchzen des Kleinen allein war noch zu hören. Bis zu den hintersten Reihen der Gaffenden drang es, bis zur letzten der schwärzlichen Hütten.
Paacival legte seine Pranke auf den Filzkopf des Jungen. Der Kleine und sein von den Kwötschis gefressener Bruder – ein knappes Jahr älter als Djeff selbst – hatten die gleiche Mutter: Paacivals Lieblingsfrau. Endlich, endlich riss dessen Blick sich von Biglord Djeyms los. Wie ein Erwachender blinzelte er um sich in die Menge hinein. Ein paar Littlords und Frauen wichen erschrocken zurück. »Minne Son, minne aame Son!«, krächzte er endlich.
Die Axt entglitt seiner Hand, der Hüne sackte in die Knie, umschlang den vor Heulen und Schluchzen bebenden Knabenkörper und drückte ihn an seine Brust. »Minne aame, aame Son …« Bald schluchzten und heulten sie gemeinsam, beweinten Mutter und Frau, beweinten Bruder und Sohn.
Eine Zeitlang traten die Biglords von einem Bein auf das andere, beäugten abwechselnd ihre Stiefelspitzen und das trauernde Paar, bis ihre Blicke immer häufiger den Druud suchten. Der Greis stand neben Vater und Sohn und wirkte für Augenblicke genauso hilflos wie die Biglords. Schneller als sie aber besann er sich; sein dürrer Körper unter dem schwarzen Taratzenpelz straffte sich, und er fuchtelte ein paar Mal mit den Armen, bis die Menge zurückwich und sich Richtung Hütten zurückzog.
Djeyms, Touny und die beiden geschundenen Bogenschützen schlichen und hinkten an den Rand der Siedlung. Dort, zwischen Brabeelenhecken und knorrigen Weiden hockten sie im gelblichen Gras und warteten auf günstigere Lebensumstände.
Alizan spähte hierhin und dorthin, winkte in verschiedene Richtungen, stieß Zischlaute aus. Sein graugelbes Ledergesicht sah aus wie das eines Toten, seine weißen Zöpfe flogen ihm um die Schultern. Schließlich versammelten sich sämtlich verbliebene Biglords um ihn, elf insgesamt, darunter der älteste Sohn des Grandlords, ein gewisser Wichaad. Paacival hatte mindestens acht Söhne, die Töchter zu zählen hatte er sich nie die Mühe gemacht.
»Gwanload Paacival isse twauwig, bwauche Zeit.« Mit einer Kopfbewegung deutete der Druud auf den heulenden Grandlord. Ein paar Frauen und Kinder hatten sich um ihn und den Kleinen geschart. »Un bwauche wassutun.«
»Müssen de Kwötschis jagen«, sagte Wichaad, und die anderen Biglords nickten und schnitten grimmige Mienen.
»Yea!«, krächzte Druud Alizan. »Weama mache, aba east Oaguudoo beschwöan!« Wieder fuchtelte er mit beiden Armen, deutete zu seiner Hütte, deutete auf die Mitte des Dorfplatzes, deutete auf die Biglords. »Feuamache, Kessel hea, un eine woom …«
5
In der Kuppelwand bildete sich eine schrankartige Öffnung. Statt Schneehänge sah Dave dort jetzt einen Garderobenständer mit Kleidern an gläsernen Bügeln. Die Queen griff sich einen weißen Body und schlüpfte hinein. »Ich habe ein neues Panorama verlangt! Merken Sie, wie unzuverlässig dieses Viech ist?«
Dave fand ihren Ärger über den E-Butler ein wenig aufgesetzt. Er sah ihr zu, wie sie in ein langes schwarzes Kleid stieg. Eine Nymphomanin war sie nicht, sonst hätte sie ihn vermutlich trotz Infektionsgefahr schon verführt. Vielleicht trieb sie eine Art neurotischer Exhibitionismus? »Sie liegen also nackt auf der Sonnenbank, betrachten mich und stellen sich dabei den Mann ihres Herzens vor?«
Die Queen riss den roten Mantel vom Bügel. Während sie zu Dave lief, zog sie ihn über. »Dave!« Als wollte sie seine Wangen berühren, fasste sie seinen kugelrunden Klarsichthelm. »Wenn Sie wüssten, wie einsam ich bin.«
Mulroney – noch immer im Drehstuhl – sah zu ihr auf.
»Für alle nur die Queen, für das Octaviat nur die Regierungschef in! Für niemanden Victoria, die Frau mit einem menschlichen Herzen! Seit mein Vater tot ist, gibt es keinen hier unten, mit dem ich reden könnte wie mit Ihnen. Und es gibt keinen Mann, bei dem ich weiter nichts als eine Frau sein könnte, als bei ihnen. Zumindest ansatzweise.« Sie küsste den Helm über seiner Stirn.
Ihr Atem beschlug den Kunststoff; für Augenblicke sah Dave ihr Gesicht nur verschwommen und dafür den feuchten Abdruck ihrer Lippen im Niederschlag ihres Atems. Selbst dieser zwangsläufig missglückte Kuss erregte ihn. Himmel! Wie gern hätte er den Helm zurückgeklappt und ihren Mund geküsst. »Sie sind mir die letzte Verbindung zu dem Mann, den ich liebe.« Sie flüsterte, ihre Lippen und Augen waren feucht. »Und ich mag Sie, Dave. Ja, ich mag Sie wirklich.«
Dave glaubte ihr jedes Wort. Und wurde trotzdem nicht ganz klug aus ihr. Aber wie pflegte sein großer Bruder Mickey immer zu sagen? Du magst was von Physik und Astronomie verstehen, und ich von Motoren, aber die Frauen werden wir beide nie begreifen. Am besten, du versuchst es erst gar nicht.
Eine Zeitlang schwiegen sie. Sie kniete vor ihm, und er spürte die Wärme ihrer Hände durch seine Handschuhe. Sie sahen sich einfach nur an. Dave halb erstaunt, halb neugierig, die Queen weich, fast zärtlich.
»Noch zwei Stunden, dann beginnt die Octaviats-Sitzung«, sagte sie irgendwann mit verschwörerischem Unterton. »Ich werde heute die Expedition nach Nordamerika durchsetzen, Dave, verlassen Sie sich auf mich. Wir werden den Amerikanern … den Meerakanern ein Bündnis anbieten, und wir werden das Serum bekommen. Und Sie, Dave, Sie werden die wissenschaftliche Leitung der Expedition übernehmen. Vorher aber lassen Sie sich von unseren Ophthalmologen operieren – ich kann dieses antike Brillengestell an Ihnen nicht mehr sehen!«
Von einem Augenblick zum anderen wechselte das Panorama: Die glitzernde Schneewelt zerflatterte, und das Rundumbild einer Wüstenlandschaft baute sich auf. Jedenfalls war es auf den ersten Blick eine Wüstenlandschaft. Auf den zweiten sah man im Hintergrund einen Fluss Sand und Dünen zerschneiden. Jenseits des Flusses wucherte üppiger Regenwald, und ein Mann saß dort allein im Ufergras.
Dave konnte das Gesicht des Mannes nicht erkennen, dazu war das andere Ufer viel zu weit entfernt. Aber er kannte den verschollenen König von Bildern. Wie immer trug er eine Art cremefarbenen Rüschenanzug, hatte rosa Langhaar – eine Perücke natürlich, fast alle Haarschöpfe hier unten waren Perücken – und schien verträumt in den Strom zu blicken. O ja, das war er: King Roger der Dritte, Prinz von Kent und König der britannischen Inseln. Vor mehr als zwei Jahren aus dem kurzen, aber verlustreichen Krieg gegen die Nordmänner nicht in die Community zurückgekehrt. Seit man seinen Helm in Südengland am Ufer des Tests gefunden hatte, zweifelte niemand mehr an seinem Tod.
Natürlich war er es nicht wirklich. Eine virtuelle Animation, weiter nichts. Dennoch richtete Victoria sich auf und winkte ihm zu, und wie immer winkte Roger III. zurück.
»Ja, ja, der gute alte Roger«, seufzte es hinter ihnen. Beide fuhren herum. Micky Maus. Unbemerkt hatte sich sein Monitor zugleich mit dem neuen Panorama aufgebaut. »Das waren noch Zeiten, als der King mich fragte, wie es mir geht.«
»Was fällt dir ein, du Witzfigur?« Queen Victoria die Zweite wurde laut – ein nicht minder seltenes Ereignis wie der Sentimentalitätsanfall kurz zuvor. »Ich hasse es, von meinem Butler überrascht zu werden!«
»Hey, Vicky! Du kannst ja richtig persönlich werden!« Die Maus grinste von einem Ohr zum anderen. »Bleib cool, okay? Ich hab nämlich gute Nachrichten für unsere Majesdingsbums: Fanlur von Coellen ist eingetroffen. Im SEF hat er gerade seinen Köter verabschiedet und legt wahrscheinlich in diesen Minuten einen Schutzanzug an.«
Das SEF – Septisch Externes Foyer – war ein bewohnbares Areal oberhalb des Bunkers in der Westminster-Hall. Die Technos hatten deren Ruine durch ein Kuppelgewölbe aus Titanglas abgestützt und mit Schleusen von der Außenwelt abgeschottet. Dave und Fanlur lebten dort seit ihrer Rückkehr von Meeraka; ohne Schutzanzüge; wenn der eine nicht gerade Reparaturarbeiten an der Twilight of the Gods zu erledigen hatte und der andere sich nicht zu Studienzwecken im Bunker aufhielt.
»Und die zweite Good News: Sir Anthony lässt ausrichten, dass du die Präsentation des neuen Programms in zwei Stunden wie geplant über die Bühne bringen kannst.« Der E-Butler räusperte sich geziert. »Sei mir nicht böse, Vicky, aber ich muss es loswerden: Die Geheimniskrämerei geht mir auf den Schwanz, ich bin das von deinem Vater einfach nicht gewöhnt. Was für ein scheiß-neues Programm soll das sein? Das hat doch hoffentlich nichts mit mir zu tun?«
»O doch, du Karikatur eines E-Butlers! Deine Tage sind gezählt! Noch heute wirst du gelöscht!«
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2020
- ISBN (eBook)
- 9783738941401
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Juni)
- Schlagworte
- kometen lennox tauchfahrt ungewisse zeitalter