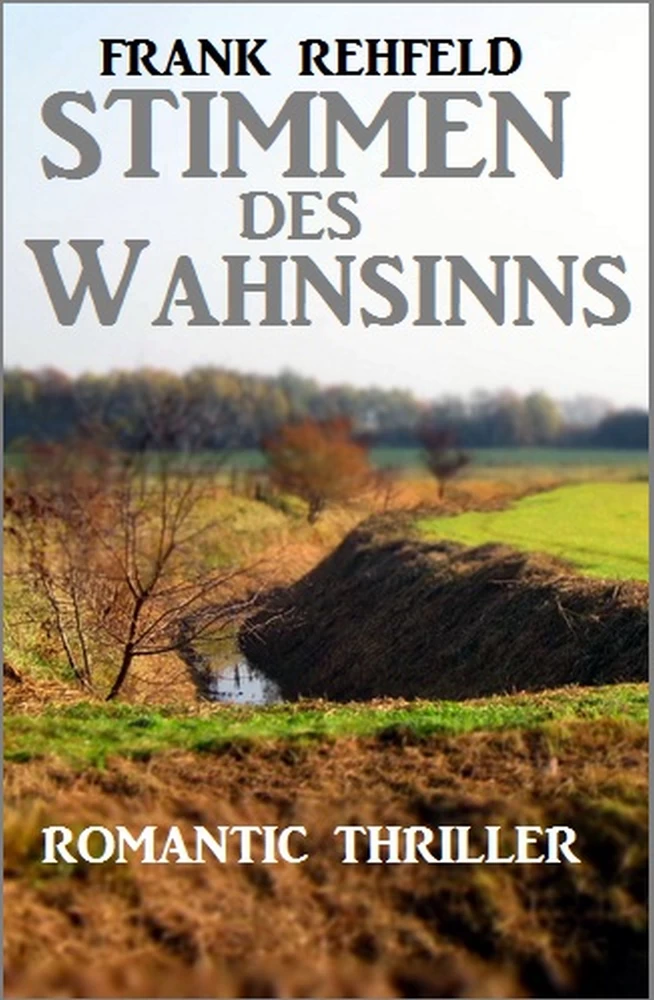Zusammenfassung
Romantic Thriller von Frank Rehfeld
Der Umfang dieses Buchs entspricht 116 Taschenbuchseiten.
Nach eine Woche im Koma wacht Jennifer Askin endlich wieder auf. Doch warum sie wie eine Mumie bandagiert im Krankenhaus liegt, versteht sie nicht, denn sie hat keine Erinnerung an das, was geschehen ist.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Stimmen des Wahnsinns
Published by Uksak Sonder-Edition, 2018.
Stimmen des Wahnsinns

|

|


Romantic Thriller von Frank Rehfeld
Der Umfang dieses Buchs entspricht 116 Taschenbuchseiten.
Nach eine Woche im Koma wacht Jennifer Askin endlich wieder auf. Doch warum sie wie eine Mumie bandagiert im Krankenhaus liegt, versteht sie nicht, denn sie hat keine Erinnerung an das, was geschehen ist.
Copyright

|

|


Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2018 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
1

|

|


Im gleichen Moment, in dem sie aufwachte, fielen die Schmerzen wie ein gieriges Raubtier über Jennifer Askin her. Noch nie zuvor in ihrem Leben hatte sie so entsetzliche Qualen ausgestanden. Jeder Nerv ihres Körpers schien in Flammen zu stehen. Der Schmerz war unerträglich.
Mit einem Ruck fuhr sie hoch. Sie wollte schreien, aber nur ein dumpfes Stöhnen kam über ihre Lippen. Stimmen drangen von irgendwoher auf sie ein. Sie spürte einen Einstich im Arm und wollte die Augen öffnen, aber es gelang ihr nicht.
Ihre Augen! Was war mit ihren Augen geschehen? Wieso konnte sie nicht sehen?
Hände drückten sie sanft, aber bestimmt zurück. Nach einigen Sekunden begann das injizierte Medikament zu wirken. Die Schmerzen ließen langsam nach und sanken auf ein erträgliches Maß herab. Gleichzeitig konnte Jennifer wieder ein wenig klarer denken.
"Wo ... wo bin ich?", fragte sie stockend. Das Reden fiel ihr ungewohnt schwer. Die Zunge lag wie ein Fremdkörper in ihrem Mund. "Was ist mit ... meinen Augen?"
"Bleiben Sie ganz ruhig, Miss Askin!", vernahm sie eine männliche, sympathisch klingende Stimme. "Mit Ihren Augen ist nichts geschehen, wir haben nur einen Verband anlegen müssen."
Obwohl sie sich immer noch nur nur mühsam konzentrieren konnte, fiel Jennifer der Widerspruch in seinen Worten auf. Wozu sollte ein Verband nötig sein, wenn nichts mit ihren Augen geschehen war? Sie versuchte sich zu erinnern, wo sie sich befand, und wie sie hierher gekommen war, doch wo ihr Gedächtnis sein sollte, klaffte nur ein tiefes dunkles Loch in ihrem Gehirn.
"Wo bin ich?", fragte sie noch einmal.
"Sie befinden sich im Memorial-Hospital. Seien Sie unbesorgt, Sie werden wieder ganz gesund. Wir haben einen Spezialisten hinzugezogen. Er sagt, dass Sie auch wieder ganz normal werden sehen können."
"Was ist geschehen? Ich ... ich kann mich an nichts erinnern."
"Versuchen Sie zu schlafen!", bat die Stimme, bei der es sich um einen Arzt handeln musste. Er wich ihren Fragen aus und sprach zu ihr, wie zu einem kleinen Kind. Begriff er denn nicht, dass das ihren Schrecken erst steigerte? Was - um alles in der Welt - war mit ihr passiert? Wieso konnte sie sich an nichts erinnern?
Diese Gedanken lösten eine geradezu hysterische Angst in ihr aus, doch wurde sie von dem Beruhigungsmittel sofort wieder unterdrückt. Obwohl sie lange geschlafen haben musste, fühlte sich Jennifer immer noch müde. Am liebsten hätte sie der Bitte gehorcht und wäre sofort wieder eingeschlafen, aber zuerst musste sie Klarheit über ihr Schicksal gewinnen.
"Warum sagen Sie nichts?", schrie sie. Allmählich wich die Taubheit in ihrem Mund, und sie gewann auch die Kontrolle über ihre Stimmbänder zurück. "Ich bin doch kein Kind. Sagen Sie mir doch endlich etwas!"
"Sie erinnern sich wirklich an nichts?"
"Nein, das habe ich doch gesagt."
"Nun, Miss Askin, Sie hatten einen Unfall. Aber Sie dürfen sich nicht aufregen. Schlafen Sie wieder ein! Morgen werden Sie wieder sehen können, und dann sprechen wir über alles. Wichtig ist jetzt nur, dass Sie wieder aufgewacht sind."
Jennifer nickte mühsam. Der Arzt hatte recht. Sie brauchte Ruhe, und im Grunde wollte sie auch keine Antworten bekommen. Zumindest nicht jetzt im Augenblick. Sie begriff, dass sie sich mit einem Mal vor der Wahrheit fürchtete.
Ein Unfall!
Die Worte lösten einen schwachen Schimmer von Erinnerung aus. Das Bild von Flammen stieg plötzlich aus ihrem Gedächtnis auf. Flammen, eine riesige Feuersbrunst, die sich ihr näherte, immer näher und näher kam und wie mit glühenden Händen über ihren Körper strich ...
Das war Jennifers letzter Gedanke, bevor sie wieder das Bewusstsein verlor.
2

|

|


Das zweite Aufwachen verlief ganz anders als das erste. Es war kein abruptes Aufschrecken, sondern ein langsames Hinübergleiten aus ihren Träumen in die Realität. Es musste an den Beruhigungsmitteln liegen. Sie hatte geträumt und wusste noch, dass es in wirren, unzusammenhängenden Bildern geschehen war, aber anders als sonst - meistens konnte sie sich an den Inhalt des Traumes nicht mehr erinnern.
Sie konnte immer noch nicht sehen, und sofort griff die Angst wieder nach ihr. Hatte der Arzt sie belogen, um ihr nicht sofort nach dem Aufwachen einen Schock zu versetzen? Würde sie vielleicht sogar nie mehr sehen können, für den Rest ihres Lebens in einer Welt aus Schatten und ewiger Finsternis leben müssen und ihre Umgebung allein anhand der Geräusche und dem, was sie mit den Fingern ertasten konnte, wahrnehmen?
War das ihr entsetzliches Schicksal? Jennifer kämpfte gegen den Gedanken an.
"Wie fühlen Sie sich heute?", fragte die Stimme des Arztes, die sie schon am Vortag gehört hatte.
Jennifer spannte ein paar Muskeln an und bewegte ihre Arme und Beine ein wenig. Der Schmerz war immer noch da, aber er war erträglich. Ein dumpfes, unangenehmes Zerren und Brennen, an das sie sich gewöhnen konnte.
"Besser", antwortete sie. "Aber was ist mit meinen Augen? Bitte, sagen Sie mir die Wahrheit, Doktor."
"Aber ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Wenn Sie es wünschen, können wir den Verband jetzt abnehmen."
"Natürlich möchte ich das", rief Jennifer ungeduldig und gleichzeitig von grenzenloser Erleichterung gepackt.
"Ich wollte Sie nur vorwarnen, dass es etwas wehtun wird", sagte eine andere männliche Stimme.
Jennifer spürte kundige Finger, die sich an dem Verband um ihr Gesicht zu schaffen machten. Bahn für Bahn wurde die Mullbinde abgehoben.
"Beißen Sie jetzt die Zähne zusammen!", forderte der Arzt sie auf. Mit einem Ruck wurde die letzte Bahn abgerissen.
Jennifer stöhnte gequält auf. Unerträglich grelles Licht drang an ihre Augen und fraß sich sogar durch die immer noch geschlossenen Lider hindurch. Sie hatten an dem Verband gehaftet und waren für einen Sekundenbruchteil geöffnet worden.
"Dämpfen Sie das Licht noch weiter, Schwester!", ordnete der Arzt an. "Legen Sie ein Tuch über die Lampe!"
Es dauerte mehrere Minuten, bis die bunten, grellen Lichtreflexe verschwanden, die sich in Jennifers Netzhaut eingebrannt hatten. Zögernd schlug sie die Augen auf. Wieder kam ihr das Licht im ersten Moment unerträglich hell vor, aber ihre Augen gewöhnten sich jetzt schnell daran. Schon nach wenigen Sekunden bemerkte Jennifer, dass es in Wirklichkeit fast dunkel im Zimmer war. Die Jalousien waren herabgelassen worden. Die einzige Lichtquelle war ein kleines Lämpchen auf ihrem Nachttisch, und selbst diese war durch ein Laken noch zusätzlich gedämpft.
Angenehmes, wattiges Dämmerlicht hüllte Jennifer ein. Sie blinzelte ein paarmal. Es tat nicht mehr weh. Drei nur schemenhaft erkennbare Gestalten bewegten sich vor ihr.
"Ich glaube, Sie können das Tuch jetzt wieder wegnehmen", sagte eine von ihnen.
Wieder schloss Jennifer im ersten Moment geblendet die Augen, dann konnte sie die Gestalten im Lampenlicht genauer erkennen. Es handelte sich um eine Krankenschwester und zwei Männer in Arztkitteln.
"Ich bin Doktor Freeman", stellte sich der eine vor. An der Stimme erkannte sie, dass es der Arzt war, mit dem sie bereits am Vortag gesprochen hatte. Er mochte um die vierzig Jahre alt sein. Eine starke Brille verlieh seinem Gesicht ein wenig Ähnlichkeit mit dem einer Eule.
"Und das ist Doktor Johnson, Spezialist für Augenkrankheiten", machte er sie auch mit seinem Kollegen bekannt. Johnson war noch einmal mindestens zwanzig Jahre älter. Sein schütteres Haar war völlig grau, und seine Augen blickten auf die väterlich-gütige Art, die alten Männern manchmal zueigen ist.
"Sie haben unglaubliches Glück gehabt, Miss Askin", sagte Johnson. "Es grenzt an ein Wunder, dass Sie ihr Augenlicht behalten haben."
"Aber was ist denn überhaupt passiert?", rief Jennifer verzweifelt. "Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern."
"Es hat bei Ihnen Zuhause gebrannt", sagte Dr. Freeman langsam. "Ein elektrischer Kurzschluss, wie die Polizei inzwischen festgestellt hat. Ein Nachbar hat sie aus dem Haus gerettet. Sie haben einen Schock erlitten und fast eine Woche im Koma gelegen. Wir hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben, aber jetzt sind Sie über den Berg."
Mühsam versuchte sich Jennifer zu erinnern. Ja, sie hatte von Flammen geträumt, aber es war offenbar mehr gewesen, als nur ein Traum. Doch je stärker sie sich auf Einzelheiten zu konzentrieren versuchte, desto stärker schienen die Erinnerungen vor ihr zurückzuweichen. Sie hatte nichts wirklich vergessen, das spürte sie. Die Erinnerungen waren noch tief in ihrem Unterbewusstsein vergraben, wie in unendlich vielen Schubladen verstaut, doch jedes Mal, wenn sie danach zu greifen versuchte, schien eine unsichtbare Hand die ihre zur Seite zu schlagen.
Das schöne Haus am Rande von London, das Haus, in dem sie seit vielen Jahren mit ihren Eltern wohnte, sollte abgebrannt sein? Der Gedanke erschien ihr unvorstellbar.
Doch dann musste sie an etwas anderes, tausendmal Schlimmeres denken.
"Meine Eltern", rief sie. "Was ist mit meinen Eltern?"
Ein Schatten glitt über Freemans Gesicht.
"Wir sollten später darüber sprechen", erklärte er ausweichend.
"Nein, ich will es jetzt sofort wissen. Bitte, Doktor. Ich habe ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren."
"Es wird Ihnen sehr wehtun und ..."
"Sie sind tot, nicht wahr?", hauchte Jennifer und krallte ihre Finger in die Bettdecke. Sie spürte, wie alle Farbe aus ihrem Gesicht wich. "Oh mein Gott, ist das wirklich wahr? Sind sie tot? Sagen Sie mir, stimmt das?"
Freeman gab keine Antwort, sondern nickte nur, langsam und abgehackt.
"Oh mein Gott", schluchzte Jennifer noch einmal.
Sie hatte es gewusst, hatte die schreckliche Wahrheit irgendwie tief in ihrem Inneren geahnt. Sie wollte weinen, schreien, aber es gelang ihr nicht. Sie war ganz ruhig, was zum Teil bestimmt auch an den Medikamenten lag. Aber der Schmerz war da, wenn er im Augenblick auch nicht offen durchbrach. Es erschreckte sie beinahe selbst, wie gelassen sie die schlimme Botschaft aufnahm, wenn es auch wohl eher Betäubung als wirkliche Ruhe war. Sie war noch zu verwirrt, um etwas zu empfinden, und der Schmerz saß zu tief. Er brauchte Zeit, um zu wirken, aber er würde entsetzlich sein, wenn er einmal in ihr Bewusstsein sickerte. Sie hatte ihre Eltern abgöttisch geliebt.
"Es tut mir so leid", sagte Dr. Freeman. "Wenn Sie möchten, lasse ich Ihnen noch einmal ein Beruhigungsmittel spritzen."
Jennifer schüttelte den Kopf.
"Nein, das ist nicht nötig." Sie war dem Tod begegnet und hatte es überlebt. Nun wollte sie alles spüren, selbst den Schmerz. Sie wollte fühlen, dass sie noch lebte, und das schloss auch alle Schattenseiten mit ein.
Dr. Johnson räusperte sich verlegen.
"Mit Ihren Augen ist ja alles in Ordnung. Ich kann dann wohl gehen." Mit raschen Schritten wandte er sich zur Tür, eine Spur zu schnell, um zu verbergen, dass es nichts weiter als eine Flucht war. Jedem Menschen war es unangenehm, wenn er miterleben musste, wie einem anderen der Tod geliebter Menschen mitgeteilt wurde.
"Bitte, Doktor, gehen Sie auch", sagte Jennifer an Dr. Freeman gewandt. "Ich möchte gerne allein sein."
"Sicher, wenn Sie es wünschen. Sollte etwas sein, dann klingeln Sie ruhig. Der Knopf befindet sich direkt neben dem Bett. Ach ja, noch etwas. Ihr Bruder hat uns gebeten, ihn unverzüglich anzurufen, wenn Sie aufwachen."
"Robert? Aber er ist doch in Birmingham."
"Als er von dem Unglück hörte, ist er sofort nach London gekommen. Sind Sie einverstanden, wenn ich ihn gleich anrufe?"
Robert, dachte Jennifer. Sie hatte ihren älteren Bruder schon lange nicht mehr gesehen. Ein halbes Jahr war es bestimmt schon her, und auch da war er nur aus Anlass von Vaters fünfundfünfzigstem Geburtstag für ein Wochenende zu Besuch gekommen.
"Miss Askin?"
Jennifer schrak aus ihren Gedanken auf.
"Ja, natürlich, rufen Sie ihn ruhig an. Ich würde mich sehr freuen, wenn er sofort vorbeikäme. Ich ... ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich reden kann."
Dr. Freeman nickte und verließ zusammen mit der Krankenschwester den Raum. Jennifer ließ sich zurücksinken und starrte die Decke an. Sie fühlte sich schon wieder müde, und selbst das Licht der schwachen Glühbirne brachte ihre Augen inzwischen wieder zum Tränen. Sie schaltete die Lampe aus. Es würde noch eine Weile dauern, bis sie sich wieder an das Sehen gewöhnt hatte.
Vorsichtig hob sie die Hände und berührte ihren Kopf. Er war ebenso wie ihre Hände mit Mullbinden umwickelt, so dass nicht einmal das Gesicht ganz frei blieb. Jennifer ahnte, was das zu bedeuten hatte. Sie war immer so stolz auf ihre langen, rot-goldenen Locken gewesen. Bestimmt waren sie völlig verbrannt und die Reste abgeschnitten worden. Aber besser die Locken, als das Leben verlieren.
Auch jetzt konnte sie noch nicht glauben, dass ihre Eltern tot sein sollten. Sie zweifelte nicht an der Aussage des Arztes, doch ihr Gehirn weigerte sich, die Tatsachen zu akzeptieren. Vielleicht war es eine reine Schutzmaßnahme, um nicht den Verstand zu verlieren. Sie stellte sich ihre Eltern vor. Das schmale, feine Gesicht ihrer Mutter, die sich stets nur in feinster Gesellschaft bewegte, die Teeparties für ihre Freundinnen gab und die stets ein tröstendes Wort für Jennifer bereitgehalten hatte.
Doch Jennifer erinnerte sich auch an ihren Vater, obwohl sie sich mit ihrer Mutter meist besser verstanden hatte. Er war der Besitzer eines bedeutenden Computerwerkes und Vorsitzender zahlreicher Wohltätigkeitsvereine gewesen und hatte es wohl nie verwunden, dass die Queen ihn niemals in den Adelsstand erhoben hatte. Er hatte vornehme Gesellschaften gegeben und sowohl bei sich, wie auch bei seinen Kindern stets auf absolut korrektes Verhalten geachtet. Trotzdem hatte Jennifer ihn geliebt, hatte als Kind oft auf seinem Schoß gesessen und sich von ihm Märchen von Feen und verwunschenen Prinzen erzählen lassen.
Tränen schossen ihr in die Augen, doch der wahre Schmerz blieb auch jetzt noch unter einem Mantel aus schützender Betäubung verborgen.
3

|

|


Jennifer wusste nicht, wie lange sie einfach nur reglos dalag, ins Dunkel starrte und sich ihre Eltern ins Gedächtnis zu rufen versuchte, als die Tür geöffnet wurde. Der grelle Schein der aufflammenden Deckenlampe ließ sie zusammenzucken und stöhnend die Hände vor die Augen schlagen. Vorsichtig blinzelte sie zwischen den Fingern hindurch, sah jedoch nur eine dunkle Gestalt, bis sie sich an das Licht gewöhnt hatte.
"Jennifer!" Obwohl Robert nur flüsterte, klang es wie ein erstickter Schrei. In dem einen Wort ihres Bruders lag all die Verzweiflung und Qual, die sie selbst - noch - nicht zu empfinden in der Lage war.
"Robert", hauchte sie. Tränen schimmerten in seinen Augen, als er an ihr Bett trat. Er setzte sich auf die Kante, griff nach ihrer bandagierten Hand und drückte sie fest. Einige Sekunden lang schauten sie sich nur in stummem Schmerz an. Seine alleinige Gegenwart, das Gefühl, nicht allein zu sein, tat Jennifer gut. Ihr Bruder war von schlankem Wuchs. Glattes, dunkelblondes Haar rahmte sein scharfgeschnittenes Gesicht ein. Es war ein wenig eckig und das kantig vorstehende Kinn verlieh ihm ein markantes Aussehen.
"Es ist so schrecklich", brach er schließlich das Schweigen. "Als ich von dem Unglück hörte, bin ich sofort nach London gekommen. Ich hatte solche Angst, auch dich noch zu verlieren."
"Dr. Freeman sagte mir, ich hätte im Koma gelegen."
"Ja, eine ganze Woche lang. Eine Zeitlang sah es gar nicht gut aus. Das Schlimmste waren nicht einmal die Verletzungen, sondern der Schock." Er zögerte kurz. "Die Ärzte konnten nicht einmal die Möglichkeit ausschließen, dass du überhaupt nicht mehr aufwachen würdest."
Jennifer lächelte schwach. Seine unbeholfene Art, sich auszudrücken, zeigte ihr, wie sehr alles ihn mitgenommen hatte.
"Du weißt doch, Unkraut vergeht nicht", flüsterte sie und drückte seine Hand noch fester. "Ich weiß immer noch nicht, was eigentlich genau geschehen ist. In meinem Kopf brummt es, wie in einem Bienenstock. Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern."
"Wie meinst du das?"
"Na ja, ich weiß, wer ich bin, und alles, was vor dem Brand lag, habe ich noch im Gedächtnis, aber was in jener Nacht geschah, ist völlig weg. Als ich aufwachte, wusste ich noch nicht einmal, was überhaupt geschehen war. Bitte, Robert, erzähle mir, was du weißt."
Unbehaglich hob er die Schultern und ließ seinen Blick durch das Zimmer wandern.
"Also gut", willigte er zögernd ein. "Aber viel mehr, als Dr. Freeman dir schon gesagt hat, habe ich auch nicht erfahren können. Die Polizei hat festgestellt, dass es einen elektrischen Kurzschluss gegeben hat, der den Brand auslöste. Das Feuer muss sich blitzartig in dem alten Gemäuer ausgebreitet haben. Du weißt ja, die Böden und zum Teil auch die Wände bestanden nur aus Holz. Glücklicherweise wurde der Brand rasch entdeckt. Ein Nachbar rief die Feuerwehr an und wagte sich in das brennende Haus hinein. Er fand dich bewusstlos auf der Treppe liegend und rettete dich im buchstäblich letzten Moment. Direkt hinter euch ist der Hauptflügel des Gebäudes in sich zusammengebrochen."
Vor Grauen war Jennifer einige Sekunden lang wie gelähmt.
"Wer war es?", fragte sie schließlich. Sie musste alle Überwindung aufbringen, die drei Worte auszusprechen.
"Er heißt Norman Randall. Anscheinend wohnt er noch nicht lange dort, denn ich kenne ihn und seine Familie gar nicht von früher. Ich habe nach meiner Ankunft direkt mit ihm gesprochen und ihm für alles gedankt."
Norman Randall also. Das war auch für Jennifer eine Überraschung. Robert hatte recht mit seiner Vermutung; die Randalls wohnten noch nicht lange in der Gegend, und Norman war nur für eine Weile bei seinen Eltern zu Besuch. Sie hatte ihn ein paarmal auf der Straße gesehen und dem ersten Eindruck nach als ziemlich uninteressanten und langweiligen Typ eingestuft. Einer dieser schmächtigen jungen Männer mit einem unauffälligen Alltagsgesicht und unmodischer Kleidung, von denen man sich gut vorstellen konnte, dass sie den größten Teil ihres Lebens hinter dem Schreibtisch irgendeiner Behörde fristeten. Sie konnte sich kaum vorstellen, dass ausgerechnet dieser Norman Randall sie unter Einsatz seines eigenen Lebens aus dem brennenden Haus gerettet haben sollte.
"Haben die Ärzte dir irgendetwas über mich gesagt, was sie mir verheimlichen wollen?", wechselte sie das Thema. "Bitte, Robert, ich möchte die ganze Wahrheit wissen. Es ist nicht nötig, mir etwas vorzumachen. Was wird sein, wenn die Verbände abgemacht werden? Ich kann die Wahrheit ertragen."
Verwundert runzelte Robert die Stirn, dann glitt ein Lächeln über sein Gesicht.
"Warum sollte man dir etwas vormachen? Du hast wirklich ungeheueres Glück gehabt, das sind keine Ausflüchte. Auch wenn du mit den ganzen Mullbinden im Augenblick wie eine ägyptische Mumie aussiehst, wird das bald schon ganz anders sein. Wahrscheinlich werden noch nicht einmal Narben zurückbleiben."
"Nicht einmal Narben", echote Jennifer. Ein Gefühl von Schuld stieg in ihr auf, dass sie sich über ihr Aussehen Sorgen machte, während ihre Eltern bei dem Feuer umgekommen waren. Robert schien ihre Gedanken zu ahnen.
"Du darfst dir keine Vorwürfe machen", sagte er. "Ich habe Vater schon vor Jahren gesagt, dass die elektrischen Leitungen im Haus erneuert werden müssten. Sie waren doch schon uralt. Hätte ich nur hartnäckiger darauf bestanden, dann wäre alles nicht passiert!"
"Wann ... wann wird die Beerdigung sein?", fragte Jennifer mit brüchiger Stimme.
Das Gesicht ihres Bruders verdunkelte sich.
"Sie war bereits vor drei Tagen. Niemand wusste, wann du aus dem Koma erwachen würdest. Wir konnten nicht mehr länger warten. Es tut mir so leid, dass du nicht einmal daran teilnehmen konntest."
Die Tür des Zimmers wurde geöffnet, und die Krankenschwester trat ein.
"Es tut mir leid, Mr. Askin, aber Sie müssen jetzt gehen. Sie dürfen Ihre Schwester nicht überanstrengen. Außerdem muss sie zur Massage und Gymnastik."
"Gymnastik?"
"Durch die lange Bewusstlosigkeit funktioniert der Blutkreislauf nicht mehr richtig", erklärte die Schwester geduldig. "Die Muskeln haben sich verkrampft und müssen jetzt langsam wieder gedehnt werden. Bei einer Woche ist es noch nicht besonders schlimm, aber gezielte Bewegungsübungen sind notwendig."
"Nun gut, dann muss ich wohl", sagte Robert bedauernd. "Morgen Mittag komme ich wieder. Soll ich dir irgendetwas mitbringen? Ich bin vorhin so schnell hergekommen, dass ich nicht einmal Blumen besorgen konnte."
Jennifer schüttelte den Kopf.
"Im Moment fällt mir nichts ein. Wenn doch, dann rufe ich dich an. Ich freue mich schon auf Morgen."
Robert drückte noch einmal fest ihre Hand und lächelte ihr aufmunternd zu, dann verließ er das Zimmer mit raschen Schritten.
4

|

|


Jennifer bekam ihre Blumen bereits am Vormittag des nächsten Tages, allerdings nicht von ihrem Bruder, sondern von Norman Randall. Sie las gerade in einer Illustrierten, die ihr die Krankenschwester gegeben hatte, als es zaghaft an der Tür klopfte.
"Herein", rief sie in der festen Erwartung, dass es entweder eine Bekannte oder eine Arbeitskollegin war, oder dass Robert doch schon früher als angemeldet gekommen wäre. So erschrak sie im ersten Moment, als sie plötzlich Norman Randall vor sich sah. Er trug einen schwarzen Anzug, der ihm bedeutend besser stand, als die Sachen, die er gewöhnlich trug, und die ihm meist mindestens eine Nummer zu groß waren. Allerdings trug er den schwarzen Anzug wohl eher aus Taktgefühl als aus modischen Gründen. In der Hand hielt er einen in durchsichtige Folie eingepackten Strauß gelber Rosen.
Verlegen räusperte er sich: "Guten Tag, Miss Askin. Ich weiß nicht, ob Sie mich kennen, und ich möchte Sie nicht stören ..."
"Aber natürlich kenne ich Sie, Mr. Randall!", unterbrach Jennifer ihn aufgeregt. "Mein Bruder hat mir schon erzählt, dass Sie es waren, der mich aus dem brennenden Haus gerettet hat."
"Na ja, ich habe das Feuer gesehen und zu helfen versucht. Jeder andere hätte das an meiner Stelle auch getan."
"Aber Sie haben dabei ihr eigenes Leben riskiert. Ich glaube nicht, dass viele andere Menschen das auch getan hätten. Wie kann ich Ihnen nur jemals dafür danken, Mr. Randall?"
"Sagen Sie Norman zu mir, einverstanden? Und zu danken brauchen Sie mir nicht. Ich bin froh, dass ich Ihnen helfen konnte. Hier, ich habe Ihnen etwas mitgebracht." Er reichte ihr die Blumen.
"Die sind wunderschön", rief Jennifer dankbar. Sie roch an den Knospen. "Und sie duften auch herrlich. Ich werde die Schwester bitten, dass sie eine Vase dafür holt." Sie drückte auf den Knopf neben ihrem Bett.
Während die Krankenschwester eine Vase brachte und die Rosen hineinstellte, rückte sich Norman einen Stuhl zurecht und setzte sich.
"Der Tod Ihrer Eltern tut mir leid", sagte er, als die Schwester das Zimmer wieder verlassen hatte. "Aber ich konnte nichts für sie tun. Als ich in das Haus kam, fand ich Sie bewusstlos auf der Treppe liegend. Sobald ich Sie ins Freie gebracht hatte, brach das Haus zusammen."
"Wahrscheinlich bin ich aufgewacht und habe mich aus eigener Kraft bis dorthin schleppen können", überlegte Jennifer. "Auf der Treppe bin ich dann wohl ohnmächtig geworden."
"Wenn Sie noch im oberen Stockwerk gewesen wären, hätte ich wahrscheinlich auch nichts mehr machen können", ergänzte Norman. "Dort brannte bereits alles lichterloh. Also waren Sie an Ihrer Rettung auch selbst beteiligt. Wissen Sie denn nicht mehr, was geschehen ist?"
"Nein, ich habe alles vergessen. Der Arzt meint, es läge am Schock. Aber eigentlich bin ich ganz froh darüber. Ich möchte mich überhaupt nicht an dieses schreckliche Erlebnis erinnern."
Sie schwiegen einige Minuten lang, während denen Jennifer den jungen Mann genauer musterte. Sie hatte Norman Randall zuvor nur einige Male flüchtig gesehen, und sie hatten sich nicht einmal gegrüßt. Erst jetzt fiel ihr auf, dass er älter war, als sie auf den ersten Blick geschätzt hatte. Mitte Zwanzig etwa, also in ihrem Alter. Um seine dunklen Augen herum hatten sich winzige Lachfältchen eingegraben, die ihn jünger aussehen ließen. Er trug sein dichtes schwarzes Haar wesentlich kürzer als beim letzten Mal, als sie ihn gesehen hatte; ein wenig zu kurz, um ihm wirklich gut zu stehen. Es dauerte einen Augenblick, bis ihr bewusst wurde, dass es nicht am mangelnden Können seines Friseurs lag. Seine Haare waren von dem Feuer versengt worden.
"Sie haben Ihre Eltern sehr gemocht, nicht wahr?", sagte er, als das Schweigen nach einer Weile unangenehm zu werden begann.
Jennifer nickte stumm und kämpfte gegen die Tränen an, die ihr bei seinen Worten in die Augen schossen.
"Sehr", antwortete sie mit einiger Verzögerung. "Mutter ging es in letzter Zeit nicht besonders gut. Sie hatte schwer an ihrer Gicht zu leiden. Deshalb habe ich darauf verzichtet, mir eine eigene Wohnung zu nehmen und mich - so gut es ging - um sie gekümmert."
"Ich habe vor kurzem mein Studium beendet", erklärte Norman. "Jetzt suche ich in London eine Anstellung. Meine Eltern haben mir angeboten, bei Ihnen zu wohnen, bis ich eine gefunden habe und mir eine Wohnung leisten kann. Zum Glück, denn dadurch habe ich das Feuer bemerkt. Ich liege abends oft lange wach und lese."
"Was haben Sie denn studiert?", erkundigte sich Jennifer, um das Gespräch nicht wieder einschlafen zu lassen.
"Höhere Betriebswirtschaft in Cambridge."
"Cambridge in Amerika, oder hier in England?"
"Hier in England", erwiderte er lächelnd.
"Genau wie mein Bruder. Das ist ein ziemlich schwieriges Studium, nicht wahr? Ich weiß noch, dass Robert ständig darüber geklagt hat."
"Es geht. Man muss nur eben viel lernen." Verlegen knetete Norman seine Hände. Es war ihm sichtlich unangenehm, wenn seine Leistungen so hervorgehoben wurden.
Jennifers Achtung vor ihm stieg. Ein in einem so komplizierten Fach abgeschlossenes Cambridge-Studium war wirklich ein Grund, stolz auf sich zu sein. Die Universität war weltberühmt. Als ihr Bruder sie vor einigen Jahren verlassen hatte, hatte er vor jedem, der es hören wollte - und einer Menge Leute, die es längst schon nicht mehr hören konnten - damit geprahlt und sich viel darauf eingebildet, zumal er durch Vaters Hilfe sofort eine leitende Stelle bei einer großen Firma gefunden hatte.
Normans Bescheidenheit gefiel ihr, da sie spürte, dass es nicht die Art falscher Bescheidenheit war, hinter der sich in Wirklichkeit Hochmut und eine besonders ausgeprägte Sucht nach Anerkennung versteckte. Überhaupt merkte sie erst jetzt, dass der junge Mann ihr sympathisch war. Auf der Straße hatte sie ihn nie beachtet, und wenn sie ihn jetzt mit anderen Augen sah, so lag das nicht allein daran, dass er ihr das Leben gerettet hatte. Zumindest glaubte sie, dass es nicht allein daran lag. Norman war ohne Zweifel intelligent, aber auch überaus schüchtern. Offenbar legte er nicht viel Wert auf Äußerlichkeiten, aber so wie er selbst innere Werte besitzen musste, suchte er sie vielleicht auch bei anderen. Solche Werte waren zweifellos wichtiger als modische Kleidung und ähnliches.
"Warum sind Sie hergekommen?", fragte sie. "Nur ein Höflichkeitsbesuch?"
Norman zuckte fast unmerklich zusammen und wurde rot im Gesicht.
"Weil ..." Er schluckte. Seine Blicke huschten unstet durch den Raum, wobei er fast krampfhaft versuchte, Jennifer nicht anzuschauen. "Weil ich Sie gerne wiedersehen und näher kennenlernen wollte", sagte er leise.
Jennifer lächelte schwach.
"Ich stehe so tief in Ihrer Schuld, dass ich Ihnen wohl keinen Wunsch abschlagen kann."
Sein Gesicht verfinsterte sich. Ein zorniges Funkeln trat in seine Augen, und er starrte Jennifer nun direkt an.
"Hören Sie doch endlich damit auf!", sagte er in fast bösem Ton. "Ich möchte nicht, dass Sie sich mit mir nur unterhalten, weil Sie glauben, dazu verpflichtet zu sein. Wenn ich Sie langweile, oder Sie mich nicht mögen, dann sagen Sie es ruhig, und ich werde gehen."
"Aber nein, so war das doch gar nicht gemeint", rief Jennifer betroffen.
Norman senkte den Blick.
"Es tut mir leid, das hätte ich nicht sagen sollen. Ich habe mich vergessen. Entschuldigen Sie bitte. Es wird nicht wieder vorkommen. Vielleicht ist es besser, wenn ich jetzt wirklich gehe."
"Nein, bitte bleiben Sie noch. Ich bin es, die sich entschuldigen muss. Das war nicht nett, was ich gesagt habe, aber ich habe es auch nicht böse gemeint. Ich freue mich wirklich, dass Sie mich besucht haben."
"Ehrlich?" Hoffnung blitzte in seinem Blick auf.
"Ganz ehrlich. Aber ich bin so durcheinander, dass ich selbst nicht weiß, wo mir der Kopf steht."
"Das kann ich mir gut vorstellen. So ein Krankenhaus ist auch nicht gerade der ideale Ort, um eine Bekanntschaft zu knüpfen. Wissen Sie schon, wie lange Sie noch hierbleiben müssen?"
"Nein, der Arzt hat mir bislang nichts gesagt, aber ich hoffe, dass es nur noch ein paar Tage sind. Morgen kommt der größte Teil der Verbände ab. Dann brauche ich wenigstens nicht mehr dieses Mumienkostüm zu tragen."
"Sobald Sie hier heraus sind, können wir vielleicht zusammen etwas unternehmen. Was halten Sie davon, wenn wir gemeinsam essen gehen?"
"Einverstanden." Jennifer lächelte ihn freudig an. Sie konnte sich vorstellen, dass es ihm bei seiner Schüchternheit schwergefallen war, diese Einladung auszusprechen. Umso erleichterter wirkte er, dass sie sofort darauf eingegangen war.
Aber auch Jennifer freute sich. Alles war mit einem Mal ganz anders, und sie brauchte jede Hand, die sich ihr hilfreich entgegenstreckte, aber das war nicht der einzige Grund, weshalb sie die Einladung annahm. Sie wusste noch nicht richtig, was sie von Norman halten sollte, dafür kannten sie sich zu wenig. Trotzdem war die Einladung nach all den schlimmen Vorfällen und den letzten Stunden der Trostlosigkeit so etwas wie ein Lichtblick. Hätte ihr vor ein paar Tagen - vor ein paar Tagen und einer Woche, wie sie sich in Gedanken gleich darauf verbesserte - jemand gesagt, dass ausgerechnet eine Verabredung mit dem scheuen, unauffälligen Norman Randall ihr neuen Mut und neue Lebensfreude spenden würde, hätte sie wahrscheinlich nur darüber gelacht.
Aber jetzt war alles plötzlich ganz anders, auch wenn sie sich diese Veränderung und die Schnelligkeit, mit der alles geschehen war, noch nicht erklären konnte. Wichtig war nur, dass sie wieder ein wenig hoffnungsvoller in die Zukunft blickte.
5

|

|


Robert holte sie mit dem Wagen ab, als sie drei Tage später aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Als die Verbände abgenommen worden waren, hatte sich Jennifer im ersten Moment erschrocken, war dann aber erleichtert gewesen. Das Feuer hatte Spuren hinterlassen, natürlich, aber sie waren weit weniger schlimm, als sie trotz aller Versprechungen insgeheim die ganze Zeit über befürchtet hatte.
Von ihren Locken war nicht viel übriggeblieben, aber sie würden nachwachsen. Die Kopfhaut war nicht schlimm verletzt. Immerhin war noch genügend Haar vorhanden, um es modisch kurz schneiden zu lassen. Die Haut ihres Gesichtes war von Blasen übersät und schälte sich, aber sie war nicht viel schlimmer verbrannt, als bei einem heftigen Sonnenbrand und begann bereits zu verheilen.
Nachdem sie sich lange im Spiegel gemustert hatte, wusste Jennifer, dass in einiger Zeit wirklich nichts mehr davon zu sehen sein würde. Es waren keine Hautpartien zerstört, so dass weder Transplantationen noch andere Operationen nötig gewesen waren. Es grenzte an ein Wunder. Sie musste wirklich einen besonders aufmerksamen und wohlmeinenden Schutzengel haben.
Ihre Eltern besaßen nicht nur das altherrschaftliche Haus am Stadtrand, sondern auch noch eine alte Villa namens Cravenstone, die dem Stadtzentrum näher lag. Es war das Haus, in dem Jennifer aufgewachsen war, bevor ihr Vater sich vor rund zehn Jahren zu einem Umzug entschlossen hatte. Obwohl sich in den letzten Jahren kaum jemand dort längere Zeit aufgehalten hatte, hatte ihr Vater sich nie entschließen können, Cravenstone zu vermieten oder zu verkaufen, zumal er auf das Geld nicht angewiesen war.
Manchmal, wenn Jennifer allein sein wollte, war sie für eine Weile in die Villa gezogen. Nun würde sie zusammen mit Robert dort wohnen. Ihr Bruder hatte bereits direkt nach seiner Ankunft in London dort Quartier bezogen. Das Haus war selbst für sie beide noch fast zu groß. Es handelte sich um eine im viktorianischen Zeitalter erbaute Villa mit mehreren Flügeln und mehr als dreißig Zimmern, die aufgrund ihrer vielen vorspringenden Erker, Balkonen und kleinen Türmchen fast wie ein Schloss aussah.
Auch als sie jetzt dort eintrafen, fühlte sich Jennifer von der Größe des Bauwerkes beeindruckt. Cravenstone lag an einer wenig befahrenen Straße und war von einer mehr als mannshohen Hecke umgeben. Robert lenkte den Wagen durch ein großes, schmiedeeisernes Portal. Ein weißer Kiesweg führte durch einen parkähnlichen Garten auf das Haus zu.
Seit Jennifer das letzte Mal hier gewesen war, hatte sich einiges verändert. Der Garten war gepflegt, selbst der lange stillgelegte Springbrunnen inmitten eines romantischen Teiches sprudelte wieder.
"Ich habe alles herrichten lassen", erklärte Robert. "Der Park befand sich nicht mehr in bestem Zustand. Ein halbes Dutzend Gärtner hat fast eine ganze Woche daran gearbeitet."