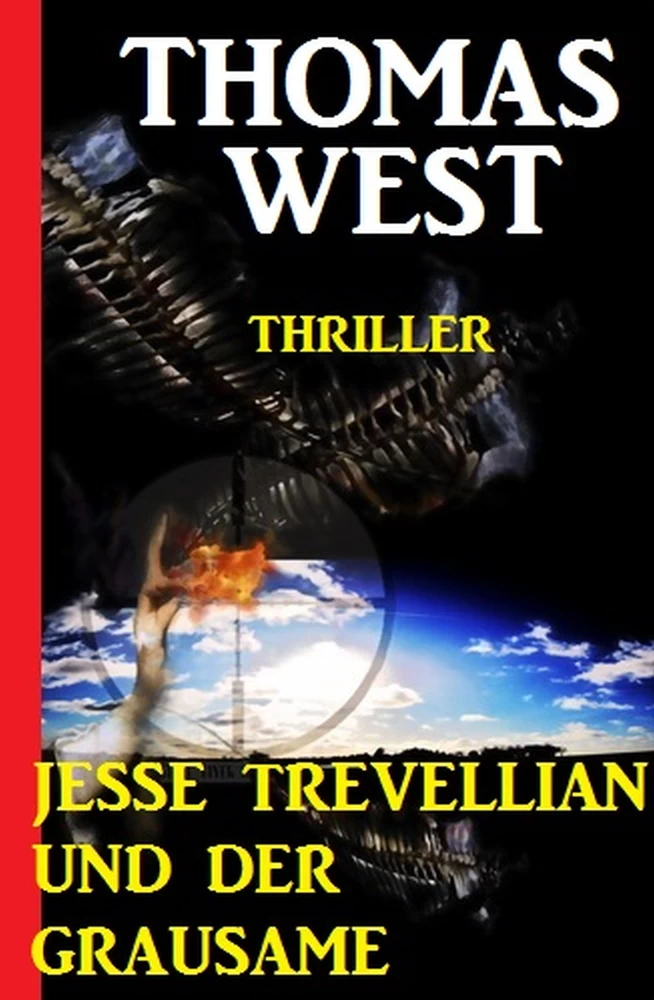Zusammenfassung
Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 119 Taschenbuchseiten.
Der bekannte Filmstar Laramie Stone bittet den FBI-Agenten Jesse Trevellian um Hilfe - um ein Haar wäre er Opfer eines Mordanschlags geworden und in einer perfiden Nagelfalle regelrecht krepiert. Kurz darauf wird der G-Man zum Mord an Eric Johnson, einem New Yorker Richter, gerufen, der auf ähnlich brutale Weise starb, als er in eine Grube mit Eisenspießen fiel. Der Special-Agent glaubt an einen Zusammenhang, zumindest weist die grausame Art der Tötung, nach Vietcong-Manier, darauf hin. Ein neun Jahre zurückliegender Vergewaltigungsfall scheint der gemeinsame Nenner zu sein. Damals wurden die Angeklagten freigesprochen – und zwar von Richter Johnson. Möglicherweise befindet sich jemand auf einem Rachefeldzug ...
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Jesse Trevellian und der Grausame: Thriller
Published by BEKKERpublishing, 2018.
Copyright Page
This is a work of fiction. Similarities to real people, places, or events are entirely coincidental.
JESSE TREVELLIAN UND DER GRAUSAME: THRILLER
First edition. April 14, 2018.
Copyright © 2018 Thomas West.
ISBN: 978-1386871064
Written by Thomas West.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Jesse Trevellian und der Grausame

|

|


Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 119 Taschenbuchseiten.
Der bekannte Filmstar Laramie Stone bittet den FBI-Agenten Jesse Trevellian um Hilfe - um ein Haar wäre er Opfer eines Mordanschlags geworden und in einer perfiden Nagelfalle regelrecht krepiert. Kurz darauf wird der G-Man zum Mord an Eric Johnson, einem New Yorker Richter, gerufen, der auf ähnlich brutale Weise starb, als er in eine Grube mit Eisenspießen fiel. Der Special-Agent glaubt an einen Zusammenhang, zumindest weist die grausame Art der Tötung, nach Vietcong-Manier, darauf hin. Ein neun Jahre zurückliegender Vergewaltigungsfall scheint der gemeinsame Nenner zu sein. Damals wurden die Angeklagten freigesprochen – und zwar von Richter Johnson. Möglicherweise befindet sich jemand auf einem Rachefeldzug ...
Copyright

|

|


Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker.
© by Author
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
1

|

|


Dunst im Unterholz, Dunst im Blätterdach des Urwaldes, Dunst im Uniformstoff, Dunst in Mund, Nase und Lungen - warmer feuchter Dunst. Das Atmen fiel schwer, das Stirntuch war klatschnass, der Schweiß kitzelte zwischen den Bartstoppeln.
Hinter sich hörte O’Brian seine Männer keuchen, Äste brachen unter ihren Stiefeln, Laub raschelte, wenn sich die Zweige des dichten Gestrüpps zur Seite bogen - gottverdammtes grünes, feuchtes Gestrüpp! Vor sich die Spitze des Stoßtrupps - drei Corporals. Schwarz vor Nässe, die Rücken ihrer Kampfanzüge unter den Gewehrkolben. Sie fluchten und hieben mit Macheten auf das mannshohe Gestrüpp ein. Gottverdammter grüner, feuchter Dschungel ...! Gottverdammte Todesfälle! Der Sergeant wusste genau, was geschehen würde.
»Leiser!«, zischte er. »Ihr macht einen höllischen Lärm! Der Vietcong pflückt schon den Begrüßungsstrauß ...!«
Er sagte immer denselben Satz - den Satz, den er auch damals gesagt hatte. Als wäre er gezwungen, sich an ein teuflisches Drehbuch zu halten. Er wollte schreien, weil er wusste, was der Teufel als Nächstes ins Drehbuch geschrieben hatte, er wollte wenigstens zwei der jungen Corporals an ihren Gewehren packen und zurückreißen. Er tat nichts davon, ging sogar weiter, schabte sich sogar die von Mückenstichen entzündete Brusthaut, spuckte aus und blickte sich um, als hätte er unendlich viel Zeit. Nicht einmal den Atem konnte er anhalten.
Es geschah langsam, nicht blitzschnell, wie damals, beim ersten Mal, als es tatsächlich geschehen war. Ganz langsam, wie in Zeitlupe. Zuerst das mörderische Krachen, Rascheln und Rauschen, dann bogen sich junge Bäume und Büsche, irgendjemand schrie, und schließlich schwebte ein Baumstamm aus dem Gestrüpp des gottverdammten Dschungels. Langsam, quälend langsam strich er drei oder vier Fuß über dem Unterholz knapp an dem Sergeant vorbei. An seiner Spitze eine hölzerne, senkrecht stehende Platte, armlange Holzdornen ragten aus ihr. Wie ein gigantischer Fliegentöter wischte der Stamm durch Büsche und Sträucher, fegte die drei Corporals gegen den Stamm eines Urwaldriesen. Blut spritzte, Schreie gellten durch den Dschungel, Glieder zappelten zwischen Holzplatte und Baumstamm.
Der Sergeant starrte die Aufgespießten an. Er musste sie anstarren - auch das hatte die Hölle ins Drehbuch geschrieben. Von einem seiner blutjungen Corporals sah er nur Kopf und Arme. Sie hingen, schlaff über die Kante der Stachelplatte. Keinen Mucks gab der Junge mehr von sich.
Sein Kamerad neben ihm würgte, röchelte, ruderte mit den Armen wie ein Ertrinkender und wand seinen Oberkörper hin und her. Die grausame Falle hatte seine untere Körperhälfte gegen den Stamm genagelt. Der dritte Corporal klemmte mit der linken Schulter und dem linken Arm unter der Riesenfliegenklatsche. Fr brüllte - oh Gott, wie er brüllte ...
Auch was dann folgte, kannte O’Brian: Die Panik, die Geräusche, der Schmerz hinter dem Brustbein, der Schrei - alles Hunderte Male erlebt. Er konnte nicht gegen das Höllendrehbuch handeln, alles musste er wiederholen, noch einmal empfinden, noch einmal erleben, bis in jede Einzelheit, wieder und wieder.
Beine und Hüften schienen sich mit heißem Blei zu füllen, klebriger, kalter Schweiß strömte ihm übers Gesicht, er rang nach Luft, aber der feuchtwarme Dunst staute sich in seinem aufgerissenen Mund, etwas schwoll in seinem Brustkorb, wurde größer und heißer, platzte schließlich, und endlich löste sich der Schrei aus der Kehle des Sergeants ...
Er fuhr hoch und schrie. Er presste sich die Bettdecke gegen das nasse Gesicht und schrie. Er schrie noch, als endlich das Licht anging und er das Kruzifix über dem Fußende seines Bettes sah.
Endlich fand er in die sogenannte Wirklichkeit zurück. Er war nicht im Dschungel - er war in seiner Wohnung in SoHo. Er war nicht im Jahre 1969 - er war im Jahre 2008. Wieder hatte ihn ein Traum neununddreißig Jahre in die Vergangenheit geworfen, zurück in den Dschungel Nordvietnams. Es war, als würde ein Teil seiner Seele noch immer zwischen Urwaldriesen und undurchdringlichem Gestrüpp zappeln ...
Die Tür seines Zimmers stand offen. Eine rotblonde Frau im Türrahmen. Zierlich und blass. Sie hatte das Licht angemacht. »Dad«, flüsterte sie, »Dad - Was ist los?«
Es war Suzy, die Tochter der Sergeants. Sie eilte ans Bett, hockte sich an die Bettkante, legte ihren Arm um seine Schultern. »Um Himmels willen, Dad ...«
Er hörte auf zu schreien. Seine Schultern hoben und senkten sich im Rhythmus seines keuchenden Atems.
»Hast du wieder vom Krieg geträumt?«
»Blödsinn!« Er stieß ihren Arm weg, schlug die Bettdecke beiseite und schob seinen dürren, ausgemergelten Körper von der Matratze. »Was für ’n Krieg überhaupt?«
Angriffslustig musterte Sergeant William O’Brian seine Tochter. Scheinbar beiläufig griff seine Rechte nach der Decke und schlug sie über das alte Schnellfeuergewehr. Als wollte er es vor den Augen seiner Tochter verbergen. Dabei ging er schon seit Jahren nicht mehr ohne das Gewehr ins Bett. Und ohne Uniformhose auch nicht. Seit die Katastrophe über seine kleine Familie hereingebrochen war.
»Hab geträumt, dass unsere Jungs von den Metro Stars schon wieder gegen Los Angeles Galaxy verloren haben ...« Seine Gelenke knackten, als er sich aufrichtete und seinen knochigen Körper streckte. »Ein verdammter Albtraum war das, so wahr ich O’Brian heiße. Drei zu null verloren, ein verdammter Albtraum - wenn das kein Grund zum Schreien ist ...«
Ein Blick auf den monströsen Messingwecker auf seinem Nachttisch. Kurz nach Mitternacht. »Wann gibt's Mittagessen?« Er warf sich auf den Boden und begann mit den Liegestützen. Drei Mal täglich dreißig Stück. O’Brians Pensum, solange Suzy zurückdenken konnte. Dazu diverse Bauchmuskelübungen und alle zwei Tage eine Stunde Joggen durch den Central Park. William O’Brian war 69 Jahre alt - aber er war fit wie ein Vierzigjähriger. Sein Körper jedenfalls war so fit.
Mit bekümmerter Miene beobachtete Suzy O’Brian den ausgemergelten Körper ihres Vaters. Die Hüftknochen standen spitz über der heruntergerutschten Uniformhose, Rippen und Schlüsselbein zeichneten sich überdeutlich unter der faltigen Haut ab. Er war nicht groß, ihr Dad, vielleicht einen Kopf größer als sie selbst. Graues Stoppelhaar bedeckte seinen kantigen Schädel.
»Es ist noch nicht Zeit zum Mittagessen«, seufzte sie. »Und für deine Morgengymnastik auch noch nicht. Es ist mitten in der Nacht.«
»Erzähl mir nichts«, keuchte er. »Wenn es mitten in der Nacht wäre, würdest du längst im Bett liegen.«
Suzy stand auf. Wortlos verließ sie das Schlafzimmer ihres Vaters. Sie hatte es längst aufgegeben, ihm zu widersprechen.
William O’Brian erhob sich halb, blieb auf den Knien hocken und blickte seiner Tochter nach. Dann sprang er leichtfüßig auf. Mt den Fingerbeeren berührte er das Kruzifix an der Wand über seinem Bett, küsste die Fingerspitzen und berührte das Kreuz ein zweites Mal. Er murmelte ein Ave Maria, während er sein Zimmer verließ.
O’Brian war gläubiger Katholik. Wie schon sein Vater und sein Großvater und dessen Vater und Großvater. Weder der Krieg noch die Katastrophe vor neun Jahren hatten ihm seinen Glauben zerstören können. Nicht einmal das heillose Chaos in seinem Kopf hatte das geschafft.
Im Wohnzimmer an der schweren Eichenkommode stand seine Tochter und telefonierte. »Ich muss jetzt Schluss machen ... Ich weiß nicht ...Vielleicht ... Ich muss Schluss machen – bye ...« Sie legte auf.
Zu hastig, um ein gutes Gewissen zu haben, fand der Sergeant - er hatte seinen Abschied von der Army als Major genommen, aber in seinem Selbstverständnis war er immer Sergeant geblieben. Der Sergeant, der Elitekämpfer durch den Dschungel von Vietnam geführt hatte, um Stützpunkte des Vietcong auszuheben.
»Mit wem hast du telefoniert, Suzy?« Sein eingefallenes Gesicht legte sich in zahllose Falten. Misstrauisch beäugte er die zierliche Gestalt seiner Tochter. Sie trug einen langen, grauen Rock aus Baumwolle und ein weites blaues Hemd darüber. Nichts, was ihre weiblichen Formen betonte, nichts, was zueinanderpasste, nichts, was auch nur ansatzweise hübsch gewesen wäre.
Nur ihr schmales, blasses Gesicht war hübsch, gerahmt von ihren dichten rotblonden Locken und beherrscht von großen, dunkelblauen Augen. Auffallend ernste Augen übrigens. Nicht nur hübsch war das Gesicht von Suzy O’Brian - schön war es, wenn man genau hinsah. Aber Suzy kleidete und gab sich auf eine Weise, die Männer in der Regel davon abhielt, genauer hinzusehen. Schon lange, schon seit neun Jahren.
»Mit wem hast du telefoniert?«, drängte O’Brian.
»Mit einer Freundin.« Sie wich seinem Blick aus, ging zu dem großen, runden Eichentisch in der Mitte des Raumes und griff nach einer Pillenschachtel und einem Glas Wasser. »Nimm eine Tablette, vielleicht kannst du dann weiterschlafen.« Sie reichte ihm das Wasserglas und zog ein Briefchen mit Dragees aus der Packung.
»Mit wem telefonierst du nach Mitternacht noch?« O’Brian sprach jetzt mit scharfer Stimme. Die Stimme eines Sergeants.
»Ich bin siebenundzwanzig Jahre alt, Dad.« Suzys Gestalt straffte sich. Trotzig blickte sie ihm in die wässrigen Augen. »Ich telefoniere mit wem ich will und wann ich will.«
Sie drückte ihm die Pille in die knochige Hand und verließ das Wohnzimmer. Er lauschte ihren Schritten auf der Treppe, er hörte, wie sie ihre Zimmertür abschloss. Sie schloss immer ab. Auch das Fenster.
Mit einem halben Glas Wasser spülte er die Pille hinunter. Eine von siebzehn, die er im Laufe eines lieben, langen Tages zu schlucken hatte. Er knallte das Glas auf den Tisch und ging zu der schweren Kommode, auf der das Telefon stand.
Von einem schwarz gerahmten Foto lächelte ihm eine Frau entgegen - breites Gesicht, warme Augen, heitere Züge, rotblond. O’Brians Frau und Suzys Mutter. Sie hatte die Katastrophe damals genau zwei Jahre überlebt.
»Wir sollten wissen, mit wem sie nach Mitternacht noch telefonieren muss«, murmelte O’Brian. »Das sollten wir wissen, Kathy, oder?«
Er griff nach dem Hörer und drückte die Wahlwiederholungstaste. Eine Männerstimme meldete sich, eine junge Männerstimme. »Chester Bronson - Hallo?«
O’Brian riss den Hörer vom Ohr und starrte ihn an, als hätte sich der Leibhaftige persönlich gemeldet. Dann knallte er den Hörer auf.
»Du hast diese Bestie angerufen ...!« Brüllend stürzte er aus dem Zimmer und die Treppe hinauf. »Hast du keinen Funken Würde mehr im Leib?!«
Suzy schloss ihre Tür auf und öffnete. Erschrocken sah sie ihrem Dad entgegen. Der packte sie an den Schultern und schüttelte sie.
»Warum rufst du ihn an? Warum? Warum?«
Sie machte sich los und sprang die Treppe hinunter, um den Arzt anzurufen. O’Brian schlidderte über mehrere Stufen auf einmal hinter ihr her.
»Schäm dich, du Schlampe! Hast du die anderen Bestien auch angerufen, Schlampe, schamlose Schlampe ...!«
2

|

|


Es war ein wunderschöner Abend wie aus dem Bilderbuch: Die Manhatties schlenderten einen Gang langsamer über die Bürgersteige als sonst, so wollte mir scheinen. Das Abendlicht hing flirrend über dem Asphalt und in den Baumwipfeln des Washington Square Parks. Gelächter an den Tischen der Straßencafés, Kids mit Inlinern und Kickboards flitzten über die Straßen. Die Luft war mild, und Schwalben kreisten hoch über dem Park.
Ich glaube, es war ein Dienstag, vielleicht auch ein Mittwoch. Ich hatte mich später als geplant aus der Federal Plaza losgeeist. So ganz gelassen war ich nicht, als ich den Parkplatz der New York University verließ und den Washington Square East überquerte. Um halb sieben war ich mit Linda verabredet gewesen, inzwischen war es Viertel nach acht.
»Blue Prince« hieß das Bistro, in dem wir uns treffen wollten. »Blue Prince« - der Ort unseres ersten Rendezvous. Die Straßentische waren alle besetzt. Klar - ein Abend wie ein letzter Gruß des Sommers vor raueren Tagen, wer wollte sich da in einen muffigen Schankraum verkriechen? Zum Wochenende hatte der Wetterbericht eine Tiefdruckzone und einen Temperatursturz angekündigt.
Meine Augen suchten die Tische ab. Nach einer Frau, die allein saß. Nach einer blonden Löwenmähne und einem schmalen, fein geschnittenen Gesicht. Nach Linda. Fehlanzeige.
Vor der ersten Tischreihe blieb ich stehen. Wieder wanderten meine Augen von Tisch zu Tisch. Und dann sah ich sie. Linda saß nicht allein am Tisch. Der Typ ihr gegenüber war groß und breitschultrig und trug einen hellen Anzug. Ein Afroamerikaner. Eine Flasche Bier und ein leeres Glas stand vor ihm. Linda nippte an einem Glas Rotwein. Meine Stimmung sank blitzartig gegen null.
Okay - ich hatte mich ein wenig verspätet, wie gesagt. Um eine Stunde oder zwei. Kein Grund, sich gleich einen anderen Kerl an den Tisch zu holen. Oder?
Ich drängte mich durch die dicht stehenden Tische und ließ mich auf dem Stuhl neben Linda nieder. »Hi, Baby! Schön, dass du gewartet hast. Unsere Kundschaft ist so verdammt anhänglich, ich konnte nicht früher kommen. Echt nicht.« Ich gab ihr einen Kuss auf die Wange. Dem schwarzen Adonis fielen fast die Augen aus dem Kopf.
Ich nickte ihm zu und gab mir Mühe, dabei ein freundliches Gesicht zu machen. »Nett, dass Sie meiner Freundin ein bisschen Gesellschaft geleistet haben, Sir.« Ratlos wanderten seine Augen zwischen Linda und mir hin und her. »Linda kommt jetzt ohne Sie zurecht, wollte ich damit sagen. Einen schönen Abend noch.«
Seine breite Gestalt straffte sich, er stützte seine großen, schwarzen Hände auf die Tischplatte, als wollte er sich zum Sprung über den Tisch abstoßen.
»Das ist Ben Goodwell, Jesse«, sagte Linda im nächsten Moment. Sie sprach den Namen sehr betont aus. Als müsste er mir was sagen. Und tatsächlich war mir, als hätte ich den Namen schon irgendwo gehört.
»Und das ist Jesse Trevellian.« Sie lächelte den schwarzen Hünen an. »Der Gentleman, den ich hier treffen wollte.« Sie blickte auf die Uhr. »Oh! Gleich halb neun! Zwei Stunden sitzen wir schon hier zusammen!« Ein zynischer Blick ihrer bernsteinfarbenen Augen traf mich. »Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit verging!« Ihn dagegen lächelte sie ausgesucht verführerisch an. »Habe lange nicht mehr so angenehm geplaudert.« Sie griff über den Tisch und legte ihre Hand auf seine. »Danke, Ben.«
Mein Verdruss schlug in Wut um. Ich spürte plötzlich das dringende Bedürfnis, den Tisch umzuwerfen. Oder wenigstens Lindas Rotwein in das breite Gesicht des Adonis zu gießen. Stattdessen betrachtete ich Lindas Hand auf seiner und ihren nackten Arm. Ich starrte darauf und kämpfte die Wut nieder.
»Übrigens, Jesse - Ben ist Basketball-Profi. Du hast sicher von ihm gehört.«
Ich blitzte ihn an. Natürlich hatte ich - jetzt fiel es mir wieder ein. In der vergangenen Saison hatte er bei den Chicago Bulls gespielt.Vielleicht wechselte er jetzt zu den New York Knights.
Sein schwarzes Gesicht war in den letzten Wochen öfter in den Zeitungen und im Fernsehen zu sehen gewesen. Irgendein Skandal, ein Prozess oder was - ich hatte vergessen, worum genau es ging. Nur dass er ein Schweinegeld verdiente und einen die Nation empörenden Frauenverschleiß hatte, das wusste ich noch. Und mehr wollte ich nicht wissen.
»Wir sind eigentlich schon gar nicht mehr hier«, fuhr Linda in ihrer unnachahmlichen Gelassenheit fort. Nur wer sie näher kannte, hörte den spöttischen Unterton heraus. Ich kannte sie näher, weiß Gott, das tat ich. »Ben erzählte von einem Jazzkeller in Harlem. Da wollen wir hingehen. Jetzt, wo du doch noch gekommen bist, können wir uns ja zu dritt auf den Weg machen.«
Sie wandte sich an Mr. Schwerathlet. Der kannte Linda noch nicht näher. Und ahnte nicht, dass sie am gefährlichsten war, wenn ihre Stimme milde und ihre Bernsteinaugen sanft wirkten. »Du hast doch nichts dagegen, wenn Jesse mitgeht, oder, Ben?«
Jedes Wort ein Peitschenhieb. Ich kochte, riss mich aber zusammen.
»Wie könnte ich?« Der Sportsmann sprach mit dumpfem Bass. »Nur bin ich nicht ganz sicher, ob der Gentleman Wert auf meine Gegenwart legt.«
»Hören Sie zu, Goodwell«, sagte ich leise. »Linda und ich kennen uns seit knapp zwei Monaten. Sie steht auf mich, ich steh auf sie. Wir haben nur ein kleines Problem: unsere Jobs.«
»Dein Job«, warf Linda ein.
»Ich hab wenig Zeit, und sie wohnt praktisch in ihrer Redaktion.«
»Was man nicht alles über sich erfahren kann ...« Linda lächelte spöttisch.
»Folge: Es kommt hin und wieder zu kleinen Verstimmungen.« Ich stellte Lindas Weinglas beiseite und beugte mich über den Tisch. »Und Sie, Goodwell, haben das Glück, eine solche mitzuerleben leben. Oder das Pech, denn was hier im Augenblick abgeht, ist doch klar: Linda benutzt Sie, um mir eins auszuwischen. Das merkt doch ein Idiot! Sie sind die Knute in ihrer Hand!«
Unwillige Falten erschienen auf seinem Gesicht.
»Nun gucken Sie nicht so einfältig! Wollen Sie mir vielleicht erzählen, Linda ist die erste Frau, die Sie aus der Nähe erleben?« Ich verdrehte die Augen. »Sie kennen doch Frauen! Sie haben doch sicher das eine oder andere Wort geredet mit den Frauen, die sie gevögelt haben!«
Abrupt stand Linda auf. Zorn loderte in ihren Bernsteinaugen. Und trotzdem lächelte sie. Ein Lächeln wie eine Ohrfeige. »Ich habe es mir überlegt«, sagte sie. »Zu dritt könnte der Abend problematisch werden. Ich hatte genug Probleme in der Redaktion heute. Ben war zuerst da, Ben hat Zeit - also fahre ich heute Abend mit Ben nach Harlem.« Sie blickte auf mich herab. »Einen schönen Abend noch, Jesse. Wir hören voneinander. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten.« Sie zog ihre Lederjacke von der Stuhllehne. »Es sei denn, du machst den gleichen Fahler ein zweites Mal und wirst auch im nächsten Leben Polizist.« Sie rauschte davon.
Goodwell schnellte vom Stuhl hoch. Die Sache hatte sich flotter entwickelt, als er denken konnte. »Mein Spiel, Trevellian. Nichts für ungut.« Er hatte Mühe, ihr zu folgen.
»Bullshit!«, knurrte ich. Ich verliere nicht gern. Und so ganz uneitel bin ich auch nicht. »Bullshit! Bullshit! Bullshit ...!« Gläser und Flasche auf dem Tisch klirrten, als ich die Tischplatte mit der Faust bearbeitete. Ich kann mich nicht erinnern, von einer Frau schon mal dermaßen aufs Kreuz gelegt worden zu sein.
Ein Kellner tauchte neben mir auf. Und präsentierte mir die Rechnung für Lindas Rotwein und Goodwells Bier. Zwei Flaschen hatte er geleert.
Ich bezahlte Lindas Rotwein. »Die Rechnung für die Zeche des Gentleman schicken Sie an die Chicago Bulls.« Er machte ein begriffsstutziges Gesicht. »Das ist ein Basketball-Club, Mann, spielt in der National-Liga. Und jetzt bringen Sie mir einen doppelten Bourbon!«
Ich muss ein ziemlich unfreundliches Gesicht gemacht haben, denn der Kellner wich einen Schritt zurück.
Später nippte ich an meinem Whisky und dachte nach. Ich war selbst schuld - natürlich. Man lässt eine Frau nicht fast zwei Stunden lang warten. Eine Frau wie Linda schon gar nicht. Du solltest dich schämen, Jesse, dachte ich mir, und ich schämte mich. Jedenfalls ein bisschen.
Vor zwei Monaten hatten wir uns kennengelernt. Eigentlich war nur eines klar zwischen uns: Dass sie mich liebte, und dass ich sie liebte. Ansonsten nur Chaos, ein einziges Hin und Her.
Sie war Chefredakteurin eines Frauenblattes mit dem bezeichnenden Titel »Female«, ein Magazin voller Sex, Kult und Mode. Weiblich eben von der ersten bis zur letzten Seite. Weiblich wie Linda.
Lindas Vater war Polizist gewesen wie ich. FBI-Agent unten in Miami. Als sie sechzehn war, wurde er im Dienst erschossen. Ironie des Schicksals.
Sie sagte nie, dass sie Angst um mich hätte, so wie sie um ihren Vater Angst gehabt hatte. Umso häufiger beklagte sie sich über meinen chronischen Zeitmangel. »Warum muss ich mich in einen Bullen verlieben!«, schimpfte sie bei solchen Gelegenheiten. »Genau wie mein Vater bist du mit deinem Job verheiratet!«
In den zwei Monaten hatten wir uns drei- oder viermal getrennt - jedem von uns war klar, dass wir nicht miteinander leben können. Und drei- oder viermal hatten wir wieder neu angefangen - ohne einander zu leben war fast noch schwerer.
Die letzte Versöhnung lag erst eine Woche zurück. Nach dem Kampf gegen die Terrororganisation »Domäne« hatten Linda und ich ein verlängertes Wochenende in Florida verbracht. Ein atemberaubend schöner Honeymoon. »Wo ist das Problem?«, hatten wir uns danach gefragt. Wir sahen keines. Aber nun war wieder Alltag angesagt. Und die lieben Problemchen waren wieder da.
Herzlichen Glückwunsch, dachte ich und kippte meinen Whisky hinunter.
Ich zahlte und ergriff die Flucht. Auf dem Parkplatz neben der Universität vibrierte das Handy in meiner Jackentasche »Trevellian!«, meldete ich mich..
»Laramie Stone.« Ich hörte eine sonore Männerstimme. »Wir hatten noch nie das Vergnügen miteinander, Mister Trevellian.« Schon wieder ein Name, der mir bekannt vorkam. »Ich brauche Ihre Hilfe.«
»Worum geht es, Mister Stone?« Ein Gesicht tauchte auf meiner inneren Bühne auf. Ein schwarzes Gesicht - schon wieder.
»Ich glaube, jemand will mich töten«, sagte die Männerstimme, und sie klang sehr ernst.
»Dann wenden Sie sich an die Polizei. Oder sind Sie zufällig Beamter?«
»Leider nicht - dann wären Sie zuständig, nicht wahr? Wenn ich die Cops rufe, steht morgen in allen Zeitungen, dass Laramie Stone Angst um sein Leben hat - so eine Publicity wäre das Letzte, was ich brauchen kann ...«
Plötzlich wusste ich, mit wem ich telefonierte. Das schwarze Gesicht auf meiner inneren Bühne war das Gesicht eines Filmstars. Laramie Stone - natürlich! Der Mann aus Harlem hatte im letzten Jahr zwei Kinohits gelandet. Im letzten spielte er einen äußerlich knallharten Cop, der weder Tod noch Teufel fürchtete, doch innerlich butterweich war.
»Bitte lachen Sie nicht, Mister Trevellian, wenn ich Ihnen gestehe, dass Sie mein großes Vorbild sind. Als kleiner Junge wollte ich immer Polizist werden. Jetzt spiele ich den Bullen auf der Leinwand. Ich hab alle Filmarchive der Nachrichtensender durchforsten lassen, um Aufnahmen zu finden, auf denen Sie zu sehen sind. Und alle Zeitungsartikel der letzten sechs Jahre hab ich gesammelt, in denen Sie erwähnt werden. Ich habe meine letzte Rolle nach Ihrem Vorbild gestaltet, Mister Trevellian, ob Sie es glauben oder nicht.«
Ich bin ganz ehrlich: Nach dem Tiefschlag mit Linda, den ich gerade zu verdauen hätte, ging mir das runter wie alter Cognac. »Wie kommen Sie darauf, dass man Sie töten will, Mister Stone?«
»Eine Falle«, sagte die Männerstimme. »Man hat eine Falle im Garten meiner Villa gebaut. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Aber Rainbow hat’s erwischt.«
»Rainbow?«
»Mein Hund. Kommen Sie, und schauen Sie sich die Schweinerei an. Ich bitte Sie, Mister Trevellian, kommen Sie!«
3

|

|


Joggen, Enkel zum Kindergarten bringen, Speise und Putzplan mit dem Hausmädchen besprechen, Bridge Runde und am späten Nachmittag Treffen der Amnesty-International-Gruppe von Queens - ein voll gestopfter Tag für Emely Johnson.
Ein Tag wie Tausende zuvor, ein Tag wie unzählige, die diesem noch folgen würden. Jedenfalls verschwendete Emely an jenem Abend keinen Gedanken an die Möglichkeit, einen solchen Tag vielleicht nie wieder zu erleben.
Dabei war es nur Zufall, dass sie am nächsten Morgen, als das Telefon klingelte, noch lebte und die schreckliche Nachricht entgegennehmen konnte. Reiner Zufall, weiter nichts.
Der Zufall spielte in diesem Fall folgendes Spiel: Emely und Eric, ihr Mann, packten einen gemeinsamen Koffer in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer. Die Abendsonne warf ihr freundliches Licht durch die offene Balkontür auf den Koffer und auf die blaue Tagesdecke des Bettes.
Eric hatte seit Langem einen Kurzurlaub geplant. Mittwochabend bis Sonntagabend in ihrem Wochenendhaus auf Coney Island. Er war ganz heiß darauf. »Die letzten schönen Tage des Jahres!«, rief er begeistert. »Was für ein Glück wir haben! Vier Tage lang keine hinterfotzigen Anwälte, vier Tage lang keine schmutzige Wäsche aus gescheiterten Ehen, vier Tage lang keine schmierigen Kriminellen!« Er ballte die Fäuste und schüttelte sie über dem Kopf. Eric war Richter am New York County Courthouse in Manhattan.
Während Emely zwei Drittel des Koffers mit ihrer Garderobe füllte auch in Coney Island musste man mit Einladungen irgendwelcher Nachbarn rechnen, und sie liebte es zu repräsentieren - überprüfte Eric sein Angelzeug. Er besaß eine kleine Yacht; sie lag im Yachthafen von Coney Island. Erst, wenn er ein paar Meilen weit in den Atlantik hinausfuhr und seine Angel auswarf, konnte er das New York County Courthouse wirklich vergessen.
Eric war ein großer, beleibter Mann mit einem schütteren, grauen Haarkranz auf dem mächtigen Schädel. Einen Monat zuvor hatte er seinen fünfundfünfzigsten Geburtstag gefeiert.
Emely - acht Jahre jünger als ihr Mann - stand vor dem Spiegel und hielt sich ein langes Abendkleid und einen roten Hosenanzug vor den Körper, als das Telefon klingelte. »Vielleicht sind die McMillans auch übers Wochenende auf Coney Island.«
Geoffrey McMillan war Chefankläger im New York County Courthouse. Sein Wochenendhaus stand nur ein paar Hundert Yard von dem der Johnsons entfernt. Das Telefon klingelte immer noch.
»Sie werden sicher wieder eine Sektparty veranstalten. Was meinst du, Eric - nehme ich das Kleid mit oder den Hosenanzug?« Das Telefon auf dem Nachttisch klingelte und klingelte. Es war natürlich der Zufall, aber das ahnten weder Eric noch Emely.
»Pack beides ein«, brummte Eric. Emely würde es sowieso tun. Die beiden waren dreiundzwanzig Jahre verheiratet, und Eric glaubte seine Frau inzwischen ein wenig zu kennen. »Und geh endlich ans Telefon.«
Emely legte Kleid und Hosenanzug auf den offenen Koffer, tänzelte zum Nachttisch und nahm den Hörer ab. »Johnson ...! Ach du bist’s, Darling ... Warum klingt deine Stimme so merkwürdig ...? Was ist los, Darling?«
Der mütterlich besorgte Tonfall verriet Eric, wer der Anrufer war - Jane musste am Apparat sein. Jane, ihre neunundzwanzigjährige Tochter. Eric klemmte sich seine Angel unter den Arm und verließ das Schlafzimmer. Wenn Jane anrief und Emely in diese jammernde Stimmlage fiel, waren garantiert Eheprobleme angesagt. Nichts, was Eric hören wollte. Außerdem musste er seine Gummistiefel aus der Garage holen.
Als er zehn Minuten später zurückkam, hockte Emely auf dem Bett und weinte.
»Was, zum Teufel, ist passiert? Hat er sie verprügelt?«
»Schlimmer«, schluchzte Emely. »Er hat eine andere ... Ein Liebesbrief ... Jane hat einen Liebesbrief von ihr in seinem Schreibtisch gefunden ...«
»Was muss sie auch in seinem Schreibtisch herumkramen!«
»Du bist gemein, Eric«, jammerte Emely. »Begreifst du nicht? Unser Kind ist unglücklich. Dieser ... dieser Schuft hintergeht die arme Jane ...«
»Ich hab ihr immer gesagt, sie soll die Finger von diesem Kerl lassen.« Eric schnappte sich sein Angelzeug und eine Tasche mit Büchern und machte Anstalten das Schlafzimmer zu verlassen. »Ich hab den Wagen rausgestellt.«
»Jane will keine Stunde länger Bett und Tisch mit ihm teilen«, verkündete Emely. »Sie und die Kinder kommen ein paar Tage zu uns.« Wieder schluchzte sie. »Ich kann unmöglich nach Coney Island fahren. Meine Tochter braucht mich jetzt! Und dich braucht sie auch! Fahr den Wagen wieder in die Garage!«
»Kommt nicht in Frage!« Eric hatte sich entschieden, sich seine gute Laune von niemandem verderben zu lassen. »Hol deine Sachen aus dem Koffer - ich fahre allein!«
»Hast du einen Stein statt eines Herzens in der Brust?« Emely ruderte aufgeregt mit beiden Armen und lief ihm bis in den Garten hinterher. »Jane braucht uns, dass musst du doch verstehen!«
Seelenruhig packte Eric seine Sachen in den Kofferraum seines Plymouth. Er war fest entschlossen, nur sich selbst zu verstehen. Er brauchte ein paar Tage Urlaub. Basta.
In Gedanken fluchte er natürlich. Auf seinen Schwiegersohn. Der italienisch stämmige Paul war nicht nur ein loser Weiberheld - anders hatte Eric ihn nie eingeschätzt -, er war auch noch zu blöd, seine Seitensprünge zu verbergen. Eric selbst wäre so etwas nicht passiert.
Sie stritten ein Weilchen hin und her, Emely zeterte und jammerte, Eric brummte ein bisschen und blieb stur. »Ich verachte dich«, schimpfte Emely, als er sich endlich hinter das Steuer setzte. »Du bist ein Rabenvater, denkst nur an dich, nur an dich ...«
Das waren ungefähr die letzten Worte, die sie ihm an den Kopf warf. Eric antwortete nicht und fuhr in die Dämmerung hinein. Kein schöner Abschied, wenn man bedenkt, dass Emely und Eric Johnson danach nie mehr Gelegenheit bekommen sollten, miteinander zu sprechen ...
4

|

|


Ganz bewusst hatte er an diesem Abend die Uniform anbehalten. Sie sollte keine Angst vor ihm haben, sie sollte sehen, dass er ein anderer Mensch geworden war. Einer, der jetzt auf der richtigen Seite des Gesetzes stand.
Er hatte die Kneipe eines Kinocenters in der Westside vorgeschlagen. Sie hatte akzeptiert. Ein halbes Jahr hatte er ihr geschrieben und mit ihr telefoniert. Am Anfang hatte sie einfach den Hörer aufgeknallt, dann wenigstens zugehört, und jetzt hatte er sie endlich überreden können, sich mit ihm zu treffen.
Ständig blickte er zur Tür, Schweiß stand auf seiner Stirn, seine Rechte spielte mit der Dienstmütze, die neben ihm auf dem Tisch lag. Erst wenn sie im Gedränge des Kino-Foyers auftauchte, würde er es glauben.
Seit einer halben Stunde saß Chester Bronson am hintersten Tisch des Kino Bistros. Er wollte unter allen Umständen vermeiden, dass sie sich verfehlten. Er hatte seinen Captain extra um eine halbe Stunde Beurlaubung gebeten.
Chester Bronson war Sergeant der New York Police. Er arbeitete für das 6. Polizeirevier.
Eine auffällige Erscheinung, wenn man ihn so in einer Kneipe sitzen oder durch einen Supermarkt laufen sah: Sein üppiges, schwarzes Haar stand ihm störrisch nach allen Seiten ab, er trug einen Schnurrbart. Besonders groß war er nicht, aber ziemlich kräftig gebaut. Seine Haut hatte die Farbe eines kräftigen Milchkaffees. Die Gene seiner mexikanischen Mutter hatten sich bei ihm durchgesetzt. Chester Bronson war Ende zwanzig.
Er zuckte zusammen und hielt für einen Moment den Atem an, als er die zierliche Frau im Gedränge vor den Kassen entdeckte. »Das ist sie«, flüsterte er. »Oh Gott, das ist sie.«
Sie bewegte sich tänzelnd. Der Versuch, keinem der vielen Menschen allzu nahe zu kommen, veranlasste sie zu einem leichtfüßigen Zickzackkurs. Sie trug Turnschuhe, weite blaue Hosen und einen weiten Pullover darüber, ebenfalls blau. Ihr rotblondes Haar war zu einem dicken Zopf geflochten.
Im Eingangsbereich der Kneipe - der Gastraum ging praktisch türlos in das Kino-Foyer über - blieb sie stehen und sah sich um. Zwei- oder dreimal glitten ihre Blicke über Bronsons Gesicht. Jedes Mal stockte ihm der Atem, aber sie erkannte ihn nicht. Es war zu lange her. Hoffentlich lange genug, dachte Bronson. Endlich hob er den Arm und winkte.
Zögernd näherte sie sich. Bronson sah, dass ihre blauen Hosen Jogginghosen waren. Er stand auf und wusste nicht, ob er ihr die Hand reichen sollte oder nicht. Er tat es nicht - die Angst, sie mit einer solchen Geste zu vertreiben, hielt ihn ab.
Sie nickte kurz und setzte sich dann, nahm ihm gegenüber Platz und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Sie ... Sie glauben gar nicht ...« Bronson schluckte. Die junge Frau betrachtete ihn mit großen blauen Augen. »Sie glauben gar nicht, wie dankbar ich bin, dass Sie gekommen sind, Miss O’Brian.«
»Nennen Sie mich Suzy - warum tragen Sie diese Uniform?«
»Ich bin Cop. Seit sechs Jahren. Suzy, ich wollte ...«
»Ein Mann wie Sie ist Cop?« Sie schüttelte den Kopf. »Das glaub ich einfach nicht.«
Bronson meinte etwas wie Spott in ihren ernsten Augen auf blitzen zu sehen. Oder war es Zorn?
Für Sekunden musterten sie sich schweigend. Es fiel ihm schwer, ihrem Blick standzuhalten.
»Sie haben recht, Suzy«, sagte Bronson schließlich, und seine Stimme klang brüchig und heiser, als er das sagte. »Wenn ich morgens, bevor ich mein Apartment verlasse, noch einmal in den Spiegel schaue und meine Uniform sehe, denke ich das auch oft: Ein Mann wie du ist Cop geworden, ich glaub's einfach nicht ...«
»In den Zeitungen stand damals, dass Sie der Anführer der Jugendgang gewesen wären«, sagte Suzy leise.
»Das stimmt nicht«, widersprach Bronson. »Houston war der Anführer, der älteste der Taylor-Brüder. Und Larry war seine rechte Hand gewissermaßen. Aber es stimmt schon, ich spielte eine wichtige Rolle in der Gang, das ist richtig. Ich war der Stärkste und konnte am besten schießen.«
»Und wie wird ein Straßenrowdy wie Sie Polizist?«
»Ich wurde nie verurteilt. Und ich war damals ja noch ziemlich jung. Jedenfalls steht nichts über die Sache von damals in meiner Akte. Niemand weiß davon. Und falls sich doch jemand daran erinnern sollte, ich würde sagen: Das muss ein anderer Chester Bronson gewesen sein. Und das stimmt auch.«
»Wie meinen Sie das?«
»Es war etwa ein Jahr nach dem Prozess damals ...« Bronson war heilfroh, endlich das loswerden zu können, was er der jungen Frau seit Jahren sagen wollte. »Die Lower Eastside lag unter einer Schneedecke, und es war lausig kalt. Burschen einer feindlichen Gang trafen mich am Hamilton Fish Park, als ich von Crack und Alkohol zugedröhnt war. Sie schlugen mich mit Fäusten, Totschlägern und Ketten. Wenn nicht zufällig vier Heilsarmisten vorbeigekommen wären, hätten sie mich erschlagen wie einen kranken Hund.«
»Und dann?«
Ihre Augen blickten ihn aufmerksam an. Er spürte ihre Neugier. Das machte ihm Mut. »Die frommen Männer und Frauen von der Heilsarmee haben mich in eine Klinik gebracht und jeden Tag besucht. Eines Tages brachten sie den Pastor einer Baptistengemeinde aus SoHo mit. Der Mann hat sich zwei Jahre lang um mich gekümmert. Mir eine Wohnung beschafft, mir Geld gegeben, eine Arbeit für mich gesucht und so weiter, und so weiter. Tja ...« Als wäre er ratlos, breitete er die Arme aus. »So begegnete mir die Liebe Gottes in der Gestalt von Menschen. Da widerstehe wer will - ich jedenfalls hab mich bekehren lassen.«
Suzy runzelte die Stirn. »Sie haben was?!« Verblüffung und Skepsis drückte ihre Miene aus. Bronson hatte nichts anderes erwartet.
»Ich bin Christ geworden. Das hat mein Leben auf den Kopf gestellt.«
»Und der liebe Gott hat Ihnen alles verziehen ...« Bitterkeit lag in ihrer Stimme. Bitterkeit und Spott.
»Mein Pastor sagt, Jesus wäre am Kreuz für alle meine Sünden gestorben.« Bronson nickte und seufzte tief. »Ja, das sagt er. Aber er sagt auch, ich solle so viel wiedergutmachen, wie ich kann. Das ist nicht einfach, ich habe eine Menge verbrochen ...« Die Stimme brach ihm.
»Das Schlimmste habe ich an Ihnen verbrochen ...« Jetzt konnte er ihrem Blick nicht mehr standhalten, er senkte den Kopf. »Ich wage es nicht, Sie um Verzeihung zu bitten, das wäre zu viel verlangt ...«
»Ich habe Ihnen nichts zu verzeihen«, sagte Suzy kühl. »Die anderen waren es. Sie standen dabei, als sie mich ...« Sie unterbrach sich und presste die Lippen zusammen. »Ich hätte mich nicht mit Ihnen treffen können, wenn Sie mich auch ...«
»Eben - ich stand dabei. Ich hätte es verhindern können. Ich habe es nicht verhindert.Von mir kam auch die Idee. Es fallt mir schwer, es einzugestehen, aber es ist die Wahrheit ... Von mir kam die Idee, Sie unter Drogen zu setzen und ...«
»Und warum haben Sie nicht selbst zugegriffen?« Suzy beugte sich vor. Ihr Blick hatte jetzt etwas Lauerndes. »Ich war vollkommen wehrlos. Die Drogen hatten mich willenlos gemacht. Alle haben sich bedient. Warum Sie nicht?« Die Art, wie sie redete, erinnerte Bronson an die Verhöre, die er damals, vor neun Jahren über sich ergehen lassen musste.
»Ich ... ich konnte nicht ...« Er kam ins Stammeln. »Sie taten mir so leid ... ich hatte mich ein bisschen ... in sie verguckt ... ich kam mir plötzlich vor wie ein Schwein ...«
»Dann hätten Sie mir helfen müssen!«, sagte Suzy scharf.
»Ich weiß, bitte ... wenn ich irgendwie ...«
»Meine Mutter ist krank geworden nach dem Prozess. Ein Jahr danach ist sie gestorben!« Suzy stieß ein bitteres Lachen aus. »Ungefähr zu der Zeit, als Sie sich bekehren ließen, wie Sie das nennen. Mein Vater hat es nicht verkraftet - erst die ... die Vergewaltigung seiner einzigen Tochter, dann das Gerede der Leute, und schließlich der Tod meiner Mutter. Er spinnt seitdem.« Sie schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn. »Er ist verrückt geworden, verstehen Sie? Und ich ... und ich ...« Sie winkte ab, legte die Hand auf den Mund und schloss die Augen.
Bronson sah, dass sie mit den Tränen kämpfte. »Es tut mir so leid, Suzy ...«
»Das habt ihr angerichtet, ihr verdammten Scheißkerle«, flüsterte sie.
»... es tut mir so leid ...«
»Keiner von euch musste bezahlen. Ihr lebt weiter, als wäre nichts geschehen. Bekehrt euch, werdet Polizisten und bettelt um Entschuldigung.« Blitzartig beugte sie sich über den Tisch. Auf einmal stand Hass in ihren Augen. »Nur ich allein zahle die Rechnung!« Ihr schönes Gesicht verzerrte sich zu einer Grimasse. »Ich allein zahle die Rechnung für das, was ihr mir angetan habt! Ich und meine Familie!«
»Sie haben so recht, Suzy ...« Er rieb die Hände, als würde er sie waschen, sein Adamsapfel tanzte auf und ab, der Stuhl unter seinem Hintern schien zu brennen. »Ich kann's nicht ungeschehen machen. Aber ich steh in Ihrer Schuld - ich werde alles tun, was Sie wollen, ich bezahle die Arztrechnungen für Ihren Vater, ich ...«
»... und ich kotze gleich!« Suzy sprang auf und rannte aus der Kneipe.
Wie gelähmt blieb Bronson auf seinem Stuhl sitzen. Er sah ihr nach, bis sie im Gedränge der Menschen verschwand.
5

|

|


Es war dunkel, als Eric seinen Plymouth den asphaltierten Weg zur Küste hinuntersteuerte. Je weiter er Brooklyn hinter sich ließ, desto klarer wurde der Sternenhimmel.
Er fuhr am Wochenendhaus der McMillans vorbei. Licht brannte hinter den Fenstern. Sie waren also auch auf Coney Island, die McMillans. Und wer den Mittwochabend schon in seinem Feriendomizil verbrachte, blieb in der Regel bis zum Sonntagabend. Geoffrey und seine Frau würden also auf jeden Fall eine Sektparty veranstalten und die Nachbarn aus den weit verstreut liegenden Wochenendhäusern einladen.
Eric ging vom Gas, als sich die Konturen seines flachen Hauses aus der Dunkelheit schälten. Er war froh, dass Emely zu Hause geblieben war. Sie liebte Sektpartys. Er hasste Sektpartys. Und hatte keine Hemmungen eine Einladung auszuschlagen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2018
- ISBN (ePUB)
- 9783738919387
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (April)
- Schlagworte
- jesse trevellian grausame thriller