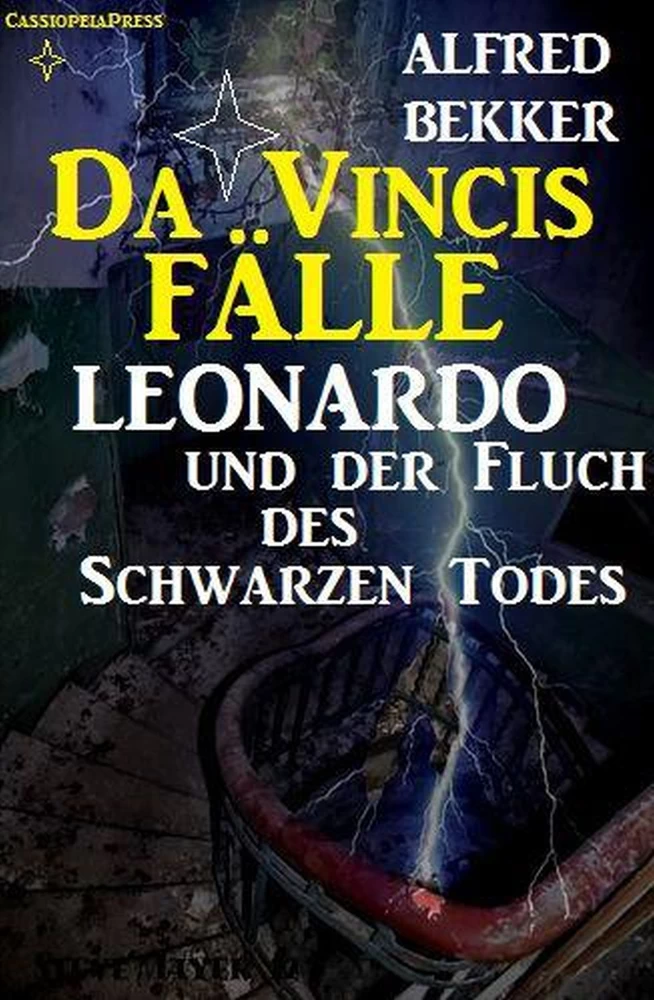Zusammenfassung
Als im Dorf ein Bettlerjunge mit dunklen Flecken im Gesicht auftaucht, sind die Bewohner von Vinci in heller Aufregung: Die Pest ist ausgebrochen! Zum Glück ist schnell ein Arzt zur Stelle, der ein Heilmittel gegen den schwarzen Tod besitzt. Leonardo möchte das Mittel gerne untersuchen. Doch der Arzt hütet sein Geheimnis wie seinen Augapfel. Und Leonardo setzt alles daran, es zu lüften.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
 |  |

Copyright

Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2025 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
 |  |

Leonardo da Vincis Fälle Band 5

Leonardo und der Fluch des Schwarzen Todes
von Alfred Bekker
Die deutschsprachigen Printausgaben erschienen 2008/2009 im Arena Taschenbuchverlag;
Übersetzungen liegen auf Türkisch, Indonesisch, Dänisch und Bulgarisch vor.
Neu durchgesehene Fassung
© 2008, 2009 by Alfred Bekker
© 2015 AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Ein CassiopeiaPress E-Book
Der Umfang dieses Buch entspricht 113 Taschenbuchseiten.
 |  |

Dieses Buch beinhaltet folgende Kapitel:

1. Kapitel: Geheimnisvolle Zeichen
2. Kapitel: Ein seltsamer Junge
3. Kapitel: Der schwarze Tod in Vinci
4. Kapitel: Der Mann mit den Mumien
5. Kapitel: Das Wundermittel
6. Kapitel: Albertos Geheimnis
7. Kapitel: Die Mumiendiebe
8. Kapitel: Der Ritt nach San Luca
9. Kapitel: Die Feuerreiter
10. Kapitel: „Brennt Vinci nieder!“
11. Kapitel: Der Moment der Wahrheit
 |  |

1.Kapitel

Geheimnisvolle Zeichen
Kerzenlicht flackerte in dem halbdunklen Raum. Schatten tanzten an den Wänden des kühlen Gewölbes.
Leonardo sah auf die Reihen der geheimnisvollen Zeichen. Manche schienen Zeichnungen zu gleichen und waren liebevoll ausgemalt. Andere ähnelten Tieren, wirkten sehr kompliziert und waren jeweils mit einem lang gezogenen Oval umschlossen.
„Was bedeuten diese Zeichen da auf dem Papier?“, fragte Leonardo.
„Das ist weder Papier noch Pergament, sondern Papyrus“, korrigierte ihn der alte Mann in dem kostbaren Gewand und der goldenen Kette um den Hals. Er streckte die faltige Hand mit den dürren Fingern aus. Ein Ring mit dem Siegel der Familie Medici befand sich am Ringfinger, einer mit dem Siegel der Stadt Florenz am Mittelfinger. „Und die Zeichen sind ägyptische Hieroglyphen, mit denen vor langer Zeit geschrieben wurde...“
„Vor wie langer Zeit?“, fragte Leonardo.
Der alte Mann hob die Augenbrauen und ein mildes Lächeln glitt über sein Gesicht.
„Du kennst die Geschichten über Moses und wie er vom Pharao die Freiheit für das Volk Israel gefordert hat?“
„Ja, mein Großvater hat mir davon erzählt. Und manchmal der Pater in der Kirche...“
„Zur Zeit von Moses hat man wohl diese Zeichen benutzt.“
„Und was bedeuten sie?“
„Das weiß niemand. Manchmal sind klare Bilder dazwischen –
meistens von Tieren. Aber was die im Zusammenhang mit den anderen Zeichen bedeuten und ob es sich um Buchstaben handelt oder das ganze Zeichen für sich für einen Begriff steht...“ Der alte Mann zuckte mit den Schultern. „Ich habe nicht die geringste Ahnung, obwohl ich mir alle Mühe gegeben habe, es herauszufinden. Die klügsten Gelehrten habe ich hierher nach Florenz kommen lassen. Aber das Rätsel hat niemand lösen können. Wer weiß, vielleicht schafft das mal jemand irgendwann in der Zukunft. Jemand, der sich auf Geheimschriften versteht, so wie du – denn es muss ja ein System hinter allem stecken!“
Der alte Mann war Cosimo de’ Medici.
Er war das Oberhaupt der reichsten und mächtigsten Familie in Florenz und außerdem der Herr der Stadt. Cosimo war schon inzwischen schon über 80 Jahre, aber er hielt die Macht noch immer in den Händen und dachte auch noch gar nicht daran, sie an einen Nachfolger anzugeben.
Durch den Handel mit Wolle hatte Cosimo als junger Mann dafür gesorgt, dass die Familie Medici reich und mächtig wurde. Aber er hatte einen Teil des Reichtums nicht in Paläste oder Luxus gesteckt, sondern damit seine Sammelleidenschaft finanziert. Cosimo sammelte nämlich alte Schriften. Vor allem Werke der alten Römer und Griechen, aber auch arabische und hebräische Bücher waren zahlreich vertreten. Durch ganz Europa war er selbst gereist, um alte Schriften zu erwerben. Später hatte er Gelehrte in seinen Diensten, die das für ihn taten. Sie reisten bis ins Heilige Land nach Jerusalem oder nach Kairo und Alexandria in Ägypten. So hatte Cosimo de’ Medici im Laufe der Zeit eine gewaltige Sammlung zusammengetragen.
Und dass Leonardo Gelegenheit hatte, in dieser einzigartigen Sammlung zu stöbern, verdankte er der Tatsache, dass sein Vater Ser Piero ab und zu als Notar und Schreiber für den Stadtherrn von Florenz tätig war.
„Es gibt so vieles, was die Menschheit in den letzten tausend Jahren vergessen hat, mein Junge“, sagte Cosimo. „Die alten Ägypter, Römer, Griechen, Perser... In ihren Schriften sind so viele Erkenntnisse, Erfindungen, Gedanken...“ Cosimo wirkte regelrecht ergriffen und bewegt. Sein Blick war ins Nichts gerichtet, so als würde er sich an die alten Zeiten erinnern, da er noch durch unzählige Länder gereist war und nach Schriften gesucht hatte.
„Wie konnte es geschehen, dass diese Dinge vergessen wurden?“, fragte Leonardo. „Und warum musstet Ihr durch halb Europa reisen, um all die Bücher zusammen zu holen? Man hätte doch auch vorher schon eine Bibliothek daraus machen können, in die jeder hineingehen kann!“
„Man hat die alten Texte in Griechisch und Latein zum Teil von den Pergamenten herunter radiert, um etwas anderes darauf schreiben zu können“, sagte er. „Vor allem natürlich Texte, die entstanden sind, bevor es den christlichen Glauben gab! Denn das waren doch Bücher von ungläubigen Heiden! Wozu sie aufbewahren, wenn Pergament oder Papier doch so knapp war?
Glücklicherweise haben die Araber viele der griechischen Texte abgeschrieben und übersetzt, sodass sie noch erhalten sind...“
Cosimo wandte sich nun an Ser Piero, der auch im Raum war und die ganze Zeit über nur zugehört hatte. „Ihr habt einen sehr verständigen Sohn, Ser Piero“, meinte er. „Weiß er schon, was er einmal werden will?“
„Er interessiert sich für so vieles“, sagte Ser Piero. „Er zeichnet Fantasiemaschinen und beobachtet gerne die Tiere in der Natur. Er malt gerne und ist außerdem handwerklich geschickt. Deswegen denke ich, es ist das Beste, er lernt in einer Künstlerwerkstatt.“
Cosimo nickte. „Das ist gut“, fand der Stadtherr von Florenz, wobei es Leonardo etwas ärgerte, dass die beiden jetzt über ihn sprachen, als wäre er gar nicht dabei. Wie über ein Kind eben, dachte er. Dass es an sich schon sehr außergewöhnlich war, dass Cosimo de’ Medici sich Zeit dafür nahm, um mit einem Jungen vom Dorf in alten Schriften zu stöbern, daran dachte Leonardo gar nicht. Aber vielleicht spürte er, dass Leonardo von demselben Interesse, an diesen geheimnisvollen, rätselhaften Dingen erfüllt war. Schritte waren plötzlich zu hören.
Sie halten in dem Gewölbe wider. Ein Bediensteter des Hauses Medici näherte sich, machte eine Verbeugung und sagte dann: „Herr, Ihr habt mir aufgetragen, Euch in Erinnerung zu rufen, dass Ihr Euch jetzt in den großen Saal begeben müsst. Die Verhandlungen mit dem Gesandten aus Mailand...“
Cosimo hob die Hand und verzog angestrengt das Gesicht. „Ah, erinnert mich nicht über Gebühr an diese unerfreulichen Dinge!“, wehrte er ab. „Richtet aus, dass ich gleich eintreffen werde!“
„Jawohl“, nickte der Bedienstete, verbeugte sich abermals und ging wieder davon.
Cosimo erhob sich nun. „Du hast es ja gehört, mein Junge, die Regierungsgeschäfte rufen mich.“
„Herr Cosimo, überlasst mir dieses Papyrus!“, meint er. „Vielleicht könnte ich das Rätsel der Hieroglyphen für Euch lösen!“
„Es tut mir Leid, aber dieses Stück ist zu wertvoll, um es aus der Hand geben zu können“, sagte Cosimo. „Du kannst es dir gerne ansehen, aber das geht nur hier in den Räumen meiner Bibliothek...“
„Dann lasst mich dieses Dokument abzeichnen“, sagte Leonardo. „Denn ich weiß nicht, ob mir gerade hier der richtige Gedanke kommt, um die Bedeutung zu entschlüsseln.“
Cosimo atmete tief durch. Bevor der Stadtherr jedoch etwas sagen konnte, ergriff Ser Piero das Wort. „Entschuldigt, wenn ich Euch zuvorkomme, aber das Anliegen meines Sohnes erscheint mir ziemlich unverschämt und deswegen...“
„Mir ist es recht und billig“, meinte hingegen Cosimo zu Ser Pieros Überraschung. „Wer bin ich, dass ich einem Talent im Wege stehen sollte.“
„Ihr seid sehr großzügig“, fand Ser Piero und verneigte sich tief.
„Ihr aber auch, Ser Piero“, erwiderte Cosimo. „Schließlich müsst Ihr ja auf Euren Sohn warten, bis er mit seinen Zeichnungen fertig ist – und nicht ich!“
Nachdem Cosimo de Medici gegangen war, machte sich Leonardo sogleich ans Werk. Papier und Bleistift hatte der Notar Ser Piero immer in seiner Tasche, schließlich war es ja sein Beruf, für andere Leute, die dazu nicht in der Lage waren, Verträge oder Bittschreiben und Briefe aufzusetzen.
Leonardo sah sich die Zeichen und Bilder genau an. Auffallend waren für ihn die Zeichnungen von Wesen, deren Körper wie Menschen aussahen, aber einen Tierkopf besaßen. Männer mit Krokodilköpfen, Katzenköpfen und solche, die an Hunde erinnerten, fielen ihm auf. Besonders aber ein Vogelköpfiger. Dieser Vogelkopf hatte einen sehr langen, gebogenen Schnabel, wie ihn Leonardo bisher noch bei keinem Vogel gesehen hatte.
Gerade für Vögel interessierte er sich besonders, was einfach daran lag, dass sie fliegen konnten und er irgendwann hoffte, das Geheimnis des Fliegens von ihnen abschauen zu können. Und während Leonardo sorgfältig jedes Zeichen und jedes Bild auf das Papier bannte, rasten die Gedanken nur so in ihm. Fragen über Fragen eröffneten sich. Hatten diese Tiermenschen wirklich gelebt oder waren sie Götzenbilder, die von den Menschen verehrt wurden? Und hing das mit den Zeichen zusammen, die um sie herum angeordnet waren? Leonardo hatte nämlich keineswegs den Eindruck, dass auch nur irgendein Strich auf diesem Papyrus zufällig gesetzt worden war. Alles schien einer wunderbaren Ordnung zu entsprechen. Einer Ordnung, von der aber niemand mehr etwas wusste, sodass die Botschaft nicht mehr gelesen werden konnte. Ser Piero ging zunächst etwas unschlüssig auf und ab. Dann sagte er schließlich: „Es ist ohnehin schon später geworden, als ich gedacht hatte. Ich schlage vor, dass wir daher eine Nacht länger hier in Florenz bleiben und erst morgen früh uns auf den Weg nach Vinci machen.“
„Mir ist das sehr recht“, sagte Leonardo. „Wir könnten auch zwei Tage noch hier bleiben, denn der Cosimo hat sicherlich noch eine Reihe anderer hochinteressanter Schriftstücke hier liegen...“
„Also das kommt ganz bestimmt nicht in Frage“, erklärte Ser Piero klipp und klar.
Am nächsten Morgen machten sich Leonardo und sein Vater auf, um zurück nach Vinci zu reiten. Leonardo ritt auf der Stute Marcella, die sein Vater mal von einem Schuldner als Pfand genommen hatte und nun seitdem von Leonardos Großvater im Stall gehalten wurde. Leonardo hatte die Zeichnung von dem Papyrus zusammengefaltet in einer Tasche, die er um die Schultern trug und die ansonsten noch ein paar andere Dinge enthielt, die Leonardo auf die Kurzreise von Vinci nach Florenz und wieder zurück mitgenommen hatte.
Eigentlich hatte es einen besonderen Grund gehabt, dass Leonardo seinen Vater nach Florenz begleitet hatte.
Ser Piero hatte nämlich gehofft, Leonardo noch einmal in der Bildhauer-und Malerwerkstatt des berühmten Andrea del Verrocchio vorstellen zu können.
Dort, so sein Plan, sollte Leonardo in die Lehre gehen und alles über die Bildhauerei und die Malerei zu lernen. Andrea del Verrocchio war ein Meister seines Fachs und Leonardo hätte auch liebend gern bei ihm gelernt. Aber Meister Verrocchio konnte sich seine Schüler aussuchen, da es als große Ehre galt, bei ihm in die Lehre zu gehen. So war der Andrang an neuen Lehrlingen immer recht groß.
Ser Piero hatte Leonardo bereits einmal vorgestellt und die Antwort bekommen, dass man noch warten sollte, bis Leonardo etwas älter sei. Es gab manchmal sehr früh begabte Lehrlinge, die dann zwölf oder dreizehn Jahre waren. Normalerweise aber hatten die Lehrlinge des Andrea del Verrocchio ein Alter von vierzehn oder fünfzehn Jahren, sodass sie dann mit spätestens neunzehn fertig waren und in die Malergilde von Florenz aufgenommen werden konnten.
Leonardo allerdings war erst zehn.
Und das war dem Meister einfach zu jung gewesen. Nun hatte Ser Piero allerdings gehört, dass einer der Lehrlinge an einer plötzlich auftretenden Krankheit gestorben war. Was für eine Krankheit das war, hatte niemand genau festgestellt, aber Ser Piero hatte sich natürlich Hoffnungen gemacht, dass sich der große Andrea del Verrocchio vielleicht doch erweichen ließ und Leonardo aufnahm. Dass der Junge begabt war, daran hatte er ja nie gezweifelt.
Doch Ser Pieros Pläne hatten sich zerschlagen, denn Meister Verrocchio war für ein paar Wochen nach Pisa abgereist – einen Tag bevor Ser Piero und Leonardo in Florenz eintrafen!
„Du wirst dich vielleicht gewundert haben, weshalb ich so darauf dränge, dass du doch schon früher in die Lehre gehen kannst“, sprach Ser Piero seinen Sohn während des Rittes an.
Doch Leonardo hörte gar nicht richtig zu. Er beobachtete nämlich ein paar Vögel, die über den Himmel zogen. Große Vögel waren das – mit langen Beinen und sehr langen Schnäbeln. Vielleicht Störche oder Fischreiher. Genau ließ sich das aus der Entfernung nicht sagen, aber wenn sie weniger weit weg gewesen wären, hätte Leonardo sofort gewusst, um welche Vogelart es sich handelte. Inzwischen kannte er sich damit nämlich sehr gut aus.
„Hörst du mir eigentlich zu?“, fragte Ser Piero. „Warum starrst du denn dauernd die Vögel da oben an?“
„Ich habe an die Vogelköpfe auf dem Papyrus gedacht“, sagte Leonardo. „Die hatten auch lange Schnäbel. Soweit ich bisher gesehen habe, benutzen immer die Vögel lange Schnäbel, die damit im Wasser Fische fangen und ich frage mich, ob der Vogelmensch auf dem Papyrus wohl auch Fische gefangen hat.“
„Leonardo, ich rede über deine Zukunft und du siehst Vögeln nach!“
„Vater, ich weiß nicht, weshalb du dir da jetzt so viele Gedanken machst, aber Andrea del Verrocchio hat doch schon gesagt, dass er mich gerne nehmen will. Nur eben jetzt noch nicht. Dass wir ihn nicht angetroffen haben, ist Pech, aber wenn er mich nicht nimmt, wird mich schon eine andere Werkstatt aufnehmen. Und wenn das noch ein paar Jahre dauert, ist das auch nicht so schlimm. Dann kann ich bis dahin vielleicht ein paar meiner Erfindungen so vollenden, dass man sie wirklich einsetzen kann und habe vielleicht das Geheimnis des Fliegens endlich gelüftet.“ Er berührte mit der Hand die Tasche an seiner Seite. „Und natürlich die Hieroglyphenschrift! Das wäre ja schließlich gelacht! Griechisch und Hebräisch kann man ja auch heute noch lesen und viel komplizierter als die Geheimschrift, die ich mir selbst ausgedacht habe, können die Zeichen auf dem Papyrus ja wohl auch nicht sein!“
„Leonardo, ich habe dir ja schon mal gesagt, dass ich darüber nachdenke, ob wir in den nächsten Jahren nach Florenz ziehen. Vielleicht etwas früher, vielleicht etwas später. Aber ich arbeite jetzt so viel für Cosimo de’ Medici, da wäre das schon recht praktisch.“
„Hast du gesagt ‚wir’?“, fragte Leonardo.
Er wohnte nämlich bei seinem Großvater in Vinci. Seine Eltern waren nicht verheiratet gewesen. Seine Mutter hatte einen Bauern und Töpfer aus der Umgebung geheiratet und mit ihm eine eigene Familie. Dort hatte er nicht bleiben können. Und auch bei Ser Piero hätte er nicht aufwachsen können.
So hatte er die letzten fünf Jahre bei seinem Großvater gelebt - was ihm nicht schlecht bekommen war, denn kaum jemand anderes hätte ihm so viele Freiheiten erlaubt.
„Und was wird dann aus Großvater?“, fragte Leonardo.
„Er ist schon alt und niemand weiß, wie lange er noch lebt. Wer weiß, vielleicht käme er ja auch mit nach Florenz. Jedenfalls wäre mir wohler, wenn du schon bald etwas lernen würdest.“
Leonardo überlegte einige Augenblicke.
Dann sagte er schließlich: „Ich glaube nicht, dass das klappt, Vater. Niemand nimmt jemanden, der so jung ist wie ich. Man traut uns einfach nichts zu, das ist das Problem!“
Als sie weiter ritten, trafen sie ein paar Meilen vor Vinci einen Jungen. Er lief in Lumpen daher. Sein Gewand wirkte wie ein vielfach geflickter Sack und seine Hose schien fast nur noch aus Flicken zu bestehen. Er trug ein Bündel bei sich, in dem sich wohl sein ganzer Besitz befand. Dieses Bündel hatte er an einen Stock geknotet, den er über die Schulter gelegt hatte. Leonardo zügelte die Stute Marcella, als sich sein Vater und er dem Jungen näherten. Dieser pfiff ein Lied vor sich hin, drehte sich zu ihnen um und wich zur Seite, um den beiden Reitern den Weg frei zu machen.
Leonardo schätzte den Jungen auf vielleicht elf oder zwölf Jahre. Das gelockte Haar fiel ihm bis in die Augen, sodass man gar nicht sehen konnte, ob er einen ansah oder nicht.
„Eine milde Gabe für ein armes Waisenkind!“, sagte der Junge und hielt seine Hand auf, als Leonardo und Ser Piero ihren Pferden nicht sofort die Hacken in die Weichen drückten, um sie davon galoppieren zu lassen. „Ihr habt doch ein gutes Herz, seit Christen und glaubt an den Herrn Jesus und die barmherzige Jungfrau Maria. So helft einem armen Waisenkind den nächsten Tag zu überleben. Mir knurrt der Magen und wahrscheinlich muss ich bald Hungers sterben, wenn ich mir nichts kaufen kann...“
Irgendwie erschien Leonardo die Art und Weise, in der der Junge seine Bettelei vor trug etwas übertrieben, denn auch wenn er ärmlich gekleidet war, so waren seine Wangen doch voll und rund. Ser Piero warf ihm eine Münze zu.
Der Junge fing sie auf.
„Und ist Euer Ziel zufällig der Ort Vinci?“, fragte er.
„Dahin sind wir unterwegs“, antwortete Leonardo.
„Dann könntet Ihr mich doch mitnehmen.“ Er wandte sich an Leonardo. „Du bist jünger als ich und zusammen wären wir nicht zu schwer für dein Pferd!“
„Du hast schon genug bekommen!“, sagte Ser Piero. „Jetzt werde nicht unverschämt!“
„Aber ich bin ein armes Waisenkind ohne Eltern, das sich allein durchschlagen muss!“, erwiderte der Junge. „Habt Ihr den gar kein Mitleid? Was für eine hartherzige Welt. Aber Jesus Christus sagt: Was ihr dem Geringsten unter euch tut, das habt ihr mir getan!“
„Wie heißt du?“, fragte Leonardo.
„Mein Name ist Alberto.“
Leonardo reichte ihm die Hand. „Komm, schwing dich hinter mich aufs Pferd. Marcella ist zwar schon müde, aber das wird sie wohl auch noch schaffen.“
„Tausend Dank!“, sagte der Junge. „Im Himmel wird man dich dafür belohnen!“
Während der letzten Meilen bis Vinci kam Leonardo mit einem Jungen ins Gespräch. Er gab an, von Ort zu Ort zu ziehen und sich mit Gelegenheitsarbeiten bei den Bauern über Wasser zu halten. Seine Eltern seien selbst Bauern gewesen, hätten aber bei einem Brand ihr Leben verloren und da das Land nicht ihr eigenes gewesen wäre, hätte Alberto dort auch nicht bleiben können. „Seitdem ziehe ich umher und lebe von der Barmherzigkeit der Menschen und meiner Hände Arbeit. Wisst ihr nicht vielleicht einen Hof in der Nähe von Vinci, der gerade einen guten Knecht braucht? Denn das bin ich bestimmt! Ich weiß, wie man die Tiere gut behandelt, wie man melkt, wie man das Getreide aberntet, wie man eine Wiese mäht und wie man Käse zubereitet...“
„Ich könnte mal Großvater fragen“, meinte Leonardo. „Der ist doch mit allen Bauern in der Umgebung bestens bekannt und hat sicher gehört, wo jemand eine Hilfe braucht.“
Es dauere nicht mehr lange und sie erreichten das Dorf Vinci. Das Haus von Leonardos Großvater lag direkt am Dorfplatz. Großvater wartete schon vor der Tür. Er saß dort auf der Bank und erhob sich, als er die Reiter kommen sah.
„Nanu, ihr wolltet doch einen Tag früher zurückkehren“, meinte er.
„Leonardo wollte unbedingt ein ägyptisches Papyrus abzeichnen“, sagte Ser Piero und lachte. „Nein im Ernst: Es hat an mir gelegen. Cosimo de’ Medici hatte so viel für mich zu tun. Da waren die ganzen Grundverträge und...“
„Ja, ja, die Einzelheiten spare dir ruhig, mein Sohn. Oder erzähl sie mir beim Essen.“
„Und Leonardo hatte die Ehre, vom großen Cosimo persönlich in dessen Bibliothek herumgeführt zu werden“, berichtete Ser Piero.
„Der Mann weiß so viel“, stieß Leonardo hervor. „Nicht nur, wie man Geschäfte macht, sondern auch alles über alte Schriften. Über die Griechen, die Römer... und sogar etwas über die Ägypter. Die ihre Toten auf eine Weise behandelten, dass sie nicht verwesen konnten...“
„Die Familie Medici hat schon viele Talente gefördert“, sagte Großvater. „Maler, Bildhauer, Wissenschaftler... Wer weiß, vielleicht wird dir dieser Kontakt noch nützlich sein, wenn du erstmal in der Werkstatt von Meister Andrea del Verrocchio ausgelernt hast, dann wird dir Cosimo sicher zu Aufträgen verhelfen können.“
„Was Meister Verrocchio angeht, waren wir leider nicht so erfolgreich, wie ich gehofft hatte“, bekannte Ser Piero. Alberto hatte sich inzwischen von Marcellas Rücken herab gleiten lassen.
Großvater musterte ihn. „Und wer bist du?“
„Man war so freundlich, mich mitzunehmen“, sagte Alberto. „Ich bin ein wandernder Bauernknecht und helfe gerne jedem, der meine Hilfe braucht – wenn er umgekehrt dafür sorgt, dass ich keinen knurrenden Magen mehr habe.“
„Großvater, du redest doch viel mit den Bauern aus der Gegend. Kann da nicht irgendeiner einen Knecht brauchen?“, fragte Leonardo.
„Da wüsste ich gleich mehrere“, bekannte Großvater. „Zumal die Ernte noch nicht eingebracht ist und auf den meisten Höfen wirklich jede Hand gebraucht wird!“
„Für einen einfachen Hinweis, an wen ich mich wenden könnte, wäre ich sehr dankbar.“
„Den sollst du bekommen“, erwiderte Großvater. „Und zwar, wenn du dich an meinen Tisch setzt und mit uns isst. Du bist herzlich eingeladen.“
„Oh, Ihr seid ein wahrer Christ!“, rief Alberto aus. „Jemand, der noch Mitleid mit den Mühseligen und Beladenen hat!“
 |  |

2. Kapitel

Ein seltsamer Junge
Als Alberto zusammen mit Großvater, Ser Piero und Leonardo am Tisch saß, stocherte lustlos in einer Art Pfannkuchen, die Großvater nach seinem eigenen Rezept gekocht hatte.
Eine Spezialität, die sich auch unter Freunden und Nachbarn großer Beliebtheit erfreute. Selbst der Besitzer des örtlichen Dorfgasthofes hatte sich schon nach den Einzelheiten des Rezeptes erkundigt, aber Großvater hätte nicht im Traum daran gedacht, sie zu verraten.
Alberto hingegen schien dieses Rezept nicht besonders zu zusagen. Er verzog das Gesicht und würgte schließlich ein paar Bissen herunter. Dann aber erklärte er: „Es tut mir Leid, aber bevor ich auf Leonardo und seinen Vater traf, kam ich an ein paar Apfelbäumen vorbei und habe mir dabei wohl so den Magen voll geschlagen, dass mich jetzt ganz plötzlich eine starke Übelkeit quält.“
Großvater war sichtlich beleidigt.
„Nun, es zwingt dich in diesem Hause niemand, meine Pfannkuchen zu essen“, meinte er mit einem Gesichtsausdruck, der seine Verärgerung deutlich machte.
Ein paar Tipps, bei wem er sich als Knecht vorstellen könnte und wo die Höfe lägen, gab Großvater ihm allerdings trotzdem. Dann hatte Alberto es plötzlich sehr eilig.
Als er zur Tür hinausging, stolperte er über die Schwelle. Er konnte sein Gleichgewicht gerade noch halten, aber sein Bündel fiel ihm dabei zu Boden.
Es löste sich und ein Stück Käse, ein Laib Brot und ein ziemlich großes Stück Schinken rollten über den Boden.
„Wie ich sehe, bist du ja ganz gut mit Proviant ausgestattet“, stellte Großvater fest und stemmte dabei die Hände in die Hüften.
„Das sieht ja fast so aus, als hätte dir jemand etwas zusammengepackt, damit du eine Weile über die Runden kommst!“
„Ach, das war ein fahrender Händler, der ein gutes Herz hatte und den mein Schicksal bekümmerte...“
„Ein fahrender Händler“, mischte sich Leonardo ein. „So viele gibt es davon nicht in dieser Gegend. Dann wird das sicher der Vater meines Freundes Carlo sein.“
„Das weiß ich nicht“, erwiderte Alberto.
„Hieß der Händler zufällig Maldini?“
„Ja, richtig, Maldini hieß er. Ich erinnere mich. Und er erzählte mir auch davon, was für ein schöner Ort Vinci sei und dass hier so viele wohltätige und barmherzige Menschen wohnen würden.“
Alberto sammelte alles wieder ein, schnürte das Bündel neu zusammen und verabschiedete sich dann.
„Das ist ein wirklich komischer Vogel“, sagte Großvater an Leonardo gewandt. „Ein Bettler, der das Bündel voller Proviant hat, hast du so etwas schon mal gehört?“
Leonardo zuckte mit den Schultern. „Vielleicht ist er einfach ein sehr erfolgreicher Bettler!“, versuchte Leonardo eine Erklärung zu liefern.
„Was auch immer er in Wahrheit suchen mag, ich hoffe, dass er es findet“, sagte Großvater. „Aber wenn du mal bei deinem Freund Carlo vorbeischaust, dann frag dessen Vater doch mal, ob er neuerdings guten Käse und Schinken in rauen Mengen an Bettler verteilt! Das kann ich mir bei dem Geizhals nämlich ehrlich gesagt kaum vorstellen.“ Großvater wandte das Gesicht in Leonardos Richtung und fuhr dann fort. „Carlo hat sich übrigens nach dir erkundigt, während ihr weg wart.“
„Er hat wohl genau wie du damit gerechnet, dass wir einen Tag früher zurückkommen!“
„So ist es.“
Noch am Abend schaute Leonardo bei den Maldinis vorbei, deren Haus am Rand des Dorfes lag.
Carlo hatte längst bemerkt, dass Leonardo und sein Vater aus Florenz zurückgekehrt waren, denn die beiden waren am Haus der Maldinis vorbei geritten.
„Leider konnte ich nicht rauskommen und euch begrüßen“, sagte Carlo bedauernd. „Ich musste meinem Vater mal wieder beim Rechnen und beim Sortieren unserer Warenbestände helfen. Das musste unbedingt heute fertig werden, weil er morgen schon wieder über Land zieht...“
„Dann war dein Vater in den letzten Tagen gar nicht unterwegs?“, fragte Leonardo.
„Nein. Bei einem der Wagenräder war eine Speiche gebrochen und das wurde erst gestern Abend wieder fertig. Meister Giovanni, ein Tischler aus Empoli musste eigens hier her kommen, denn unser Dorftischler hat es nicht hinbekommen! Mein Vater war vielleicht wütend – vor allem, weil der Dorftischler für seine Bemühungen auch noch Geld verlangt hat!“
„Dann hat dein Vater auch nicht zufällig einem Bettler-Jungen Käse, Brot und Schinken gegeben?“
Carlo war jetzt doch ziemlich verwundert. Er runzelte die Stirn und schüttelte dann energisch den Kopf. „Du kennst doch meinen Vater! Auf jeden Florin achtet der, als wäre es der letzte!“
„...weil man es sonst zu nichts bringt und nie auf einen grünen Zweig kommt“, war jetzt eine tiefe Stimme zu hören. Carlos Vater betrat gerade den Raum. Er trug ein Fass und stellte es zu einer Reihe anderer Fässer. Dann wandte er sich an Leonardo und Carlo. „Unterhaltet euch ruhig weiter über mich, ich räume hier nur noch ein paar Sachen zusammen...“
„Es ging um einen Bettlerjungen, dem mein Vater und ich gestern begegnet sind“, sagte Leonardo. „Sie sind ihm nicht zufällig begegnet?“
Der Händler Maldini schüttelte den Kopf. „Nein, ganz bestimmt nicht! Und ehrlich gesagt halte ich auch nicht viel von Leuten, die nur die Hand aufhalten, etwas von Barmherzigkeit sagen und dann meinen, man müsste in diese Hand etwas hinein tun. Ich arbeite schließlich auch für meinen Lebensunterhalt und den meiner Familie! Und das Geschäft ist hart! Ich hätte für so jemanden nicht mal eine Kupfermünze übrig!“
Da hatte Carlo seinen Vater also genau richtig eingeschätzt. Fragte sich nur, wem Alberto dann begegnet sein mochte. Natürlich gab es noch andere Händler, die zumeist auf dem Weg Richtung Florenz den Weg über Vinci nahmen, aber irgendwie hatte Leonardo jetzt auch den Eindruck gewonnen, dass mit Alberto irgendetwas nicht stimmte.
Maldini wandte sich an seinen Sohn Carlo. „Ich werde übrigens diesmal nicht so lange wegbleiben“, sagte er.
„Warum nicht?“, wollte Carlo wissen.
„Weil ich das Dorf Tarrenta auslassen werde. Dort ist nämlich der Schwarze Tod ausgebrochen. Das hat mir der Tischler erzählt.“
Der Schwarze Tod - so nannte man die Pest. Immer wieder suchte diese verheerende Seuche Städte und Dörfer heim und manchmal wurden ganze Ortschaften von der Krankheit ausgerottet. Niemand wusste, wodurch sie verursacht wurde oder warum sie plötzlich wieder verschwand. Manche sagten, dass ein übler Geruch aus der Erde aufstieg und die Menschen krank werden ließ. Andere hielten die Krankheit für eine Strafe Gottes oder glaubten, dass vergiftete Brunnen die Ursache wären. Man wusste nur, dass sie sehr ansteckend war und von denen, die erkrankt waren, kaum jemand überlebte und das überall, wo sie auftrat zuvor vermehrt Ratten gesehen worden waren.
Allein der Name dieser Krankheit jagte den Menschen schon eisige Schauer über den Rücken.
„Dann mach besser einen sehr großen Bogen um Tarrenta“, sagte Carlo. „Es wäre schrecklich, wenn du dich ansteckst. Und der böse Atem kommt vielleicht auch noch in einiger Entfernung von Tarrenta aus der Erde....“
„Ich werde schon aufpassen“, versprach Maldini. Später zeigte Leonardo seinem Freund Carlo noch die Kopie, die er von dem Papyrus angefertigt hatte. Sie saßen auf dem Boden von Leonardos Zimmer, das im Obergeschoss von Großvaters Haus zu finden war. Der Fensterladen stand offen und ein angenehm kühler Wind blies herein.
„Sieh dir das nur an, Carlo!“, stieß Leonardo voller Begeisterung hervor. „Ist das nicht einmalig?“
„Also für mich sieht das aus wie ein ziemlich großes Durcheinander!“, meinte Carlo. „Zeichen, Bilder, Gebilde, die aussehen, als ob sie eine Mischung aus Zeichen und Bildern sind, Linien, die Kolonnen von Zeichen umranden... Also ich kann darin keinen Sinn erkennen. Und dann diese eigenartigen Tiermänner oder was das da sein soll.“
„So haben die Menschen zur Zeit der Pharaonen geschrieben“, sagte Leonardo.
„Das soll eine Schrift sein? Ich würde sagen, das ist ein Bild von jemandem, der nicht richtig wusste, was er zeichnen sollte und dann hat er ein riesiges Durcheinander angestellt.“
„Der Skizzenblock eines Künstlers?“ Leonardo verzog das Gesicht. „Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, es könnte eine Geschichte sein. Eine Erzählung, in der die Tiermänner eine Rolle spielen und vielleicht Abenteuer erleben... Aber was es auch immer sei, ich bin fest entschlossen, es herauszubekommen. Cosimo de’ Medici wird sich wundern, wenn ich ihm damit komme!“
Carlo war sehr erstaunt. „Cosimo de’ Medici?“ Natürlich war ihm der Name des Stadtherrn von Florenz ein Begriff. Schließlich lebten letztlich auch die Menschen von Vinci unter seiner Herrschaft, denn zur Republik Florenz gehörte nicht nur die Stadt selbst, sondern ein Gebiet, das bis zur Küste reichte und unter anderem auch den wichtigen Hafen Pisa mit einschloss.
Als Leonardo dann davon berichtete, dass er sich mit Cosimo persönlich über alte Schriften unterhalten hatte, konnte Carlo das kaum glauben.
„Leider hat er mir das Original des Papyrus nicht überlassen können“, sagte Leonardo. „Er meinte, es sei zu wertvoll, aber ich habe mich lange gefragt, weshalb ihn das eigentlich daran hindern sollte, es mir mitzugeben? Schließlich hat er doch mehr als genug Geld und wer weiß, vielleicht wäre es noch mehr wert gewesen, wenn er es hätte lesen können... Ich denke, da steckt etwas anderes dahinter.“
„Und was?“, fragte Carlo etwas angestrengt.
„Natürlich seine Verwandtschaft! Cosimo ist doch schon alt und ich glaube, seine zukünftigen Erben machen ihm die Hölle heiß, wenn sie erfahren sollten, dass er Stücke aus seiner Schriftensammlung einfach aus dem Haus gibt!“
„Wer weiß, vielleicht ist das Papyrus nicht einmal echt gewesen“, sagte Carlo. „Das Durcheinander könnte doch jeder hinbekommen. Am Ende hat sich das alles nur irgendjemand ausgedacht, der weiß, dass Cosimo de’ Medici alte Schriften sammelt und viel Geld dafür bezahlt.“