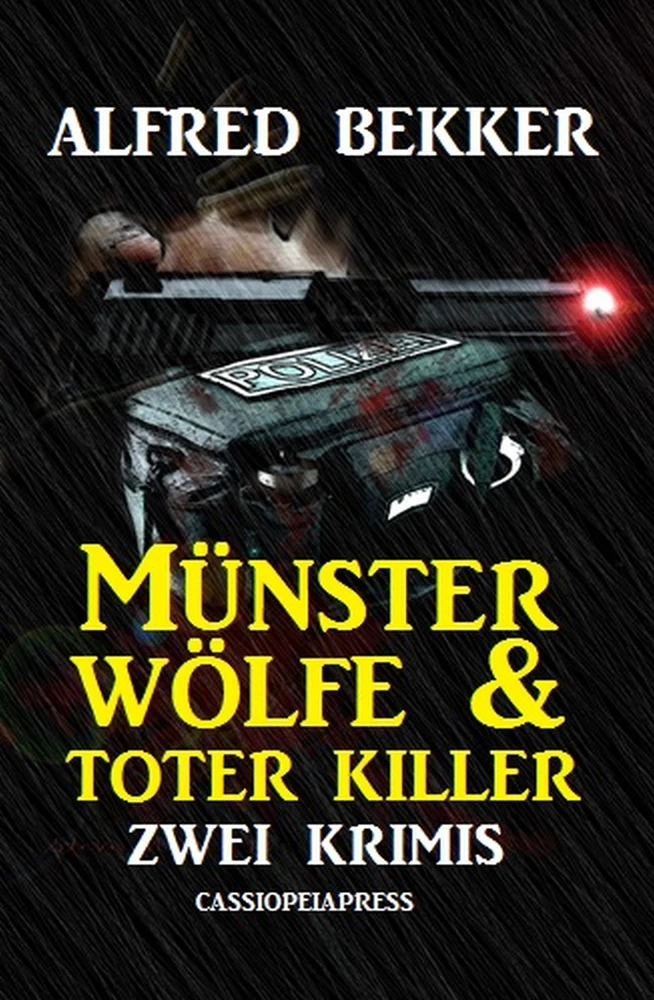Zusammenfassung
Münster-Wölfe
Toter Killer
Zwei Spannungsromane von Alfred Bekker in einem Band.
Tatort: Ein Mietshaus in Münster. Michael Hellmer schreibt unter dem Pseudonym Mike Hell Groschenromane. Ein Stromausfall, der seinen Computer lahmlegt, vernichtet die letzten Seiten seines Western-Romans GNADENLOSE WÖLFE. Ursache ist der Föhn eines Mannes, der bereits seit einer Stunde tot in seiner Badewanne liegt... Damit beginnt für Hellmer eine Kette aberwitziger Verwicklungen. Ein inkompetenter Kommissar verdächtigt ihn und so hat Hellmer bald nur noch eine Wahl: Die Sache selbst aufklären!
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
 |  |

Münster-Wölfe & Toter Killer: Zwei Krimis

von Alfred Bekker
Der Umfang dieses Buchs entspricht 306 Taschenbuchseiten.
Dieses Buch enthält folgende zwei Romane:
Münster-Wölfe
Toter Killer
 |  |

Copyright

Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2015 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
 |  |

Münster-Wölfe

Krimi von Alfred Bekker
Tatort: Ein Mietshaus in Münster. Michael Hellmer schreibt unter dem Pseudonym Mike Hell Groschenromane. Ein Stromausfall, der seinen Computer lahmlegt, vernichtet die letzten Seiten seines Western-Romans GNADENLOSE WÖLFE. Ursache ist der Föhn eines Mannes, der bereits seit einer Stunde tot in seiner Badewanne liegt... Damit beginnt für Hellmer eine Kette aberwitziger Verwicklungen. Ein inkompetenter Kommissar verdächtigt ihn und so hat Hellmer bald nur noch eine Wahl: Die Sache selbst aufklären!
Der Roman „Münster-Wölfe“ erschien auch unter dem Titel „Gnadenlose Wölfe und andere nette Leute“ und war Teil des Sammelwerks „Münsterland-Killer“, sowie „Regio und Mordio“.
 |  |

1

Meine Finger glitten wie von selbst über die leichtgängige Computertastatur. Ein leises Klackern war dabei zu hören und vermischte sich mit dem unablässigen Summen des Ventilators, der meinen Rechner kühl hielt. Der Cursor blinkte auf, rutschte über die Benutzeroberfläche und zog eine Schriftspur hinter sich her.
Ich schrieb:
›Jake McCord kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen, als er die drei Reiter herannahen sah.
Das muss Dickson mit seinen Bluthunden sein!, ging es ihm durch den Kopf.
Er erhob sich von seinem Lagerplatz und nahm noch einen tiefen Schluck aus der mit heißem Kaffee gefüllten Blechtasse.
Die Tasse hielt er mit der Linken, die Rechte glitt unterdessen zur Seite - dorthin, wo der Griff seines 45er Colts aus dem tiefgeschnallten Revolverholster ragte.
Als die drei Reiter näher heran waren, konnte er deutlich Barry Dicksons blasses Gesicht erkennen, das von einem dünnen, schwarzen Bart umrahmt wurde.
Das wird Ärger geben!, dachte McCord.
Doch er ließ sich keineswegs aus der Ruhe bringen und nahm einen weiteren Schluck Kaffee. Indessen waren die Reiter herangekommen. In einer Entfernung von kaum mehr als einem Dutzend Yards zügelten sie ihre Pferde.
McCords Augen begegneten Dicksons kaltem Blick.
"Hatte ich Ihnen nicht gesagt, dass es besser wäre, aus der Gegend zu verschwinden?", zischte Dickson dann, während seine beiden Begleiter ihre Hände zu den Revolvern gleiten ließen.
McCord nickte. "Das hatten Sie gesagt. Aber so leicht bin ich nicht einzuschüchtern!"
"Wenn Sie glauben, dass ich mir von einem Satteltramp wie Ihnen auf der Nase herumtanzen lasse, dann sind Sie schief gewickelt, McCord!"
"Das Gesetz ist auf meiner Seite", erwiderte McCord ruhig. "Und das wissen Sie auch!"
Dickson verzog höhnisch das Gesicht. "Das Gesetz? Ich bin das Gesetz hier in der Gegend!"
McCord ließ den Blick von einem zum anderen schweifen. In den Augen dieser Männer las er den Tod. Seinen Tod. Er sah die Anspannung in den Gesichtern von Dicksons Leuten. Die Hände waren bei den Revolvern, bereit, sie jeden Augenblick zu ziehen. Die Männer warteten nur noch auf ein Zeichen, um loszuschlagen.
Und dieses Zeichen kam schließlich auch. Es war ein kaum merkliches Nicken, mit dem Barry Dickson die Hölle losbrechen ließ.
Die Männer rissen ihre Eisen aus den Holstern. Sie waren schnelle, aber lausige Schützen. McCord zog ebenfalls blitzartig den Revolver und feuerte.
Der Kerl rechts von Dickson schrie auf, als ihm McCords Kugel in die Schulter fuhr, ihn nach hinten riss, und er die Waffe fallen ließ.
McCord warf sich zu Boden, während der Kugelhagel seiner Gegner über ihn hinwegpfiff. Noch im Fallen feuerte er ein zweites Mal und holte damit Barry Dickson aus dem Sattel. Schwer stürzte der Vormann der Morton-Ranch zu Boden und blieb reglos auf dem Rücken liegen. Ein kleines, rotes Loch hatte sich mitten auf seiner Stirn gebildet, während seine Augen starr in den Himmel blickten.
Dicht neben sich fühlte Jake McCord eine Kugel in den Boden einschlagen, die den Sand zu einer kleinen Fontäne aufwirbelte. Er rollte sich herum, riss dann den Revolverlauf empor und jagte dem dritten Kerl eine Kugel mitten in die Brust.‹
Ich lehnte mich zurück und war zufrieden mit mir. Zwanzig Seiten hatte ich heute schon geschrieben, die letzten zehn davon in einem Zug.
Es war einfach so aus mir herausgeflossen. Durch meine Finger hindurch in die Computertastatur.
'Gnadenlose Wölfe' sollte das Werk heißen. Heute Morgen hatte ich nichts weiter als diesen Titel gehabt. 'Gnadenlose Wölfe'! Ich fand, dass das gut klang.
Wenn alles glatt ging, würde ich in einer Woche die 120 Manuskriptseiten in die Tastatur gehackt haben.
In zirka sechs Monaten konnte man es dann aller Voraussicht nach an jedem Kiosk als Romanheft kaufen. Mit einem knalligen Titelbild versehen.
'GNADENLOSE WÖLFE' - Untertitel vielleicht: 'Sie kannten kein Erbarmen - ein neuer, ungewöhnlich faszinierender Roman von MIKE HELL.'
Aber davor hatten der Herrgott und der Redakteur noch ein bisschen Schweiß gesetzt. Seite Zwanzig. Heute war ich gut in Form, und vielleicht würde ich nachher noch einmal zehn Seiten schreiben.
Doch im Augenblick war mir mehr nach einer Tasse Kaffee.
Ich wollte gerade den Text sichern, da wurde der Bildschirm plötzlich dunkel.
Auch das Licht war ausgegangen.
Ein Kurzschluss! Ich fluchte innerlich. Die letzten fünf Seiten waren nicht gesichert gewesen und damit unwiederbringlich verloren.
Wahrscheinlich war es wieder der defekte Föhn von dem Kerl, der die Wohnung eine Treppe höher bewohnte.
Es war immer dasselbe. Der Kerl benutzte das Gerät, und wenn ich Pech hatte, sprang die Hauptsicherung raus.
Das Leitungsnetz in diesem Haus war völlig veraltet. Baujahr irgendwann vor dem Krieg oder kurz danach. Eigentlich hätten hier alle Leitungen herausgerissen und erneuert werden müssen. Abends, wenn die Fernseher nach und nach angingen, wurde es immer besonders kritisch.
Am besten ließ sich zwischen Mitternacht und Frühstück arbeiten. Dann war man relativ sicher davor, dass der Strom auf einmal weg war. Nur weil zwei Dutzend Idioten plötzlich alle gleichzeitig ihre sämtlichen elektrischen Geräte anstellen mussten. Und selbst der Typ mit dem kaputten Föhn trocknete sich dann seltener die Haare.
Ich war sauer.
Der blöde Kerl über mir - vorausgesetzt mein Zorn traf ihn in diesem Fall zu Recht - hatte mir fünf Seiten vernichtet.
Beim nächsten Mal sollte ich ihn auf Schadensersatz verklagen!, dachte ich.
Diese Seiten waren schließlich bares Geld für mich gewesen!
Andererseits war der Kerl aber selbst offensichtlich zu geizig, um sich endlich einen neuen Föhn zu besorgen, der sich mit der Hauptsicherung besser vertrug!
Ich atmete tief durch. So lange ich in diesem Haus lebte, würde ich mich mit diesen Zuständen abfinden müssen.
Ich knipste Bildschirm und Zentraleinheit des Computers off, damit - wenn die Sicherung wieder eingeschaltet war - der Strom nicht mit voller Wucht in die Geräte schlug. Das soll nämlich schädlich sein.
Dann erhob ich mich und überlegte einen Moment, was ich tun sollte.
Es gab mehrere Möglichkeiten.
Ich konnte in den Keller gehen, um die Sicherung wieder einzuschalten.
Ich konnte aber auch abwarten, bis einer der anderen Hausbewohner in den Keller ging, um die Sicherung wieder einzuschalten.
Ich sah auf die Uhr. Genau 17.30 Uhr.
Das bedeutete, dass schon eine ganze Reihe von Leuten zu Hause war, vor dem Fernseher saß, Radio hörte und so weiter. Meine Chancen, mich nicht selber aufmachen zu müssen, weil sich jemand anders durch den stromlosen Zustand noch mehr genervt fühlte als ich, standen also gar nicht so schlecht.
Ich ging in die Küche.
Da stand noch Kaffee in der Maschine. Die war natürlich auch ohne Strom, also war klar, dass der Kaffee bald kalt sein würde. So entschloss ich mich, mir erst einmal eine Tasse einzuschenken und abzuwarten.
Draußen, vom Treppenhaus her, hörte ich Geräusche und Stimmen. Da hatte sich also tatsächlich jemand in den Keller aufgemacht, genau wie ich vermutet hatte.
Ich schlürfte meinen Kaffee und wartete ab.
Dann war plötzlich wieder Strom da. Das Licht ging an, das Kontrolllämpchen der Kaffeemaschine leuchtete wieder, und das Radio in der Küche, das ich abzuschalten vergessen hatte, murmelte vor sich hin.
Doch das währte keine zwei Sekunden.
Dann war es schon wieder vorbei. Der Strom war erneut weg, was nur daran liegen konnte, dass der Kurzschluss immer noch bestand.
Wahrscheinlich hat dieser Idiot seinen Haartrockner einfach wieder eingeschaltet und versucht, sich zu Ende zu föhnen!, dachte ich grimmig.
Er war ein Ignorant.
Ich hatte ihn schon einmal wegen dieses verdammten Föhns angesprochen, aber er meinte, es liege an meinem Computer. Der ziehe zuviel Strom, und deshalb könne das Leitungsnetz seinen Föhn nicht verkraften. So ein Blödsinn!
Ich glaube, ich muss nicht besonders betonen, dass ich ihn nicht leiden kann. Wie sollte es anders sein, da er mir ja schließlich in mehr oder minder regelmäßigen Abständen Geld stahl.
Nein, pardon, ›stahl‹ ist nicht richtig ausgedrückt. Er vernichtete es. Er vernichtete Geld - und dummerweise gehörte dieses Geld mir.
›Zur Hölle mit ihm!‹, oder so etwas in der Art hätte Jake McCord aus GNADENLOSE WÖLFE, diesem ungewöhnlich spannenden, wenn auch noch ziemlich unfertigen Western-Roman, in einem solchen Fall gesagt! ›Zur Hölle mit ihm ...‹ Wenn ich in jenem Augenblick gewusst hätte, dass er sich dort vielleicht schon befand ...
Aber es ist müßig, über solche Dinge nachzudenken.
Wieder kam für einen Augenblick Strom durch die Leitungen, der abermals sofort versiegte. Irgendjemand hatte es also ein zweites Mal versucht. Und ebenso erfolglos.
Ich trank meinen Kaffee aus.
Wie es aussah, würde ich mich doch selbst um die Sache kümmern müssen, wenn ich heute noch eine Seite in die Tasten bringen wollte!
Verdammt, ich war so gut drin gewesen, und dann das!
Die Probleme von Jake McCord lösten sich auf Seite 120, das war von vorn herein klar. Meine eigenen Probleme musste ich selbst meistern.
Kein gottgleicher Autor löste sie für mich in Wohlgefallen und einem Happy-End inklusive einem schönen Mädchen und dem Ende aller Schurken auf!
Ich ging in den Flur, öffnete meine Wohnungstür und trat hinaus ins Treppenhaus.
Von unten hörte ich Stimmen.
Es waren Frauenstimmen, und zwar mindestens zwei.
Sie kamen aus dem Keller die Treppe herauf und hatten wohl eingesehen, dass es so einfach, wie sie gedacht hatten, nicht war.
Indessen schloss ich sorgfältig die Tür hinter mir ab. Auch wenn man nur kurz aus der Wohnung ist, sollte man das tun. Es ist hier schon passiert, dass jemand nur den Mülleimer hinausgebracht hat, ohne abzuschließen, und dann das Familiensilber vermisste.
Ich warf einen Blick hinunter zu den Frauen.
Aber auch von oben kam jemand. Und auch das war eine Frau, das hörte ich an den Schuhen.
Ich wirbelte herum und blickte in ein fein geschnittenes, von dunkelbraunen Haaren umrahmtes Gesicht mit grüngrauen Augen. Ich schätzte sie auf Anfang zwanzig.
Sie war hübsch, aber das war nicht der Hauptgrund, weshalb mein Blick an ihr haften blieb.
Für einen kurzen Moment sahen wir uns an.
Sie strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Eine Sekunde lang blieb sie stehen und trat dann an mir vorbei. Sie wirkte irgendwie gehetzt, so als sei ihr jemand auf den Fersen. Aber ein kurzer Blick die Treppe hinauf sagte mir, dass dort niemand war.
"Hey!", rief ich ihr hinterher.
Sie blieb auf dem Absatz stehen, atmete tief durch und drehte sich dann zu mir herum. Es lag auf der Hand, dass sie nur aus der Wohnung jenes Mannes kommen konnte, dessen verfluchter Föhn vermutlich dafür verantwortlich war, dass ich jetzt hier im Treppenhaus stand, anstatt an den Tasten zu sitzen!
"Was ist?", rief sie ziemlich außer Atem.
Als sich unsere Blicke begegneten, wusste ich, dass sie Angst hatte. Schweiß stand ihr auf der Stirn, und ich konnte mir bei ihrer sportlichen Figur einfach nicht vorstellen, dass dieser durch die paar Stufen bis zum Absatz entstanden war.
Und für eine Herzkranke hatte sie einfach noch nicht das richtige Alter.
Ich deutete mit dem Daumen hinauf zur Wohnung meines Intimfeindes, der mit Vorliebe das Geld eines armen Romanschreibers vernichtete.
"Hat er sich wieder die Haare gewaschen?"
"Wer?"
Sie schien wirklich nicht zu begreifen. Ihre Augen verengten sich ein wenig.
"Na, der Kerl, der da oben wohnt. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber sein Föhn ..."
"Föhn?"
Das Wort schien etwas in ihr auszulösen. Ich begriff noch nicht, was. Später sollte es mir klarer werden. "Was wollen Sie eigentlich?", meinte sie dann etwas unwirsch.
"Ich wollte nur wissen, ob er zu Hause ist!", erwiderte ich dann. Wenn nicht, konnte er auch logischerweise nicht seinen Föhn eingeschaltet haben, und dann musste der Stromausfall durch etwas anderes verursacht worden sein.
"Was weiß ich ..." murmelte sie, dann wandte sie sich um und rannte weiter. Sie hastete die Treppen hinunter, als ob buchstäblich der Teufel hinter ihr her sei.
Ich verzog das Gesicht.
Der Kerl mit dem Föhn − dessen Name mir nicht einmal mehr einfallen wollte − war sicher ein Ekel. Wen wunderte es schon, wenn jemand Reißaus vor ihm nahm? Mich jedenfalls nicht.
Eine Viertelstunde später sollte mich überhaupt nichts mehr wundern!
 |  |

2

Unterdessen kamen die Frauen von unten zu mir herauf. Der davoneilenden Schönen warfen sie einen kurzen, kritischen Blick hinterher.
Dann waren sie bei mir angelangt.
Ich kannte sie flüchtig und wusste, dass sie in der Wohnung unter mir wohnten. Sie hießen beide Meyer und waren Mutter und Tochter. Meyer mit Ypsilon, so stand es an ihrer Wohnungstür, an der ich zwangsläufig vorbeikam, wenn ich hinunter zur Straße wollte.
Die Mutter war klein, gedrungen und ziemlich dick. Deshalb schnaufte sie jetzt auch gut hörbar. Sie pfiff wie eine Dampflok. Aber das war kein Wunder.
Ich hätte auch so gepfiffen, hätte ich ihr Gewicht die vielen Stufen hinaufschleppen müssen.
Die Tochter war schon fast dreißig und hatte immer noch Akne. Ihr selbst gemachter Kurzhaarschnitt stand ihr nicht besonders. Zudem waren ihre Haare eigentlich immer fettig und ungewaschen, wenn sie mir begegnete.
Ich weiß nicht, ob meine Begegnungen mit ihr repräsentativ für ihr äußeres Erscheinungsbild waren, aber ich denke schon.
Die beiden machten unzufriedene Gesichter. Bei der Tochter war das eigentlich immer so. Es war gewissermaßen ihr Markenzeichen.
Aber die Mutter war sonst immer ganz fröhlich, besonders wenn sie in der Pizzeria gewesen war und man ihr dann auf der Treppe mit einem Turm von Schachteln vor der Brust begegnete. Irgendwoher mussten die Pfunde ja auch schließlich kommen, die sie sich angefressen hatte.
"Es wird wieder der Kerl mit dem defekten Föhn sein!", meinte die Tochter, während sie auf ihrem Kaugummi kaute.
Fehlte nur noch, dass sie eine Blase machte, aber dazu war sie dann doch vielleicht schon etwas zu erwachsen.
Selbst sie.
Trotzdem, wenn ich sie sah, fragte ich mich immer, ob es so etwas wie lebenslange Pubertät geben konnte.
"Jedenfalls haben wir nichts gemacht, was den Kurzen verursacht haben könnte", fügte die Mutter hinzu. Sie setzte trotz ihres Ärgers jetzt ein überaus freundliches Gesicht auf und meinte dann: "Machen Sie das?"
"Was?"
"Dem Kerl Bescheid stoßen! Sie sind schließlich ein Mann!"
"Was hat das damit zu tun?"
"Naja, der da oben ist doch immer so unfreundlich. Und wenn man ihn mal trifft, dann grüßt er einen noch nicht einmal!"
Ich vollführte eine hilflose Geste. Das war nun wirklich nicht das Schlimmste an ihm! Und wenn man es genau nahm, dann grüßte sich in diesem Haus ohnehin fast niemand. In dem Punkt unterschied er sich kaum von den anderen Bewohnern.
"Wir hatten schon ein paar Begegnungen der unerfreulichen Art", meinte ich. "Ich fürchte, er reagiert auf mich allergisch ..."
"Nicht allergischer als auf den ganzen Rest der Menschheit", murmelte die pickelige Tochter und drückte dabei völlig ungeniert an einer ihrer unappetitlichen Eiterbeulen herum.
Wir gingen also die Treppe zu seiner Wohnung hinauf.
Ich wusste, dass es darauf hinauslaufen würde, dass ich dem guten Mann klarmachen musste, sich endlich einen neuen Föhn zu kaufen. Die beiden Frauen trauten sich nicht, den Kotzbrocken anzusprechen.
Bei der Mutter war mir das plausibel. Ihre ganze Art war eher zurückhaltend.
Aber bei der Tochter verstand ich das nicht. Ich wusste nämlich zufällig, dass sie ziemlich laut schreien konnte, um ihre Interessen durchzusetzen. Doch das galt anscheinend nur im Umgang mit ihrer Mutter, die wirklich keinen einfachen Stand ihr gegenüber hatte. Ansonsten spielte sie den verschüchterten Hasen.
Am liebsten hätte ich ihr in diesem Augenblick vorgeschlagen: ›Schrei den Kerl von oben doch nur einmal so an, wie du das bei deiner Mutter schaffst − wahrscheinlich hätten wir dann für ein Jahr Ruhe!‹
Aber ich verkniff es mir.
Dann waren wir oben, vor seiner Tür.
Ich warf erst einmal einen Blick auf das Namensschild an der Klingel. Er hieß Jürgen Lammers. Irgendwo in einem hinteren Winkel meines Gedächtnisses schien sich etwas zu regen. Ich kannte diesen Namen irgendwoher, aber er wäre mir jetzt nicht mehr eingefallen.
"Na, los!", sagte die Mutter und drückte auch schon auf die Klingel.
"Klopfen Sie lieber", riet ich ihr. Die gute Frau hatte wohl vergessen, dass wir gegenwärtig keinen Strom hatten und Jürgen Lammers schon aus diesem Grund nichts von der Klingelei hören konnte.
"Häh?", meinte sie, und so klopfte ich selber, anstatt darauf zu warten, dass sie es begriff.
Ich erwartete, dass er jetzt jeden Moment aufmachte, wahrscheinlich in seinem speckigen Jogging-Anzug, der den Bierbauch besonders gut zur Geltung brachte. Ich erwartete, in seine böse blitzenden Augen zu blicken, die in dem grobschlächtigen Gesicht mit der dicken Nase, den dunklen Augenbrauen und den knorrigen Wangen einen überaus passenden Platz hatten.
Aber nichts dergleichen geschah.
Jürgen Lammers machte nicht auf, und ich klopfte noch einmal, diesmal schon deutlich ungeduldiger.
Und dabei gab die Tür plötzlich nach. Offenbar war sie nur angelehnt gewesen.
"Wenn die Tür offen ist, wird er ja wohl zu Hause sein", meinte die Tochter.
Ich nickte, öffnete dabei die Tür vollends und trat zögernd ein.
Die beiden Frauen folgten mir, und dann staunten wir alle drei erst einmal über das außergewöhnliche Chaos, das sich uns bot.
Mein erster spontaner Gedanke war, hier hat jemand das Unterste zuoberst gekehrt! Aber dann schalt ich mich einen Narren. Dies ist kein Roman!, sagte ich mir. Dies ist die Wirklichkeit.
Und in Wirklichkeit war die Ursache für eine chaotische Wohnung meistens die, dass der Inhaber nicht aufgeräumt hatte. Ich kannte das aus eigener, leidvoller Erfahrung.
Hinter mir hörte ich die Mutter aufatmen, während wir alle den Blick zu Boden gerichtet hatten, verzweifelt auf der Suche nach freien Stellen, auf die man die Füße setzen konnte. Die Kleidung, die man an sich an der Garderobe vermutet hätte, bedeckte den Fußboden des kleinen Flures. Die Schubladen der Kommode waren herausgerissen und ausgeleert.
Als wir schließlich ins Wohnzimmer kamen, sah es dort ebenso schlimm aus.
"Das ist nicht normal!", meinte die Mutter. "Hier ist etwas passiert. Vielleicht ein Einbruch ..."
Die pickelige Tochter verzog das Gesicht zu einer Grimasse. "Einbruch? Mama!", meinte sie dann spöttisch. Sie zuckte mit den Schultern und machte eine ziemlich herablassende Geste. "Die Tür war unversehrt! Wie soll der Dieb gekommen sein? Durch das Fenster vielleicht? Warum nicht. Mit einer Bergsteigerausrüstung an der Fassade hoch bis in den fünften Stock! Dann durch das Fenster und alles durchwühlen und schließlich auf demselben Weg wieder hinaus − natürlich nicht, ohne das Fenster zuvor von innen wieder sorgfältig zu schließen! Und selbstverständlich hat der Einbrecher dann noch absichtlich einen Kurzschluss verursacht, um uns alle zu ärgern!"
Sie kam sich sehr scharfsinnig vor, aber ihrer Mutter war das Ganze eher peinlich. Das war nicht zu übersehen.
Ich achtete nicht weiter auf das Gerede der beiden, sondern sah mich stattdessen lieber ein bisschen um.
Zwei Minuten später hörte ich plötzlich einen markerschütternden Schrei − einen Schrei, der selbst für die darin ansonsten recht geübte pickelige Tochter erstaunlich war.
Sie war ins Bad gegangen und hatte dort offenbar etwas entdeckt − oder war vielleicht auch einfach nur ausgerutscht. Ich traute ihr das Letztere zu. Besonders geschickt war sie nämlich nicht.
Jedenfalls beeilte ich mich, nach ihr zu sehen.
Die Mutter schnaufte hinter mir her.
Die Tatsache, dass kein zweiter Schrei folgte, legte ich für mich so aus, dass sie sich nichts Ernstes angetan hatte.
Einen Augenblick später sah ich sie mit offenem Mund und starr vor Schreck auf die Badewanne blicken.
In der bis über den Rand gefüllten Wanne lag ein Mann, den wir alle immerhin gut genug kannten, um ihn identifizieren zu können. Es war Jürgen Lammers, und bezeichnenderweise trug er auch jetzt seinen geschmacklosen Jogging-Anzug, der den runden Bierbauch stramm umspannte.
Seine Augen waren so giftig, wie sie es immer schon gewesen waren, aber diesmal hatten sie wahrlich Grund dazu, so zu schauen.
Lammers war nämlich mausetot.
Und dann sah ich auch die Ursache für den Kurzschluss.
Es war tatsächlich der Föhn, wie wir alle vermutet hatten. Jürgen Lammers musste ziemlich schlecht beraten gewesen sein, als er den defekten Apparat mit in die Wanne genommen hatte ...
"Mein Gott!", stieß die dicke Mutter hervor und schlug dann die Hände vor ihren offenen Mund. Sie schüttelte anschließend stumm den Kopf.
"Wir werden die Polizei rufen müssen", murmelte ich.
In meinen Romanen gibt es alle paar Seiten eine Leiche, aber dies war die Wirklichkeit. Und die ist dann doch ein bisschen anders.
"Mein Gott, wie furchtbar!", seufzte die dicke Mutter noch einmal aus tiefster Seele.
"Rühren Sie nichts an!", meinte ich.
"Wieso?"
"Damit keine Spuren verloren gehen!"
"Es ist doch Selbstmord, oder?"
"Das weiß ich nicht. Aber ich denke, die Polizei wird das herausbekommen − vorausgesetzt, wir lassen ihr die Chance dazu und bringen nicht alles durcheinander."
Irgendwie klang das seltsam angesichts der zerwühlten Wohnung. Was sollte da noch durcheinander zu bringen sein? Eine Fehlleistung von mir, ganz klar. Und eine Sekunde, nachdem dieser Schwachsinn über meine Lippen gegangen war, wurde es mir auch bewusst.
Aber wer wägt in einer solchen Situation schon so genau seine Worte ab? Nicht einmal ein Autor. Und ein Autor von Western-Romanen tut es sowieso nie.
Ich verließ also das Bad und suchte im Wohnzimmer nach dem Telefon, das sich zunächst einfach nicht auftreiben lassen wollte.
Die beiden Frauen harrten indessen in andächtiger Stille bei Lammers Leiche aus.
Schließlich fand ich das Telefon unter dem Sofa, aber die Schnur war herausgerissen.
Ich fluchte innerlich. Hier hatte jemand wirklich ganze Arbeit geleistet!
Mein Blick glitt über das Durcheinander, das auf mich jetzt wie ein völlig überladenes Stillleben wirkte.
Nein, je länger ich die Sache betrachtete, desto unwahrscheinlicher schien es mir, dass Lammers für dieses Chaos selbst verantwortlich war.
Hier hatte entweder einer gezielt etwas gesucht − und war dann vom Besitzer dieser Räuberhöhle überrascht worden. Oder jemand hatte einen Einbruch vorzutäuschen versucht, um die Polizei bei der Suche nach dem Mörder auf die falsche Spur zu locken.
Und um Mord handelte es sich meiner Ansicht nach.
Lammers war zwar ein ziemlich begriffsstutziger Kerl gewesen, aber dass er freiwillig in voller Bekleidung in eine Badewanne stieg und dann auch noch so bescheuert war, den Föhn mit ins Wasser zu nehmen − das mochte ich einfach nicht so recht glauben. Es erschien mir zu unwahrscheinlich.
Kein Redakteur hätte mir so etwas durchgehen lassen, wenn ich auf die Idee gekommen wäre, es in einem der Kurz-Krimis zu bringen, die ich hin und wieder für Illustrierte fabriziere. Es war einfach zu absurd.
Blieb also nur Mord.
In meinem Kopf wirbelten die Gedanken durcheinander, während ich die Lammers-Wohnung verließ, die Treppe hinunter eilte, um dann zu meinem eigenen Telefon zu gelangen.
Ich nahm den Hörer ab und hatte ein paar Augenblicke später einen tranig klingenden Beamten an der Strippe, der alles andere als einen besonders aufgeweckten Eindruck machte.
Aber schließlich konnte ich ihm doch klarmachen, was los war. Die Trantüte auf der anderen Seite der Leitung brauchte dann eine halbe Ewigkeit, um meine Personalien aufzunehmen. Ich war froh, als der Hörer wieder in der Gabel hing.
Ich atmete tief durch.
Und dann fiel mir wieder die junge Frau im Treppenhaus ein, die an mir vorbei gerannt war, als ob der Teufel hinter ihr her gewesen sei.
Vielleicht war ja auch genau das der Fall gewesen, wer konnte das schon sagen? Vielleicht hatte sie Angst vor Lammers bösem Geist gehabt (wofür ich Verständnis gehabt hätte); vielleicht konnte sie auch einfach keine Leichen sehen (vorausgesetzt, sie war auch in der Wohnung gewesen).
Vielleicht war sie auch seine Mörderin ...
Nachdenklich ging ich wieder hinauf. Ich sah mir die Tür genauer an, die zu Lammers Wohnung führte.
Kein Kratzer. Nicht die geringsten Spuren irgendeiner Manipulation − von Gewalteinwirkung gar nicht zu reden.
In diesem Augenblick hätte es mich brennend interessiert, ob Lammers noch am Leben gewesen war, als ihm die Schöne mit den grüngrauen Augen einen Besuch abgestattet hatte. Lammers schien mir nicht der Typ Mann zu sein, auf den die Frauen nur so fliegen. Aber der äußere Schein mochte ja durchaus trügen.
Vielleicht hatte er unter seiner ätzenden Fassade noch irgendwelche besonderen Qualitäten verborgen, die diese Frau dazu gebracht hatten, sich mit ihm abzugeben.
Aber, halt!, sagte ich mir eindringlich, du gehst jetzt schon entschieden ein Stück zu weit! Ist wohl eine Berufskrankheit.
Eins, zwei, drei, und es ist gleich eine Story aus ein paar dürftigen Versatzstücken gezimmert. So arbeitet mein Gehirn eben.
Und das hat auch sein Gutes! Es muss so sein, sonst würde ich längst am Hungertuch nagen und selbst die Miete für diese schäbige Wohnung nicht mehr aufbringen können!
Andererseits − falls sich bestätigte, dass dies ein Mordfall war, war die Schöne natürlich eine Verdächtige ersten Ranges!
Als ich ins Wohnzimmer kam, traf ich dort auf die beiden Frauen, die inzwischen offenbar genug davon hatten, den toten Lammers anzustarren. So schön war er ja auch wirklich nicht anzusehen. Weder im Leben, noch im Tode.
"Kommt die Polizei?", fragte die Mutter.
Ich nickte. "Ja. Sie schicken jemanden."
"So etwas hat es hier noch nie gegeben", meinte die Mutter. "Vor zwei Jahren wurde in der Disco im Erdgeschoss mal eingebrochen. Und die Bombendrohung vor zwei Monaten, die haben Sie ja auch mitgekriegt. Ich weiß noch, wie wir alle mitten in der Nacht auf die Straße mussten. Ich habe auch den Rest der Nacht kaum ein Auge zumachen können, obwohl ich doch am nächsten Morgen wieder früh raus musste ..."
Ich hatte von dieser Sache gehört, war aber keineswegs dabei gewesen. Vor zwei Monaten hatte ich mich unter spanischer Sonne im Urlaub befunden. Aber das sagte ich ihr nicht.
Es spielte keine Rolle, und ich hatte auch wenig Lust dazu, diese Sache länger als unbedingt notwendig zu diskutieren.
Ich murmelte irgendetwas Zustimmendes. Aus Höflichkeit.
"Wir könnten wenigstens den Föhn aus der Steckdose ziehen, damit wir endlich wieder Strom bekommen!", nörgelte indessen die Tochter.
"Davon würde ich abraten. Wir sollten wirklich alles so lassen, wie es ist!", meinte ich dazu.
"Woher wissen Sie soviel über diese Dinge?", meldete sich die Mutter wieder zu Wort.
Ich verzog das Gesicht. "Ich sehe mir immer den 'Tatort' im Fernsehen an!"
"Im Ernst?"
"Ja."
Manche Menschen beruhigen sich dadurch, dass sie unablässig Worte produzieren. Bei anderen wirkt genau das Gegenteil. Die dicke Mutter gehörte leider zur ersten Gruppe.
"Das Ganze erinnert mich an diesen Politiker. Wie war doch noch mal der Name ...? Der, der sich auch in einer Badewanne umgebracht hat! Ich denke, das hier war auch Selbstmord."
Ich ließ den Blick umherschweifen. "Einen Abschiedsbrief habe ich nicht gesehen", erwiderte ich sachlich.
"Muss es denn einen geben?" Die Mutter machte eine unbestimmte Geste und holte dann tief Luft. Das gab immer ein besonderes, unnachahmliches Geräusch. Eines, an dem man sie mit hundertprozentiger Sicherheit akustisch identifizieren konnte.
Ich zuckte mit den Schultern. "Ich will nicht ausschließen, dass es auch Leute gibt, die sich ohne Abschiedsbrief umbringen!"
"Ja, so wie der Politiker! Der lag auch angezogen in einer Wanne. Allerdings hatte er vorher Tabletten geschluckt. Ein Föhn spielte dabei keine Rolle."
"Und warum sollte Lammers das gemacht haben?"
"Vielleicht war er einfach verzweifelt!", meinte die Tochter, und ich dachte, wenn ich so ein Gesicht hätte, wäre ich auch verzweifelt. Und wenn sie mit mir in einer Wohnung gewohnt hätte, noch viel mehr. Und wenn sich alle Verzweifelten dieser Welt wirklich umbringen würden, dann wären diese beiden Frauen kaum noch am Leben.
"Warum sollte er verzweifelt gewesen sein?", murmelte ich schulterzuckend.
"Vielleicht war er unheilbar krank!", meinte die Tochter. "Manche Leute drehen dann durch. Ich habe neulich noch einen Fernsehfilm darüber gesehen."
"Sie haben doch auch diese Frau gesehen ..." ließ ich dann einen Versuchsballon aufsteigen.
Die beiden sahen mich an. "Welche Frau?", fragte die Tochter vorlaut.
Oh, Mann!, dachte ich. Blind ist sie auch noch! Welch ein Schicksal! "Ich meine die Frau, die von oben gekommen ist und so fluchtartig davonrannte."
"Ja, richtig ..." sagte die Mutter gedehnt. "Und Sie meinen, dass sie hier bei Lammers war?"
"Woher sollte sie sonst gekommen sein? Hier oben ist doch nur diese eine Wohnung. Und die Tür stand offen."
"Ja, das stimmt."
"Haben Sie diese Frau schon einmal gesehen?"
"Nein!", sagte die Mutter.
"Nein!", grunzte die Tochter.
Sie schüttelten beide den Kopf, die pickelige Tochter etwas heftiger als ihre Mutter − vielleicht deswegen, weil die Mutter ihre Wasserwelle nicht durcheinanderbringen wollte. Die Tochter konnte ihren Kurzhaarschnitt so doll schütteln, wie sie wollte. Er sah immer gleich schlecht aus.
"Und Sie?", fragte die Mutter an mich gewandt.
"Was ist mit mir?"
"Kennen Sie vielleicht diese Frau?"
"Nein. Und es wundert mich ehrlich gesagt, dass es diesem Ekel gelungen ist, so eine Lady für sich zu interessieren!" Ich seufzte. "Mannomann, da komme ich einfach nicht drüber hinweg!"
"Er ist tot!", meinte die Tochter tadelnd.
Das durfte ja nicht wahr sein! Jetzt machte sie auch noch einen auf Pietät! Das passte nun wirklich nicht zu ihr! Absolut nicht!
MEGAunpassend sozusagen.
Aber was passte denn überhaupt schon zu ihr? Mir fiel da spontan nichts ein.
Vielleicht irrte ich da aber auch, und es war genau umgekehrt: Sie selbst war es, die ihrerseits zu nichts und niemandem passte!
Eine andere Möglichkeit war, dass ich sie einfach nicht leiden konnte. Schlechte Schwingungen, neudeutsch: bad vibrations. Ein übelriechendes Karma. Man kann das nennen, wie man will, es läuft immer auf dasselbe hinaus.
"Er ist tot", bestätigte ich mit einem dünnen Lächeln. "Aber das ändert doch nichts daran, dass er ein Kotzbrocken war!"
"Trotzdem", meinte die Tochter.
"... und bei einem solchen Ekelpaket gibt es vermutlich jede Menge Leute, die ihn lieber heute als morgen aus dem Weg haben würden", fuhr ich fort.
Die Tochter kratzte sich wieder an einem ihrer zahllosen Pickel. Und jetzt war mir auch klar, warum es immer mehr wurden und die Vorhandenen nicht abheilen konnten, sondern sich nicht selten zu üblen Geschwüren auswuchsen.
Sie kratzte und drückte halt gerne dran. Was ließ sich auch sonst schon mit Pickeln anfangen? Und sie − als geborene Kratzbürste ...
"Es ist doch schon erstaunlich", meinte die Mutter.
Ich hob die Augenbrauen. "Was ist erstaunlich?", fragte ich.
"Dass wir hier zusammenleben, ohne etwas voneinander zu wissen!" Sie hob die Hände zu einer hilflosen Geste. "Das ist doch furchtbar, finden Sie nicht?"
Ich nickte leicht, obwohl ich ihre Meinung nicht unbedingt teilte. Ich empfand die Anonymität, die hier herrschte, nicht als unangenehm.
Vielleicht hatte ich sie sogar gesucht.
Niemand, der sich dauernd in irgendwelche Privatangelegenheiten einmischte. Niemand, der sich dafür interessierte, was man tat oder ließ, ob man Besuch über Nacht hatte und welcher politischen Partei man zuzurechnen war, oder ob man gar nicht wählte.
Aber wenn man dann starb, so wie Jürgen Lammers, wusste natürlich auch niemand, weshalb das geschehen war. Ich glaubte nicht an Selbstmord, von Anfang an nicht, aber angenommen, es wäre Selbstmord gewesen ...
Angenommen, Jürgen Lammers litt tatsächlich an einer unheilbaren Krankheit, oder seine Freundin hatte ihn verlassen (wobei ich mir nicht vorstellen konnte, dass er eine hatte), oder ihm war gekündigt worden, und er hatte sich anschließend nach allen Regeln der Kunst umgebracht ...
Wäre da nicht dieser verfluchte Föhn gewesen, der uns alle zu seinen Geiseln machte, selbst jetzt noch, da er tot war − er hätte wochenlang in seiner Räuberhöhle vor sich hinfaulen können, ohne dass irgendjemand das zur Kenntnis genommen hätte. Die Miete wäre automatisch von seinem Konto abgebucht worden ... Vielleicht hätte sich sein Arbeitgeber eines Tages um sein Verbleiben gekümmert.
Vorausgesetzt, es gab überhaupt einen Arbeitgeber.
Auch das wusste ich nicht. Ich hatte keine Ahnung, woher er sein Geld bekam. Ich wusste noch nicht einmal, ob er regelmäßig aus dem Haus ging, um irgendeiner Tätigkeit nachzugehen − und mochte sie auch nur darin bestehen, im Stehcafe zu frühstücken.
Das Einzige, was sicher zu sein schien, war, dass er sich regelmäßig sein schütteres Haar geföhnt hatte!
Verdammt noch mal, das war wirklich eine feste Größe in seinem und unser aller Leben gewesen! Aus den Seiten, die er mir zerstört hatte, konnte man sicher einen ganzen Roman zusammenstellen!
 |  |

3

Es dauerte noch eine geschlagene Viertelstunde, bis die Polizei in Gestalt von zwei Männern auftauchte, die mich unwillkürlich an Dick und Doof erinnerten.
Dick war wohl der Boss hier und stellte sich mit "Rehfeld, Mordkommission!" vor. Irgendwie schien er nicht besonders gute Laune zu haben. Keine Ahnung, welche Laus ihm über die Leber gelaufen war.
Doof sagte erst einmal gar nichts und dackelte mit eingezogenen Schultern hinter seinem Herrn und Meister her. Er hätte auch größte Schwierigkeiten gehabt, etwas über die Lippen zu bringen, denn er kaute auf irgendetwas herum. Erdnüsse, schätzte ich, denn nach einem schwachen Händedruck hatte ich Öl und Salz an den Fingern.
Dann hielt er mir wortlos seinen Ausweis unter die Nase.
Und dort konnte ich es dann schwarz auf weiß lesen: Doof hieß Lehmann.
Lehmann trug ein preiswertes Polyester-Longjackett, in dessen rechter Tasche er genug Platz für seinen Erdnuss-Vorrat hatte. Im Ganzen wirkte er wie ein ausgehungerter Schimanski-Verschnitt. Er war dürr und schlaksig, wenn auch zwei Köpfe länger als ich.
Seine Körperhaltung gab ihm die Gestalt eines Fragezeichens. Nur nicht zu tief Luft holen!, dachte ich. Sonst bläst es ihn um!
Bei dem dicken Rehfeld bestand da keinerlei Gefahr. Er war kugelrund und trug einen Mantel, bei dem er nur hoffen konnte, dass Regen und Wind immer von hinten kamen, denn es war einfach undenkbar, dass es ihm jemals gelingen konnte, die Knopfreihe zu schließen.
Rehfeld ging ins Bad, nachdem ihn die beiden Frauen darüber aufgeklärt hatten, dass dort die eigentliche Musik spielte.
Lehmann musterte uns einen nach dem anderen mit seinen verschlafenen Augen.
Dann nahm er noch eine weitere Handvoll Erdnüsse aus der Jackentasche heraus und stopfte sie ziemlich ungeschickt in den Mund, so dass ihm ein halbes Dutzend davon auf den Boden fiel.
Er grunzte ärgerlich und mit vollem Mund, wobei ihm um ein Haar noch etwas herausgefallen wäre. Dann dackelte er erneut hinter seinem dicken Herrn und Meister her, diesmal ins Bad. Ich folgte den beiden. Die Frauen schienen ihrerseits genug von Lammers Anblick zu haben. Sie hatten ihn ja schließlich auch lange genug angestiert.
"Schlimm, schlimm", murmelte der dicke Rehfeld vor sich hin und schnaufte. Aber er fand es nicht wirklich schlimm.
Es berührte ihn überhaupt nicht, davon war ich felsenfest überzeugt. Ich sah, wie er kurz in der Nase bohrte. Aber als er mich bemerkte, hörte er sofort damit auf. Es war ihm peinlich.
Er wollte eine nicht vorhandene Pietät raushängen lassen. Schließlich wusste er ja nicht, dass er das bei mir nicht brauchte. Ich war nämlich keineswegs unangenehm berührt durch sein Verhalten. Irgendwie verstand ich ihn sogar ganz gut.
Wenn man den ganzen Tag nichts anderes tut, als Leichen zu besichtigen und herauszufinden, wie sie zu Tode gekommen sind, muss man abgebrüht werden, wenn man nicht den Verstand verlieren will. Das ist ganz natürlich.
Jedenfalls sehe ich das so.
"Wer sind Sie eigentlich?", fragte Rehfeld.
"Ich heiße Michael Hellmer und wohne eine Etage tiefer."
"Und in welcher Beziehung standen Sie zu ..." er räusperte sich und hustete dann geräuschvoll in das riesenhafte Taschentuch, das er blitzschnell aus der Manteltasche gezogen hatte, "... zu dem Toten?"
"In gar keiner."
"Wie?"
"Ich hatte keine ›Beziehung‹ zu ihm. Ich mochte ihn nicht − und vor allem nicht seinen Föhn."
Er deutete in die Wanne. "Meinen Sie den da?"
"Ja. Den da!"
"Verstehe ich nicht."
"Ist auch nicht so wichtig!"
Oh, da war ich ihm aber auf seine überbreite Krawatte mit dem geschmackvollen grellen Blumenmuster und dem überdicken Windsorknoten getreten.
"Was hier wichtig ist, bestimme ich!", stellte er barsch und genau in der Art und Weise, die zum Klischeebild eines hässlichen, herrschsüchtigen, deutschen Beamten passte, fest.
"Okay, okay!", meinte ich. "Was wichtig ist, bestimmen Sie! Wer denn auch sonst!"
"Nicht frech werden!"
"Würde mir nie einfallen!"
Er blitzte mich böse an. Tja, dachte ich, jetzt weißt du nicht mehr, was du sagen sollst!
Er machte das einzig Vernünftige. Er schnaufte erst einmal ausgiebig. Und bevor er danach etwas sagen konnte, fing ich an, ihm von der Schönen mit den graugrünen Augen zu erzählen, die an mir vorbeigerannt war und allem Anschein nach geradewegs aus Lammers Wohnung gekommen war!
"Hm", brummte Rehfeld, jetzt schon etwas versöhnlicher. "Haben Sie eine Ahnung, wer die Frau war?"
"Nein."
"Hatte der Ermordete eine Freundin?"
"Kann ich mir nicht vorstellen. Er war ein Ekelsack! Aber ausschließen will ich das nicht. Es gibt schließlich auch Frauen mit schlechtem Geschmack."
"Er lebte allein in dieser Wohnung?"
"Soweit ich das sagen kann, ja. Jedenfalls ist mir nie etwas Gegenteiliges aufgefallen. Aber um ehrlich zu sein, ich habe mich auch nie besonders um das Liebesleben dieses Mannes gekümmert."
"Was machte er beruflich?"
"Keine Ahnung."
"Was wissen Sie überhaupt über ihn?"
"Zum Beispiel, dass er bestimmt keine Haustiere hatte, denn Haustiere sind hier verboten. Aber ansonsten weiß ich fast nichts."
"Sie lebten unter einem Dach, Herr Hellmer!"
"Ja, traurig, nicht? Das ist die Anonymität der Großstadt."
Er nickte, und dabei bildete sich ein imposantes Doppelkinn. Es war so groß, dass es fast den gesamten MEGAdicken Windsorknoten verdeckte.
"Das wird es wohl sein ..." murmelte er griesgrämig.
Und dann einigten wir uns darauf, dass er später noch einmal bei mir vorbeischauen werde, wenn er noch Fragen habe.
Mir war das recht.
Ich fürchtete nur, dass sich an dem Grundproblem zwischen uns bis dahin nicht viel geändert haben würde. Er hatte jede Menge Fragen, auf die weder ich noch irgendjemand sonst eine Antwort hatte.
 |  |

4

Mir fiel ein, dass ich noch irgendetwas Essbares fürs Abendbrot brauchte. Ein kurzer Blick auf die Uhr sagte mir, dass ich mich beeilen musste, wenn ich die Bäckerei auf der anderen Straßenseite noch vor Geschäftsschluss erreichen wollte.
Also ging ich gar nicht erst in meine Wohnung, sondern die Treppe hinunter und nach draußen.
Der Hauseingang wurde durch zwei uniformierte Schutzpolizisten gesichert, deren Dienstwagen mit Blaulicht am Straßenrand stand und bereits einen kleinen Pulk von Schaulustigen herbeigelockt hatte. Dieses blaue Licht wirkte auf sie wie weißes Licht auf Motten. Es war einfach unwiderstehlich, verhieß es doch nicht weniger als die Aussicht auf irgendeine Sensation.
Vielleicht sogar eine grässliche Sensation, bei der man dann sagen konnte: "Oh, wie grauenvoll! Hol mal den Willi, der hat sowas Schlimmes auch noch nicht gesehen!"
Der eine der beiden Polizisten war in meinem Alter und hatte einen dünnen Oberlippenbart in Errol-Flynn-Manier. Aber statt auf ein feines Rapier vertraute er anscheinend eher der weitaus weniger sportlichen Dienstwaffe an seiner Seite.
Sein Partner war mindestens fünfzehn Jahre älter und wirkte wie ein Landpolizist, der aus irgendeinem Grund ganz unten an der Karriereleiter kleben geblieben war. Über die Art des Klebstoffs konnte man nur spekulieren. Seiner roten Nase und dem strammen Bauch nach zu urteilen war er ein ziemlich gutmütiger, ziemlich oft ziemlich viel Bier trinkender Kneipengänger, was ihn wohl leider nur für eine Karriere im Schützenverein prädestinierte.
"Wer sind Sie?", fragte mich Errol Flynn. Seinem Blick fehlte dabei allerdings jeglicher Schmalz. Er war nur müde, misstrauisch und etwas genervt.
"Ich wohne hier", sagte ich und hatte mich schon halb an ihm vorbeigedrückt.
"Hat der Kommissar schon ihre Personalien?", fragte Errol, während sein rotnasiger Kollege verstohlen in der Nase bohrte und offensichtlich glaubte, dass das niemand mitbekomme.
"Er kann sie an meinem Türschild abschreiben, wenn er Lust hat!"
"Ha, ha." Errol Flynn verstand keinen Spaß. Vielleicht lag es daran, dass ich keine Piraten-Lady mit offenem Dekolleté war. Bei mir war nur der erste Hemdknopf offen. Errol wollte noch etwas sagen und hatte auch schon gehörig Luft dafür geholt, aber sein Partner kam ihm zuvor und meinte: "Lass ihn, Heinz!"
Ich war draußen und arbeitete mich zielstrebig durch den kleinen Pulk von Schaulustigen, die auf dem Bürgersteig herumstanden und eine Art Halbkreis dabei bildeten.
Sie stierten auf die beiden Schutzpolizisten wie Lourdes-Pilger auf das heilende Wasser und erwarteten offenbar jede Sekunde, dass etwas geschah. Wenn schon kein Wunder, dann wenigstens etwas, das man nicht alle Tage sah. Und wenn man schon nichts sah, dann hörte man ja vielleicht etwas.
Ich hatte mich gerade bis zum Bordstein durchgekämpft und wollte über die Straße, da fiel mein Blick auf einen jungen Mann mit verfilzten, fast schulterlangen Haaren, wie ich sie selbst vor einer halben Ewigkeit mal getragen hatte. In seinem handgestrickten Pullover, seinen Turnschuhen und den schmuddeligen Jeans sah er modisch so MEGAout aus, dass er vermutlich schon wieder ein Vorläufer des allerneuesten Trends war.
Trotz seines dicken Pullovers schien der arme Kerl zu frieren. Seine Augen flackerten unruhig, und er drehte sich ständig nach allen Seiten um wie ein Dieb, der den Mundgeruch des Kaufhausdetektivs zu riechen glaubte.
Plötzlich schrumpfte der Kerl ein Stück zusammen, und ich bemerkte, dass er bislang auf Zehenspitzen gestanden hatte.
Mit seinem hohlwangigen Gesicht, den dunkelbraunen Augen, deren Blick ständig umherirrte, und den abstehenden Ohren, die sich durch seine Haarpracht hindurchstahlen, wirkte er auf mich wie ein ausgezehrtes, gehetztes Nagetier. Ein Hase, der auf einem Kohlfeld sitzt und genau weiß, dass er dort eigentlich nicht sein dürfte ...
"Heh, Sie! Wissen Sie, was hier eigentlich los ist?", trällerte eine energische Stimme, die entweder einer Marktfrau oder einer Lehrerin gehören musste. Eine unscheinbare, grauhaarige, recht hagere Endfünfzigerin hatte sich an den hasenartigen jungen Mann gewandt.
Also doch: eine Lehrerin!
Der junge Mann zuckte zusammen. Vielleicht kannte er diesen Tonfall noch aus der Schule und war immer noch darauf konditioniert. Jedenfalls stand er starr und steif da, und sein Gesicht hatte den letzten Rest von Farbe verloren.
Seine Stimme war ein heiseres Krächzen, wie ich es in meinen Romanen immer Leuten andichte, die schon mit anderthalb Beinen im Grab stehen.
"Was?"
"Heißt der Tote nicht Lammers oder Lamus?", fragte die Lehrerin, und ich dachte: Das hat sich ja schnell herumgesprochen.
"Jürgen Lammers?", vergewisserte sich der Filzlockige, was entweder bedeutete, dass er ihn kannte, oder dass er ein besserer Lauscher war.
Die Lehrerin runzelte die Stirn. "Wohnen Sie denn nicht hier?"
"Ich?"
"Mit wem rede ich denn? Die Polizisten sagen ja nichts! Aber es muss wohl jemand umgebracht worden sein! Sie standen doch noch näher am Polizeifunk. Ich dachte, Sie hätten etwas mehr mitgekriegt als ich!"
Er sah sie mit offenem Mund an. Aus seinen Augen sprach dabei eine Mischung aus Entsetzen und namenloser Angst.
"Was?", krächzte er.
"Haben Sie gesehen, ob die Leiche schon rausgetragen wurde?"
Er rang nach Luft und wich vor der Lehrerin zurück. Dabei rempelte er einen älteren Mann hart an, der nur verständnislos mit dem Kopf schütteln konnte.
Die Lehrerin fragte: "Was ist denn los? Ist Ihnen nicht gut?"
Er schluckte. "Nein ..." flüsterte er und schüttelte wie von Sinnen den Kopf.
Was dann folgte, war eine Art heilloser Flucht. Kopfschüttelnd rannte er los, strauchelte dabei und stolperte dann über die Straße. Ein Wagen wich ihm aus, ein zweiter bremste. Dass er bis zum Mittelstreifen kam, war wie ein Wunder. Dort warf er einen gehetzten Blick zurück und nutzte anschließend die nächste Gelegenheit, um die andere Seite zu erreichen.
Wenig später war er in einer Seitenstraße verschwunden, und die Blicke der Schaulustigen hafteten bis zum letzten Moment an seinen Fersen.
"Was war denn mit dem?", fragte der ältere Mann.
"Ich weiß es nicht", murmelte die Lehrerin.
"Ein Irrer!"
"Wahrscheinlich einer aus der Anstalt. Die haben wohl mal wieder Ausgang!"
 |  |

5

Ich schaffte schließlich auch noch die Überquerung des reißenden Verkehrsstroms, wenn auch nicht so schnell wie der filzlockige junge Mann, der so fluchtartig verschwunden war.
Aber im Gegensatz zu ihm hatte ich nicht den geringsten Hang zum Selbstmord.
Ich fragte mich, weswegen er so plötzlich getürmt war. Es war eine Flucht gewesen, das stand für mich fest. Er hatte aus irgendeinem Grund eine Höllenangst bekommen, ein furchtbares Panikgefühl, das ihn dazu veranlasst hatte, blindlings davonzulaufen.
Ein Spinner. Das war aber nur eine Möglichkeit.
Ich betrat die Bäckerei gerade in dem Augenblick, als die Verkäuferin hinter dem Tresen hervorgekommen war, um die Ladentür abzuschließen.
"Ich wollte gerade ..."
"Drei belegte Brötchen!", brachte ich heraus und schenkte ihr das charmanteste Lächeln, das ich nach diesem Tag noch zustande bringen konnte.
Ich wusste, dass es bei ihr in der Regel ganz gut wirkte.
Als sie anhielt und die Arme in die Hüften stützte und dabei das Grübchen auf ihrer linken Wange erschien, wusste ich, dass ich heute doch noch satt werden würde.
"Hören Sie mal, wenn jetzt jeder ..."
"Bin ich denn jeder?"
"Na, jedenfalls ..."
"... wollen Sie sicher nicht eine Hungerkatastrophe auf Ihr Gewissen nehmen, oder? Morgen sind Ihre Sachen doch sowieso schlecht, und Sie werden sie wegwerfen!"
Letzteres war ihr vermutlich völlig egal, weil sie nicht die Besitzerin des Ladens war, aber ich hatte das Gefühl, dass ich irgendetwas sagen musste, um sie restlos zu überzeugen. Und solange ich irgendetwas sagte, hatte sie wenigstens keine Gelegenheit, nein zu sagen.
Sie seufzte. "Also gut."
Sie ging an mir vorbei und schloss die Ladentür. Einen Augenblick schaute sie hinüber zu dem Theater, das sich auf der anderen Seite abspielte. Inzwischen war noch ein Wagen hinzugekommen und versuchte verzweifelt, sich in eine Parklücke zu quetschen. Vielleicht die Spurensicherung, dachte ich.
"Was ist denn da bei Ihnen los?", fragte sie mich.
Ich sagte es ihr. Sie würde es morgen sowieso in der Zeitung lesen.
"Haben Sie den Mann gut gekannt?"
"Nein. Und Sie?"
"Einmal die Woche hat er ein Weißbrot gekauft. Und Sahnetorte. Darauf stand er."
"Hm." Ich hörte nur halb hin, während sie munter weitererzählte und mir drei belegte Brötchen machte.
"Er stank oft morgens schon nach Bier."
"So, so ..."
"Wollen Sie Käse oder Wurst?"
"Käse."
Mein Blick ging über die Schlagzeilen einer ausliegenden Boulevardzeitung. RUDI, WAS NUN?, stand da in so großen Lettern, dass man erst einmal einen Schritt zurückgehen musste, um es richtig lesen zu können. Zwischen den Monsterbuchstaben war ein kleines Bild des Bundestrainers, das ihn mit einem schier verzweifelten Gesichtsausdruck zeigte.
Ich sah kurz zu der Verkäuferin hinüber. Sie hatte mit den Brötchen noch eine Weile zu tun, daher drehte ich die Zeitung um. Mein Blick fiel auf die ausgezogene Schöne mit der Überschrift CINDY IST ES AUCH IM WINTER HEISS, wurde dann aber Cindys Schwindelerregender Kurven zum Trotz von etwas anderem abgelenkt.
Es war ein kleiner Artikel in der Ecke, der zu zwei Dritteln aus seiner Überschrift bestand.
Irgendein Splitter meines Bewusstseins hatte das Wort MÜNSTER wahrgenommen, was für mich Anlass genug war, mal nachzusehen.
Wenn Münster in diesem nationwide vertriebenen Revolverblatt erwähnt wurde, bedeutete das nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass hier mal wieder etwas geschehen war, was die Nation bewegte.
Dass Boris Becker hier noch ein uneheliches Kind hatte, wagte ich nicht zu hoffen, aber vielleicht war der Geisterfahrer von vorgestern drin.
Seit dem Westfälischen Frieden von 1648, der den dreißigjährigen Krieg beendet hatte, war die Stadt ziemlich aus den Schlagzeilen raus. Wurde also Zeit, dass hier mal wieder Geschichte geschrieben wurde.
EMPÖREND: DEUTSCHLANDS GEIZIGSTER POLITIKER!, stand da mit schreiendem Ausrufezeichen zu lesen. Und dann, etwas kleiner: ›Miese Tricks! Münsters OB zahlt keinen Cent an verarmte Ex-Frau!‹
Zwei kleine Fotos daneben. Eines zeigte die arme Ex-Frau mit einem hinlänglich verzweifelten Gesicht. Auf dem anderen war unser aller Oberbürgermeister zu sehen. Ich erkannte ihn jedoch erst auf den dritten Blick. Das Bild war schon ziemlich alt und stammte vermutlich aus dem Archiv der Ex-Frau. Ein Ausschnitt aus dem Hochzeitsfoto vielleicht.
Ich begann, den Artikel zu lesen: "Dr. Jürgen Werneck (52) hat es faustdick hinter den Ohren. Er ist Oberbürgermeister im westfälischen Münster und Inhaber einer Immobilienfirma. In der Großgarage seines schmucken Bungalows stehen ein silberfarbener Mercedes und ein blauer Jaguar. Doch seine Ex-Frau Brigitte (50) lebt in bitterer Armut. Seit ihr die Ein-Zimmer-Wohnung gekündigt wurde, muss sie in einem Obdachlosenasyl übernachten. Brigitte Werneck sagt: >Er hat kein Herz mehr für die Mutter seiner Kinder!<“
Danach war die Zeile unleserlich.
Irgendjemand hatte mit Schokoladenfingern auf die Zeitung gefasst. Aber morgen war das Blatt sowieso Altpapier.
"Hier sind die Brötchen!", drang die Stimme der Verkäuferin wie ein Messer durch meine butterweichen Gedanken.
Ich fuhr hoch. "Was?"
"Ja, dann bezahlen Sie jetzt wenigstens, damit ich endlich nach Hause komme!"
"Konfuzius sagt: Eile mit Weile", erwiderte ich, während ich die Euromünzen aus dem Portemonnaie kratzte.
Sie verzog das Gesicht. "Eile mit Weile − Langeweile!", versetzte sie schlagfertig.
Ich nahm die Brötchen. "Wiedersehen."
"Tschüss. Erzählen Sie mir morgen, was da drüben bei Ihnen genau passiert ist, ja? Das sind Sie mir schuldig!"
 |  |

6

Das Haus glich einem wahren Taubenschlag. Ich saß in meiner Küche und hörte vom Treppenhaus her Stimmen und Schritte. Da war einiges los, aber ich hatte wenig Lust, mir das ausgiebig anzusehen, wie es zweifellos die beiden Frauen mit dem überaus ungewöhnlichen Namen Meyer jetzt taten. Nicht lange, und es gab auch wieder Strom.
Ich schüttete den Rest Kaffee, der sich noch in der Maschine befand, ins Spülbecken und setzte mir frischen auf.
Dann packte ich meine Brötchen aus und fragte mich, welches ich zuerst essen sollte.
Erst jetzt wurde mir bewusst, wie hungrig ich war. Seit dem ausgiebigen Frühstück, das ich in einem Kaufhausrestaurant genossen hatte, hatte ich außer reichlich Kaffee nichts zu mir genommen.
Manchmal ist das so.
Man sitzt an der Tastatur, sieht den Cursor auf dem Bildschirm blinken und es scheint einem so, als würde er einem unablässig zurufen: "Noch eine Zeile, noch eine Zeile! Nicht stehenbleiben! Nicht stehenbleiben!"
Und dann ist man wie unter Hypnose. Ein Wort nach dem anderen erscheint auf dem Bildschirm, bis der Strom der Bilder und Wörter (und manchmal leider auch jener der Elektrizität) plötzlich versiegt. Dann wird einem erst bewusst, wie viel Zeit vergangen ist und wann man zum letzten Mal etwas gegessen hat.
Ich habe oft darüber nachgedacht, was es ist, das einen treibt, eine Zeile nach der anderen zu füllen.
Sicher, da ist die Gewissheit, dass man letztlich immer nur soviel Geld auf seinem Konto finden wird, wie man Seiten geschrieben hat.
Außerdem weiß man nie, ob einem auch morgen noch etwas einfällt. Wenn die Einfälle also da sind, muss man das ausnutzen. Es könnte ja sein, dass man irgendwann mal in eine Krise kommt. Keine Bilder, keine Wörter, nichts mehr; Ende. Blackout.
So etwas gibt es. Aber es hat bei mir noch nie sehr lange gedauert. Ein paar Tage, meistens weniger.
Nein, das allein kann es nicht sein, was einen immer wieder treibt. Denn die Wahrheit ist, dass mir eigentlich immer etwas einfällt, wenn ich einigermaßen ausgeruht bin. Nicht unbedingt jedes Mal ein dichterischer Geniestreich, aber das erwartet auch niemand von mir.
Was ich mache, ist Handwerk, keine Kunst. Aber auch das will gut gemacht sein, oder?
Ich denke, es ist eine Form der Besessenheit, die einen immer wieder an die Tasten treibt.
Besessenheit, genau das ist das richtige Wort.
Ich fühle mich gut, wenn ich geschrieben habe. Ich fühle mich einfach gut, obwohl ich hinterher oft völlig fertig bin. Aber ich fühle mich gut. Und das ist es, worauf es ankommt, so sehe ich das.
Es ist eine Besessenheit. Ein Dämon, gegen den es keinen Exorzismus gibt.
Es gibt Leute, die bringen Menschen um und fühlen sich hinterher vielleicht auch gut. Oder hoffen zumindest, sich dadurch besser zu fühlen. Solche Leute nennt man Psychopathen, und man sperrt sie in Irrenanstalten ein. Andernorts kommen sie auf den elektrischen Stuhl.
Im Prinzip tun diese Leute nichts anderes als ich. Sie geben ihrer Besessenheit nach. Aber so ist das eben. Die eine Besessenheit bringt einen ins Loch, die andere lässt sich vermarkten.
Während ich mir ein Brötchen in den Rachen schob und ein kräftiges Stück davon abbiss, gingen meine Gedanken zurück zu Jake McCord und seinen Problemen mit einem furchtbar miesen und skrupellosen Rancher, der einen ganzen County unter seiner Knute hält ...
Fünf Seiten hatte Jürgen Lammers mir gestohlen, dieser dumme Hund! Er war jetzt tot, aber irgendwie hatte ich ihm deshalb trotzdem nur zur Hälfte verziehen. So bin ich eben: nachtragend und ungerecht.
Auch gegenüber Toten.
Aber es war nicht zu ändern, und ich würde gut daran tun, mich darauf zu konzentrieren, die Szene möglichst schnell wieder so hinzukriegen, wie ich sie schon einmal auf dem Papier gehabt hatte.
Ich nahm also die Kaffeetasse und ein Brötchen und ging zum Computer, schaltete Zentraleinheit und Bildschirm wieder an, wartete, bis der Computer seinen Scan-Disk durchgeführt hatte und wieder hochgefahren war, um schließlich die Datei mit dem überaus spannenden Anfang von ›Gnadenlose Wölfe‹ zu öffnen, diesem ›brandneuen Top-Western unseres beliebten Autors MIKE HELL. Realistisch, hart und voller Dramatik!‹
Ich schlürfte noch einmal an meinem Kaffee und stopfte den Rest meines Brötchens in mich hinein. Wahrscheinlich würde ich später noch eine Pizzeria heimsuchen.
Ich fing also wieder an, in die Tasten zu hauen. Ich mag so etwas nicht. Es ist eine Qual, eine Szene, die man geistig schon abgelegt hat, noch einmal erfinden zu müssen. Es ist einfach nicht kreativ, es ist nur ärgerlich. Und noch ärgerlicher ist es, wenn man nicht so recht voran kommt, weil die Gedanken woanders sind.
Ich konnte mich eigentlich immer schon gut konzentrieren und um mich herum die Welt vergessen. Man muss das können, wenn man etwas zustande bringen will. Man muss die Welt um sich herum vergessen, um kurzfristig in eine andere eintauchen zu können. Ich habe diese Fähigkeit ganz gut trainiert und dennoch − manchmal ist es einfach nicht zu verhindern, dass die Gedanken ihre eigenen Wege gehen.
Und genau dieses Problem hatte ich im Moment.
Zeile um Zeile quälte ich mich voran. ›McCord kniff die Augen zusammen, so dass sie nichts weiter waren als enge Schlitze‹, so hackte ich lustlos in die Tasten. Aber schon in der nächsten Sekunde war mir klar, dass ich diese Zeile wieder löschen musste. Jake McCord hatte die Augen im Verlauf der letzten halben Seite schon einmal zusammengekniffen, und das war entschieden genug.
Ich atmete tief durch.
Und dann löschte ich die Zeile und suchte nach etwas Neuem. Ich tat es nicht nur aus stilistischen Gründen, sondern auch um McCords Willen. Er sollte ja schließlich vom dauernden Zusammenkneifen keinen Krampf in den Augenwinkeln bekommen!
 |  |

7

Fünf Minuten später klingelte es an meiner Tür. Ich ging hin und öffnete.
Vor mir stand der dicke Rehfeld mit seiner dicken Krawatte und seinem MEGAdicken Doppelkinn.
Sein Bauch drängte durch seinen offenen Mantel schon fast bis in meine Wohnung hinein. Beinahe so, als hätte er ihn direkt gegen die Tür gedrückt, bevor ich geöffnet hatte.
Wahrscheinlich war es sogar genau so gewesen! Schließlich hatte er kurze Arme und hätte sonst gar nicht die Klingel erreichen können!
"Kann ich kurz zu Ihnen hereinkommen, Herr, äh ..." Er schaute auf seinen schmierigen Zettel. Vielleicht sollte er es mal mit einem Diktiergerät versuchen!, dachte ich. Aber es würde wohl noch geraume Zeit verstreichen, ehe bei der Polizei das Zeitalter der modernen Technik anbrechen würde. "Herr Hellmer!", kam es schließlich über seine dünnen aufgesprungenen Lippen, die er wiederholt mit seiner Zunge benetzte.
"Kommen Sie herein!", sagte ich.
Unterdessen sah ich aus dem Augenwinkel, wie zwei Uniformierte einen Metallsarg die Treppe hinuntertrugen und sich an Rehfeld vorbeiquetschten.
"Warum benutzt ihr nicht den Fahrstuhl?", knurrte der Dicke.
"Ist kaputt!", knurrte es zurück.
Mein Blick blieb unwillkürlich an dem Metallsarg haften und folgte ihm weiter die Treppe hinab. Da liegt er nun also drin!, dachte ich. Ob man ihm wenigstens zur Beerdigung etwas anderes als einen Jogging-Anzug anziehen würde?
"Kommen Sie!", hörte ich Rehfeld sagen. "So interessant ist so ein Sarg doch auch nicht!"
Ich zuckte mit den Schultern. "Kommt drauf an."
"Wo drauf?"
"Darauf, wer drin liegt zum Beispiel. Oder ..."
"Oder?"
"Oder wie derjenige gestorben ist."
"Sie meinen, ob friedlich im Bett oder unfriedlich in der Badewanne?"
Ich nickte. "Ja, so oder so ähnlich."
Er sah mich an. Er hatte wässrig blaue Augen und fast genau den Blick, den ich in meinen Romanen immer den Saloonkeepern gebe. Ein bisschen misstrauisch, ein bisschen feige und ein bisschen voll vorgespielter Entschlossenheit. Aber wenn die Schießerei kam, dann pflegten sie sich blitzschnell hinter die Theke zu ducken und tauchten für gewöhnlich erst wieder auf, wenn alles vorbei war.
"Was wollen Sie wissen?", wandte ich mich an den dicken Kripo-Mann.
"Ich wollte Sie kennen lernen."
"Bin ich so interessant?"
"Kann man vorher nie sagen, Herr Hellmer."
"Das stimmt auch wieder."
"Für mich ist alles interessant, was irgendwie mit Jürgen Lammers zusammenhängt."
"Ich sagte Ihnen doch schon, dass ich nicht mit ihm zusammenhänge."
"Ja, das habe ich zur Kenntnis genommen. Es wäre übrigens nett, wenn Sie sich gleich noch Zeit nehmen könnten, um mit einem unserer Beamten ein Phantombild von der Frau zu erstellen, die Sie gesehen haben."
"Muss ich dazu aufs Präsidium?"
"Nein. Der Kollege kommt hier bei Ihnen vorbei. Vielleicht in einer halben Stunde. Haben Sie heute Abend noch was vor?"
"Nein."
"Das ist gut. Wie ist Ihre Telefonnummer?"
Ich nannte sie ihm, und er schrieb sie sich auf.
Bis jetzt hatten wir im Flur gestanden, jetzt machte ich mich ins Wohnzimmer auf, in dem ich auch arbeitete. Rehfeld folgte mir, ohne auf eine Einladung meinerseits zu warten.
Sein Blick ging sofort zum Computer. "Sind Sie ein Spiele-Freak oder ein Hacker?"
"Ich brauche das Ding beruflich."
Er ließ sich auf einem meiner Sessel nieder. Dann beugte er sich nach vorne, zu dem niedrigen Tisch, wo ein Packen Belegexemplare lag, der gestern mit der Post gekommen war und den ich noch immer nicht weggeräumt hatte.
›Logan, der Unerbittliche‹, so hieß dieser ›ungewöhnlich dramatische Western-Roman von MIKE HELL.‹
Ein breites Grinsen ging über sein Gesicht. Es zog sich an seinem Doppelkinn entlang von einem Ohr zum anderen.
Dann nahm er sich ein Exemplar des ›Unerbittlichen‹, blätterte ein wenig darin herum und legte den Roman schließlich wieder zurück auf den Packen.
"Sie sehen mir eigentlich ein bisschen zu erwachsen für so etwas aus", meinte er.
"Ich lese das Zeug ja auch nicht", meinte ich.
"Aber ..."
"Es ist viel schlimmer: Ich schreibe es!"
"Da steht aber ein gewisser Mike Hell als Autor angegeben."
"Das ist mein Pseudonym. Mike Hell - Michael Hellmer."
"Verstehe ..." murmelte er, und ich dachte, als Polizei-Detektiv hättest du eigentlich selber drauf kommen müssen, Dicker!
Aber vielleicht war das logische Kombinieren ja inzwischen aus der Mode gekommen und durch modernere Ermittlungsmethoden ersetzt worden.
Ich sah Rehfeld an. "Ich lebe davon, Leute umzubringen. Allerdings nur auf dem Papier. Alle paar Seiten eine Schießerei. Ich komme locker auf fünfzig Leichen im Monat, bin also ein Wiederholungstäter, oder?"
Rehfeld schlug sich auf seine sicher unwahrscheinlich wabbeligen Schenkel und lachte. "Ja", prustete er. "Kann man wohl so sehen ..."
"Ich schätze, wenn Lammers nicht in der Badewanne umgekommen wäre, sondern Sie ihn mit einer Kugel im Kopf gefunden hätten − dann wäre ich wohl auf Ihrer Verdächtigenliste ganz oben!"
Er verzog sein Gesicht. "Wer sagt, dass Sie es nicht auch jetzt sind?"
Ich nickte. "Sicher", bestätigte ich. "Ich traue Ihnen alles zu."
"Verdienen Sie eigentlich gut?"
"Nein. Nicht besonders. Leider bin ich nicht Konsalik oder Stephen King."
"... und ich bin nicht so ein netter Kerl wie Derrick oder Columbo!"
"Habe ich mir fast gedacht!"
Schließlich kam er doch noch zur Sache. Ich hatte schon befürchtet, dass er tatsächlich nur gekommen sei, um mir erstens den Besuch seines Kollegen anzukündigen und mir zweitens meine kostbare Zeit zu stehlen.
Aber ganz so schlimm war es dann doch nicht.
"Haben Sie etwas gehört? Irgendetwas, ganz gleich was?"
Ich überlegte. "Ich war bei der Arbeit, als das oben mit Lammers passiert sein muss. Und dann war plötzlich die Sicherung raus. Genau in dem Moment muss der Föhn in die Wanne gelangt sein. Ungefähr 17.30 Uhr, würde ich sagen. Ich wollte gerade eine Pause machen und habe deswegen geschaut, wie spät es war."
"Sie haben nichts gehört?"
"Nein."
"Keine Schritte, niemanden, der nach oben gegangen ist?"
"Die Frau ..." begann ich, aber das war im Moment nicht das, was der Dicke von mir hören wollte, und so unterbrach er mich ziemlich abrupt.
"Ja, von der haben Sie uns bereits erzählt", knurrte er unwirsch.
"Sonst niemand ... aber ..."
"Ja?"
"Warten Sie mal eine Sekunde."
"Na?"
"Da war etwas, aber das war zwei Stunden früher!"
"Erzählen Sie!", forderte er.
"Ich war im Flur, da habe ich gehört, wie mindestens zwei Personen die Treppe zu Lammers hinaufgegangen sind! Aber ich glaube nicht, dass das etwas mit der Sache zu tun hat! Schließlich war der Stromausfall erst viel später."
Rehfeld atmete tief durch und lehnte sich zurück. "Wahrscheinlich hat es mehr damit zu tun, als Sie für möglich halten!"
"Was meinen Sie damit?"
"Als der Strom ausfiel, war Lammers schon mindestens eine Stunde tot."
"Ist das sicher?"
"Ziemlich sicher. Und er starb auch nicht an dem elektrischen Schlag!"
"Was?" Ich war erstaunt.
"Jemand hat ihm mit einem stumpfen Gegenstand von hinten auf den Schädel geschlagen."
"Das heißt, Lammers wurde erst in die Wanne befördert, nachdem er schon tot war!"
"Ja."
Das ließ natürlich alles in einem neuen Licht erscheinen. Selbstmord, so schien es, war damit wohl endgültig ausgeschlossen.
"Naja", meinte ich. "Sie werden sicher alles herausbekommen."
"Allerdings, das werde ich!", kündigte er an. Und bei ihm klang das fast wie eine Drohung.
Im nächsten Moment klingelte es an der Tür. Zweimal kurz hintereinander. Da schien jemand ziemlich ungeduldig zu sein.
Ich meinte: "Das wird wohl Ihr Kollege sein."
Rehfeld nickte langsam. "Ja, vermutlich." Er erhob sich. "Es wäre nett, wenn Sie in den nächsten Tagen im Präsidium vorbeischauen würden, damit wir Ihre Aussage zu Protokoll nehmen können."
"Meinetwegen", sagte ich.
Ich öffnete die Tür, und davor stand ein junger Mann mit dicker Brille und fettigen langen Haaren, die ihm am Kopf klebten. Er sah wie ein Seehund aus, der gerade aus dem Wasser getaucht war. Der dünne, blonde Schnurrbart trug zu diesem Eindruck ein Übriges bei.
Rehfeld schien den Seehund zu kennen. Jedenfalls musste sich dieser von dem Dicken einen Schlag auf die Schulter gefallen lassen. "Dann sehen Sie mal zu, dass Sie ein schönes Bild zurechtkriegen!"
 |  |

8

Ich schrieb: ›Jake McCord ließ die Flügeltüren des Saloons auseinanderfliegen und trat ein. Zu dieser Tageszeit war an diesem Ort noch nicht viel los. Ein paar Zecher hingen an der Theke.
An einem der Tische wurde gespielt.
Als McCord eingetreten war, verstummten fast augenblicklich die Gespräche. Verstohlene Blicke wurden ihm zugewandt, wobei die Männer es vermieden, McCord offen anzusehen. Jake McCord kannte diese Blicke. Es waren Blicke, die einem Mann galten, von dem jedermann annahm, dass er bald sterben werde − durchsiebt von einem halben Dutzend Bleikugeln.
McCord kümmerte das nicht. Er hatte nicht vor, sich erschießen zu lassen.
Mit weiten Schritten ging er zur Theke, hinter der der Saloonkeeper wie erstarrt stand. Er war dick und rotwangig und machte ganz den Eindruck, sich häufiger an seinem eigenen Whiskey zu vergreifen.
"Sie können Ihren Mund wieder zumachen!", wandte sich McCord an den Salooner. "Und wenn Sie das geschafft haben, dann schenken Sie mir doch bitte etwas ins Glas!"
"Whiskey?"
"Was sonst!"
"Ich hätte nicht gedacht, dass Sie noch hier sind, Mister McCord! Wenn ich Sie wäre, hätte ich mir ein schnelles Pferd besorgt und zugesehen, ein paar Meilen zwischen mich und John Morton zu legen!"
"Ich fürchte mich nicht vor John Morton!"
"Das sollten Sie aber! Sie haben seinen Vormann erschossen!"
"Das war Notwehr!"
"Für Morton spielt das keine Rolle!" Der Keeper stellte ein Glas auf den Tisch und goss es bis zum Rand voll. McCord nahm es und spülte den braunen Saft in einem Zug hinunter, dann ging sein Blick zur Seite.
Er sah eine junge Frau die Treppe hinunterkommen. Ihre Blicke trafen sich. Sie hatte graugrüne Augen und dichtes, dunkelbraunes Haar, das sie kunstvoll hochgesteckt hatte.
Sie lächelte.
Als McCord zu ihr hingehen wollte, hielt der Keeper ihn am Arm fest. "Ich warne Sie, McCord! Das ist John Mortons Mädchen!"‹
Ich sicherte meinen Text, erhob mich und ging zum Fenster. Unten auf der Straße hupte irgendein Lieferwagen, weil man ihn zugeparkt hatte.
Ja, diese graugrünen Augen gingen mir nicht mehr aus dem Sinn, und jetzt begann ich sogar schon, damit mein Western-Alter-Ego Jake McCord zu plagen! Und dabei hatte McCord eigentlich schon genug Probleme! Dass sich diese geheimnisvolle Schöne verdünnisiert hatte und sich bis jetzt standhaft weigerte, wieder aufzutauchen, war ja schließlich nicht seine Schuld.
Zwei Tage waren vergangen, seit Lammers zu Tode gekommen war. Die Polizei hatte sich nicht mehr bei mir gemeldet, und ich dachte mit Schrecken daran, dass ich noch zu Rehfeld aufs Präsidium musste, um meine Aussage zu Protokoll zu geben. Ich hatte das bisher vor mir hergeschoben, aber das ging nicht bis in alle Ewigkeit.
Ein Phantombild war erstellt worden, mit dessen Hilfe nun nach jener Frau gefahndet wurde, der ich im Treppenhaus kurz nach dem Stromausfall begegnet war. Wahrscheinlich bis zur Stunde erfolglos.
Seltsam, ich hatte sie nur für wenige Augenblicke gesehen, aber ihr Gesicht stand noch immer in jeder Einzelheit vor meinem inneren Auge.
Hätte ich versucht, mir Jürgen Lammers Gesicht vorzustellen, hätte ich viel größere Schwierigkeiten gehabt, obgleich ich ihm mehr als ein Dutzend Mal begegnet war, um mich mit ihm zu streiten.
Lammers Wohnung war von der Kripo versiegelt worden. Niemand konnte dort hinein, ohne dass man es hinterher sehen konnte.
Ansonsten war wieder so etwas wie Normalität in dieses nicht mehr ganz taufrische Mietshaus eingekehrt. Die Bässe der Disco im Erdgeschoss dröhnten wie eh und je oft bis weit nach Mitternacht, die dicke Mutter schaffte es immer noch mit letzter Kraft, ihre eingepackten Pizza-Köstlichkeiten bis hinauf in ihre Wohnung zu bringen, und ihre pickelige Tochter wirkte so unzufrieden wie stets.
Aber es hatte seitdem keinen Stromausfall mehr gegeben. Und das hielt ich für ein gutes Zeichen.
Mit den ›Gnadenlosen Wölfen‹ war ich gut vorangekommen, und es war, wie es meistens bei mir ist: Noch während ich an einem Roman arbeitete, kristallisierte sich bereits der nächste heraus.
Ich klappte ein wenig das Fenster ab, um ein bisschen frische Luft hereinzulassen, obwohl frisch für das, was da hereinblies, vielleicht doch nicht der richtige Ausdruck war.
Und dann glaubte ich, meinen Augen nicht zu trauen!
Auf der anderen Straßenseite sah ich sie. Ich musste zweimal hinschauen, um es wirklich glauben zu können, aber dann hatte ich nicht mehr den geringsten Zweifel.
Sie wandte den Kopf, sah nach den Autos und versuchte über die Straße zu kommen, was ihr schließlich auch gelang. Ich war gespannt, wohin sie ihr Weg jetzt führen würde. Aber war das wirklich eine Frage?
Nein, ich hatte es im Gefühl.
Sie würde hinauf zu Lammers Wohnung wollen, aus einem Grund, der die Polizei vermutlich noch um einiges mehr interessierte als mich − und den weder Rehfeld noch ich bis jetzt kannten.
Ich blickte hinab, sie blickte hinauf, aber sie sah mich nicht. Immer wieder drehte sie den Kopf, so als glaube sie, verfolgt oder beobachtet zu werden.
Wurde sie ja auch: von mir.
Doch das war sicher nicht der Grund für ihre Vorsicht.
Und dann verschwand sie unten im Eingang. Meine Vermutung hatte sich also bewahrheitet.
Ich ging in den Flur und dachte, gleich müsste ich sie das Treppenhaus hinaufklappern hören.
Sie trug Schuhe mit Absätzen, damit konnte man sich nicht leise hinaufschleichen.
Es dauerte nicht lange, bis ich sie tatsächlich hörte. Ich wollte schon die Tür öffnen und hinausgehen, aber im letzten Moment hielt ich inne.
Unterdessen hatte es die Frau gerade bis zum ersten Treppenabsatz geschafft.
Was sollte ich tun?
Einfach hinausgehen, sie anquatschen und ihr sagen, sie möge doch bitteschön so freundlich sein, sich bei der Polizei zu melden?
Wie kam ich dazu? Und wie würde sie reagieren?
Vielleicht genau so, wie bei unserer ersten, allzu kurzen Begegnung. Möglicherweise würde sie einfach auf dem Absatz kehrtmachen und wieder davonrennen.
Ich beschloss, erst einmal abzuwarten, ob sie wirklich hinauf zu Lammers Wohnung gehen würde.
In diesem Moment kam sie an meiner Tür vorbei, und dann trippelte sie die nächste Treppe hinauf. Ich wartete darauf, dass sie unverrichteter Dinge zurückkehrte, aber sie kam nicht.
Ich öffnete die Tür und ging hinaus ins Treppenhaus. Und dann lauschte ich, hörte aber nichts. Ich schloss meine Wohnungstür und ging dann auf leisen Sohlen die Treppe zu Lammers hinauf.
Oben angekommen, war von der Schönen nichts zu sehen.
Sie hatte sich einfach in Luft aufgelöst, und eine Sekunde lang glaubte ich schon, einer Fata Morgana aufgesessen zu sein. So etwas kommt ja vor.
Man ist von etwas so besessen, dass man Dinge sieht und hört, die gar nicht existieren, und sich irgendetwas einbildet, sich aus kleinen Versatzstücken der Wirklichkeit etwas zurechtlegt, das dann nichts als Erfindung ist.
Aber die junge Frau hatte sich keineswegs in Luft aufgelöst. Mein Blick fiel auf das zerstörte Siegel der Kripo.
Die Lady, der ich auf den Fersen war, befand sich in der Wohnung!
Jake McCord hätte jetzt an die Hüfte gegriffen, blitzartig seinen 45er aus dem Holster gerissen und dann mit einem kraftvollen Tritt die Tür geöffnet.
Ich ging da entschieden ziviler vor, schon deshalb, weil ich keinen 45er Colt an der Seite hatte. Vor allem war ich keineswegs scharf darauf, irgendwelche Reparaturrechnungen begleichen zu müssen.
So drückte ich also ganz einfach die Klinke herunter, machte auf, blickte in den noch immer völlig chaotischen Flur, und dann sah ich sie.
Ihr hübsches, fein geschnittenes Gesicht war bleich wie die Wand geworden. Fast so bleich wie das Gesicht von Lammers, als ich ihn in der Badewanne gesehen hatte. Aber sie hatte es besser.
Sie hatte sich nur zu Tode erschrocken, Lammers war tot. Ein nicht unbeträchtlicher Unterschied, den sie im Moment aber wohl nicht so recht zu würdigen wusste.
Sie machte ihren hübschen roten Mund erst auf und dann wieder zu. Und dann schluckte sie.
Und ich?
Jake McCord blieb so gelassen, wie es in dieser Lage nur möglich war.
Ich nickte ihr zu. "Tag", murmelte ich. "So sieht man sich wieder!"
Sie schien nicht zu begreifen. "Wer...?"
"Erinnerst du dich nicht?" Ich duzte sie einfach.
"Woran?", fragte sie unsinnigerweise.
Ich erklärte ihr: "Wir sind uns schon einmal begegnet. Eine Treppe tiefer vor meiner Wohnungstür. Du hattest es ziemlich eilig ..."
Sie atmete tief durch, und irgendwie machte es ganz den Eindruck, als sei ihr eine Zentnerlast vom Herzen gefallen. "Ja", sagte sie. "Ich erinnere mich."
"Hattest du mit jemand anderem gerechnet?"
"Wieso?"
"Es war nur eine Frage."
"Hör mal, ich ..." Sie brach ab und kam etwas näher. Ich blieb in der Tür stehen.
"Bist du eine Freundin von Jürgen Lammers?"
"Wieso?"
Auskunftsfreudig war sie jedenfalls nicht.
"Weil es einen Grund dafür geben muss, dass du in seiner Wohnung bist. Wie bist du überhaupt hineingekommen? Hattest du einen Schlüssel?"
"Was geht dich das alles an?"
"Eigentlich nichts, da hast du Recht."
"Na, also!"
"Trotzdem, es ist doch irgendwie merkwürdig, nicht wahr? Wir treffen uns hier schließlich in der Wohnung eines Mannes, der vor zwei Tagen ermordet wurde und dessen Wohnung von der Polizei versiegelt war. Die Polizei ist ganz wild darauf, sich mit dir zu unterhalten!"
Sie wollte etwas erwidern, aber dann wurde sie durch irgendetwas abgelenkt. Von unten aus dem Treppenhaus waren Schritte zu hören.
"Mein Gott ..." Sie flüsterte es so vor sich hin. Sie hatte Angst. Höllische Angst.
"Was ist los?", fragte ich unnötigerweise.
"Raus hier!", rief sie, und dann lief sie an mir vorbei. Zusammen stolperten wir die Stufen hinab, obwohl ich nicht die geringste Ahnung hatte, worum es hier ging.
Die Schritte von unten kamen bedrohlich näher.
Sie fragte: "Ist das deine Wohnung dort?"
"Ja."
"Dann mach auf! Schnell!"
Ich beschloss, erst einmal zu handeln und dann darüber nachzudenken, obwohl ich es eigentlich lieber anders herum halte. Manchmal kann man es sich eben nicht aussuchen. Ich drehte also den Schlüssel in meinem Schloss herum, und zwei Sekunden später war die junge Frau bereits in meine Wohnung gehuscht.
Gerade noch rechtzeitig.
Aus dem Augenwinkel heraus sah ich zwei Männer die Stufen hinaufhetzen. Der Erste, der die Treppe hochgestürmt kam, wirkte wie eine Kopie von Flash Gordon, dem unerschrockenen Sternenkämpfer und Feind aller intergalaktischen Fieslinge, bekannt aus Comic, Film und Roman-zum-Film.
Ich sah allerdings eine Version des Weltraum-Helden, die man offenbar einem zusätzlichen Bodybuilding-Programm und einer erfolgreichen Gehirnamputation unterzogen hatte.
Er war mindestens einen Meter neunzig groß, und seine hellblonden Haare waren kurz geschoren wie bei einem Fremdenlegionär. Aber seine hellblauen Augen leuchteten lange nicht so hellwach wie die von Flash Gordon. Sie waren trübe und wirkten stumpfsinnig. Sein Gesicht war rot angelaufen, und er keuchte wie ein belgisches Kaltblutpferd.
Durch den verzogenen Mund konnte man seine blitzenden Zähne sehen. Sie schienen noch alle da zu sein, zumindest die vordere Reihe, was bei einem wie ihm wohl nur bedeuten konnte, dass er stets als Erster zugeschlagen hatte.
Vielleicht trug er auch ein Gebiss.
Der Zweite war etwa ein Dutzend Stufen im Rückstand, und dieser Rückstand würde sich wohl eher noch vergrößern. Er hatte einfach nicht die Kondition, um mit der Dampfwalze, die ihm vorauseilte, mitzuhalten. Und das, obwohl Flash Gordon ja schließlich noch seine gesammelten Muskelpakete mit sich herumtragen musste.
Der zweite Mann war vom Äußeren her so etwas wie ein exaktes Gegenstück zu seinem Partner.
Er war klein und drahtig und hatte dunkles Haar. Er wirkte fast wie ein südländischer Typ, wozu aber die verhältnismäßig bleiche Haut nicht passte.
Seine Wangen wurden von einem ungepflegten, dünnen Bart bedeckt, von dem man nicht sagen konnte, ob er absichtlich als Eine-Woche-Bart stehengelassen worden war oder einfach nicht üppiger sprießen wollte.
Flash Gordon würdigte mich nur eines kurzen, dumpfen Blickes, und ich musste einen Schritt zur Seite springen, um von ihm nicht umgerannt zu werden.
Er blieb zwei Sekunden auf dem Treppenabsatz vor meiner Tür stehen und warf einen Blick an mir vorbei in meine Wohnung.
Ich widerstand der Versuchung, mich auch dorthin umzublicken. Ich hoffte nur, dass dort niemand zu sehen sei − aber was immer man auch über die junge Frau sagen konnte, dämlich schien sie nicht zu sein.
Der Kerl hetzte weiter nach oben, und ich ging in meine Wohnung und schloss die Tür hinter mir.
Sicherheitshalber schob ich sogar den Riegel vor. Man konnte ja nie wissen.
Wenn die beiden Wölfe ihre Beute oben bei Lammers nicht vorfanden, kamen sie möglicherweise auf die Idee, woanders nachzusuchen.
Ich ging ins Wohnzimmer und sah sie am Fenster stehen. Sie hatte sich noch nicht so recht beruhigt, das war ihr deutlich anzumerken.
Eine sanfte Röte überzog ihr fein geschnittenes Gesicht, das ich jetzt im Profil zu sehen bekam.
Ich musterte sie, und zwar in diesem Moment wohl erstmalig mit Verstand. Die Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst. Das lindgrüne Kleid, das sie trug, war schlicht, wirkte aber elegant. Und der dezente Schmuck, den sie angelegt hatte, schien echt zu sein.
Im Ganzen machte sie den Eindruck einer Frau, für die Geld kein allzugroßes Problem darstellte. Ich konnte mich täuschen, aber ich glaubte, da richtig zu liegen. Natürlich mochte alles nur Maske sein, aber wenn dem so war, dann war es eine sehr gute. Sie trug ihre Sachen mit großer Selbstverständlichkeit, die darauf hindeutete, dass sie daran gewöhnt war.
Ihre Brust hob sich, als sie tief durchatmete. Langsam schien sie sich wieder zu fassen. Sie wandte sich zu mir um. "Wo sind sie?"
"Deine ... äh ... Bekannten?"
"Für Sarkasmus ist jetzt wohl nicht der richtige Zeitpunkt!"
Eins zu null für sie!, dachte ich. Wo sie Recht hatte, hatte sie sicher auch Recht. Aber ich für meinen Teil hatte wenig Lust, in etwas hineingezogen zu werden, bei dem ich nicht abschätzen konnte, worum es sich handelte. Ich dachte, ich hätte ein Recht auf etwas mehr Information. Es schien allerdings ganz so, als stünde ich mit dieser Auffassung allein da.
"Die beiden sind oben bei Lammers", sagte ich.
Sie fragte: "Was glaubst du? Haben die mich gesehen?"
"Ich hoffe nicht."
"Wieso?"
"Weil es dann wohl Ärger gibt, oder liege ich da falsch?"
"Nein ..."
Wieso − das schien eines ihrer Lieblingswörter zu sein, soviel hatte ich schon begriffen. Wieso, weshalb, warum? − Wer nicht fragt, bleibt dumm! Aber dumm war sie bestimmt nicht. Ob sie allerdings ausgebufft genug war, um es mit denjenigen aufnehmen zu können, deren Ärger sie sich da auf irgendeine Art und Weise zugezogen hatte, das musste einstweilen offen bleiben.
"Wer sind die beiden?", fragte ich.
"Keine Ahnung."
Sie brachte das viel zu prompt und zu schnell heraus, um die Wahrheit sagen zu können. Sie hatte mir schon halb geantwortet, als ich meine Frage noch gar nicht vollständig über die Lippen gebracht hatte. So etwas war einfach verdächtig. Um da stutzig zu werden, brauchte man weder Schimanski zu heißen, noch einen Lügendetektor zu haben!
Ich ging zum Telefon.
"Was hast du vor?", fragte sie.
Da war sie, die berühmt-berüchtigte Daumenschraube. Und ich wollte sie jetzt ein bisschen andrehen.
"Die Polizei interessiert sich für dich. Ich werde sie anrufen."
"Nein, nicht!"
"Warum nicht?"
Ich begann schon einmal zu wählen. Sie musste mir etwas wirklich Einleuchtendes anbieten, um mich zum Aufhören zu bewegen.
"Ich habe Lammers nicht umgebracht!", behauptete sie.
Ich zuckte die Schultern. "Mag schon sein, aber das solltest du nicht mir, sondern der Polizei erzählen!"
"Würde mir dort irgendjemand glauben?"
Ich blickte sie offen an. "Bisher hast du nicht allzuviel zu deiner Glaubwürdigkeit beigetragen!"
"Na, und? Was geht dich das an?"
Das ließ ich abprallen.
Ich sagte: "Du hast einen Wohnungsschlüssel, nicht wahr? Du kannst es ruhig zugeben. Wie hättest du sonst eben in die Wohnung kommen können?"
Als sie antwortete, bekam ihre Stimme einen trotzigen Unterton. Sie klang wie ein ungezogenes Kind, das erwischt worden war. Man hätte darüber lachen können, wenn die Sache nicht so ernst gewesen wäre.
"Ja, ich habe einen Wohnungsschlüssel!", gab sie zu.
"Na, also! Und der Mörder von Lammers hatte wahrscheinlich auch einen!"
"Aber ich bin doch nicht die Einzige, die einen Schlüssel zu seiner Wohnung hat!"
"Nein?"
"Außerdem gibt es andere Wege, eine Tür zu öffnen."
"Richtig. Aber es gab keinerlei Spuren."
"Auch ohne Spuren!"
Ich pfiff durch die Zähne. "Na, du kennst dich ja aus!"
"Ha, ha!", machte sie.
"Wenn du wirklich verhindern willst, dass ich die Polizei anrufe, musst du mir schon Überzeugenderes auf den Tisch legen!"
Sie atmete tief durch, verschränkte die Arme vor der Brust und wirkte dann einen Moment so, als schlucke sie einen Kloß herunter, der ihr im Hals steckte.
"Hör zu, ich bin in der Klemme", begann sie dann und trat an mich heran. Ihre Hand legte sich auf die meine und drückte sie sanft gemeinsam mit dem Hörer hinunter.
"Das klingt ehrlich", sagte ich.
"Was soll das heißen?"
"Das soll heißen, dass du jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal die Wahrheit sagst. Du sitzt in der Klemme. Aber das sieht ein Blinder mit Krückstock!"
"Die beiden wollen mich umbringen!"
"Haben die auch Lammers auf dem Gewissen?"
"Vielleicht. Ich weiß es nicht."
"Mich kannst du ruhig belügen", meinte ich. "Es macht mir nicht das Geringste aus."
Sie verzog das Gesicht. "Was beklagst du dich dann?" Sie machte eine hilflose Geste. "Hör zu", meinte sie dann. "Wenn du die Polizei anrufst, gehe ich augenblicklich nach draußen ins Treppenhaus."
"Ich dachte, die beiden wollen dich umbringen!"
"Das werden sie auch, aber dasselbe werden sie dann auch mit dir tun, denn sie können keinen Zeugen am Leben lassen!"
"Du kommst dir wohl besonders cool vor!"
"Nein", murmelte sie. "Ich bin nur besonders verzweifelt!"
"Und wie soll es jetzt weitergehen?"
"Was weiß ich! Erstmal abwarten, bis die Kerle weg sind!"
 |  |

9

Wir standen beide da und blickten hinab auf die Straße. Und dann sahen wir die zwei Männer auftauchen, den Blonden und den Dunklen. Flash Gordon machte eine ärgerliche Geste und bewegte dabei den Mund.
Es war bestimmt nichts Freundliches, was da über seine Lippen kam.
Die beiden gingen zu einem schwarzen Mitsubishi und fuhren davon. Ich merkte mir die Nummer und hörte die junge Frau neben mir aufatmen.
Ich kannte nicht einmal ihren Namen.
Schade, dachte ich. Schade, dass wir uns nicht unter anderen Umständen getroffen hatten. Irgendwie schien sie Klasse zu haben.
Sie wandte sich zu mir herum. Ihr Gesicht wirkte jetzt etwas entspannter, ihr Blick sanfter. Schließlich lächelte sie sogar ein wenig. Sie sah entzückend aus, wenn sie das tat.
"Danke", sagte sie.
"Wofür?", fragte ich blödsinnigerweise.
"Wahrscheinlich hast du mir das Leben gerettet. Zumindest erheblichen Ärger erspart."
Ich lächelte dünn. "Und jetzt willst du dich aus dem Staub machen, nicht wahr?"
"Natürlich. Was denkst du denn? Ich will weder warten, bis du doch noch die Polizei gerufen hast, noch bis die beiden Typen vielleicht zurückkommen!"
"Glaubst du, sie kommen zurück?"
Sie schüttelte den Kopf. "Nein, eigentlich nicht."
"Wenn die beiden so gefährlich sind, wie du sagst, dann solltest du erst recht zur Polizei gehen", gab ich zu bedenken.
"Du kannst das nicht verstehen."
"Mag schon sein. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass du weißt, was du tust!"
"Ich weiß es sehr genau!"
"Na prima! Jeder stirbt für sich allein!"
"Deinen Sarkasmus könntest du dir abgewöhnen!"
"Ich glaube nicht, dass meine Manieren wirklich so viel schlechter sind als deine!"
Sie lächelte wieder. Ganz kurz nur, aber sie tat es. Und es sah bezaubernd aus. Dann sagten wir beide zwei Sekunden lang gar nichts.
Wir sahen uns nur an, und ich blickte in diese geheimnisvollen graugrünen Augen. Ich weiß auch nicht warum, aber mir kam sofort die Assoziation von Meeresrauschen, meterhohen Wellen und grünem Tang.
Augen sind Fenster der Seele, so heißt es doch immer. Aber leider waren ihre Fenster im Augenblick wohl ziemlich beschlagen. Jedenfalls sah ich bei weitem nicht so viel, wie ich gerne gesehen hätte.
"Du wärst nicht wirklich hinausgelaufen, nicht wahr?", meinte ich.
"Nein", sagte sie. "Das stimmt."
"Ich wusste es."
"Und warum hast du die Polizei dann nicht angerufen?"
"Das wiederum weiß ich nicht."
"Aber du wirst es jetzt tun, nicht wahr?"
"Ja. Ich habe keine Lust, mich selbst in Schwierigkeiten zu bringen. Und ich habe noch weniger Lust, etwas zu decken, von dem ich nicht weiß, ob ich es decken möchte!"
"Das hast du doch schon getan!"
"Stimmt auch wieder. Aber heißt das, dass ich das dauernd tun muss? Ich wollte dich diesen Hyänen nicht in den Rachen werfen."
"Das ist nett von dir."
"Nein, ich habe nur etwas dagegen, wenn jemand umgebracht wird. Ganz gleich aus welchem Grund. Das gilt sowohl für dich, als auch für ..."
"... für Lammers!"
"Du hast es erfasst!"
"Dann werde ich mich jetzt mal aus dem Staub machen! Oder willst du mich daran hindern?"
"Kein Gedanke! Das ist Sache der Polizei. Die machen ihren Job, ich meinen."
Sie ging zur Tür, die vom Wohnzimmer in den Flur führte. Ich folgte ihr nicht. Im Türrahmen blieb sie stehen und drehte sich noch einmal zu mir herum.
"Und was ist dein Job?", fragte sie. "Was machst du?"
"Ich bringe Leute um."
Sie runzelte die Stirn. "Machst du Witze?"
"Ja."
"War aber kein besonders Guter!"
"Es verlangt ja auch niemand, dass du darüber lachst!"
Schließlich lachte sie doch. "Na, dann ist es ja gut!", meinte sie und ging zur Tür.
Ich hörte sie den Schlüssel herumdrehen, der dort noch steckte, und den Riegel zur Seite schieben.
Dann war sie draußen. Ihre Schuhe klapperten über die Treppe.
Ich griff zum Telefon.
 |  |

10

Eine Stunde später saß ich im Präsidium.
"Dann wollen wir mal das Protokoll aufnehmen", meinte der bebrillte Endfünfziger auf der anderen Seite des Schreibtisches, der sich mir mit Müller-Sowieso vorgestellt hatte. Die zweite Hälfte des Namens hatte ich zwar verstanden, aber sogleich wieder vergessen. Einzig der Müller war mir im Gedächtnis haften geblieben. Reichte ja auch völlig.
"Herr Rehfeld möchte gleich noch mit Ihnen reden, aber wir können ja schon einmal anfangen!"
Ich deutete auf die uralte mechanische Schreibmaschine, die er sich bereitgestellt hatte und in die er nun umständlich ein Blatt einspannte − nicht ohne sich dabei die Finger am Farbband zu schwärzen. Seine Fingerabdrücke würden am Ende wohl das Protokoll mit meiner Aussage zieren.
"Mit dieser alten Schraxe?", fragte ich.
"So etwas nennt man Schreibmaschine!"
"Was Sie nicht sagen!"
"Ja, denken Sie mal an!"
"Meines Wissens gibt es inzwischen schon Moderneres!"
"Ja, aber bis das technische Zeitalter bei der Polizei Einzug hält, wird's wohl noch ein paar Jahrhunderte dauern! Wir haben hier für zwanzig Mann drei Diktiergeräte!"
"Und der PC da vorne?"
Er grinste. "Das Programm zur Protokoll-Erstellung hakt, und der System-Administrator hat Urlaub."
Ich grinste auch. "Schon doof."
"Tja."
"Wie wär's damit, die alte Kiste auf den Schrott zu werfen und was Neues zu kaufen?"
"Unser Etat für innere Modernisierung ist auf Jahre ausgeschöpft."
Jetzt tat er mir fast Leid. "Vielleicht sollten Sie und Ihre Leute mal ein bisschen öfter in die Spielzimmer Ihrer Kids schauen. Ich schätze, da werden Sie alles finden, was Sie brauchen!"
"Kann schon sein. Aber wir müssen so viele Überstunden machen, dass wir kaum dazu kommen, einen Blick in irgendwelche Spielzimmer zu werfen!"
Da war er also! Des Pudels Kern, der bei jedem Missstand als Argumente-Knüppel aus dem Sack geholt wurde! Die personelle Unterbesetzung, die vielen Überstunden! Zum fünfhundertsten Mal mussten sie für alles herhalten, was nicht stimmte.
Es dauerte schier endlos, bis meine Aussage endlich auf dem Papier war, denn Müller-Sowieso beherrschte sein Zwei-Finger-Suchsystem nicht besonders gut.
Ich bot ihm an, selbst in die Tasten zu hauen. Schließlich hatte ich meine ersten Romane auf einer Maschine getippt, die noch schlechter war als die, die da jetzt zwischen uns auf dem Schreibtisch stand.
Aber das lehnte er ab. Warum, das sagte er mir nicht. Vermutlich ging es ihm gegen die Ehre. Zu dumm, dass mich sein Stolz so viel Zeit kostete. Zeit genug, um ein paar Seiten an den ›Gnadenlosen Wölfen‹ herunterzureißen. Im Kopf rechnete ich den Verlust aus.
Ich sollte Müller-Sowieso auch auf Schadensersatz verklagen!, dachte ich. Ihn und den toten Lammers - posthum sozusagen - und vielleicht auch noch die unbekannte Schöne mit den grüngrauen Augen und noch ein paar andere Leute, die mir in letzter Zeit auf die Nerven gegangen waren oder mich sonstwie von meiner Arbeit abgelenkt hatten!
Leider würde sich meine Rechtsschutzversicherung wohl weigern, solche Fälle zu übernehmen!
Stück um Stück kamen wir vorwärts, und endlich konnte ich dann meine drei Kreuze unter das Schriftstück setzen.
Müller-Sowieso seufzte erleichtert. Ich seufzte auch.
Und dann kam Rehfeld. Müller-Sowieso verzog sich und nahm die Schreibmaschine mit, während Rehfeld seinen Mantel auszog und an einen Haken hängte. Dann setzte er sich dorthin, wo zuvor Müller-Sowieso gesessen hatte.
Die Hydraulik des Bürostuhls gab einen seltsamen Laut von sich, als er niederplumpste.
"Sie war also bei Ihnen, Herr Hellmer."
"Richtig. Das habe ich Ihnen ja am Telefon gesagt."
"Sie hat sich nicht zufällig vorgestellt und Ihnen ihre Adresse gegeben?"
"Nein."
"Zu schade!"
"Sie war nicht sehr gesprächig! Und sie wollte sich partout nicht mit Ihnen unterhalten!"
Rehfeld lachte heiser und kehlig, wobei sein Doppelkinn vibrierte. "Wird wohl einen Grund dafür haben, die Dame ..."
Und dann zog er ein Foto hervor und legte es mir unter die Nase. Ich sah kurz hin. Dort war ein junges Mädchen zu sehen mit Punk-Frisur und einer Sicherheitsnadel im linken Ohrläppchen. Das Gesicht war zu einer Fratze verzogen.
"Wer soll das sein?"
"Schauen Sie mal genau hin! Könnte das nicht die Frau sein?"
"Die, die mir begegnet ist, war besser angezogen! Und auch älter."
"Das Foto ist acht Jahre alt!"
Ich nahm das Bild mit zwei Fingern und sah es mir noch einmal an. Und dann sah ich es auch. Ja, sie war es. Ein paar Jahre jünger und furchtbar zurechtgemacht, aber sie war es, da konnte es nicht den Hauch eines Zweifels geben. Ich weiß nicht, was es war, das mich so sicher machte. Vielleicht ihre Augen. Die hatten sich nicht verändert, nicht ein bisschen. Ein Gesicht kann man schminken, Haare können gefärbt, gerollt, gewickelt oder sonstwas werden.
Aber Augen?
Ich nickte also. "Sie ist es."
"Gott sei Dank", seufzte Rehfeld.
"Warum?"
"Weil wir dann wenigstens etwas haben."
"Wer ist sie?"
"Sie heißt Annette Friedrichs und hat ein ziemlich trauriges Leben hinter sich. Erziehungsheim, Ausbruch, Ladendiebstahl, ein anderes Erziehungsheim, Motoraddiebstahl, Einbruch, Prostitution und so weiter und so fort. Dieses Foto wurde gemacht, als sie gerade angefangen hatte, mit Koks zu dealen."
"War sie süchtig?"
"Es würde mich wundern, wenn es anders wäre!"
"Wie haben Sie sie so schnell ausfindig machen können?"
"Ihre Telefonnummer stand in Jürgen Lammers Adressbuch."
"Dann wissen Sie doch sicher auch, wo sie wohnt."
"Nur, wo sie gemeldet ist."
"Verstehe ich nicht."
"Wir haben ihrer Wohnung einen Besuch abgestattet."
"Und?"
"Sie war nicht da. Die Post von Wochen stapelte sich im Briefkasten."
"Merkwürdig ..."
"Ja, nicht?"
Ich legte das Foto wieder auf den Tisch. "Kaum zu glauben, dass das dieselbe Frau ist. Sie scheint Karriere gemacht zu haben. Ihr Outfit war nicht von schlechten Eltern."
Rehfeld zog sich den dicken Windsorknoten an seiner Gurgel zurecht.
"Fragt sich nur, womit sie Karriere gemacht hat. Gelernt hat sie nämlich nichts. Und sie hat auch weder zum Einbrecher noch zum Koks-Dealer viel Talent bewiesen! Schließlich ist sie bei beidem erwischt worden."
"Wer weiß, vielleicht hat sie ja dazugelernt."
"Glaube ich nicht."
"Dann hat sie wohl noch andere Talente."
"Was meinen Sie damit?"
Ich zuckte mit den Schultern. "Sie sieht gut aus. Sie wird sich jemanden angelacht haben, dessen Brieftasche dick genug war, um sie auszuhalten."
Damit stand allerdings wohl fest, dass es sich bei diesem Jemand auf keinen Fall um einen Schreiber von Heftromanen handeln konnte!
"Wenn sie sich bei Ihnen meldet ..."
Ich runzelte die Stirn. "Weshalb sollte sie das?", fiel ich dem dicken Rehfeld ins Wort.
"Was weiß ich? Sie ist einmal in Ihrer Wohnung gewesen. Vielleicht laufen Sie ihr ja noch mal über den Weg."
"Was soll ich dann tun? Ihr Ihre freundliche Einladung überbringen? Das habe ich bereits einmal versucht. Ohne viel Erfolg."
Ich erhob mich.
Irgendwie verstand ich Rehfelds Dilemma. Er konnte schließlich nicht die Betten sämtlicher vermögenderer Herren im Umkreis von 20 Kilometern durchsuchen.
"Was hat diese Annette eigentlich mit Lammers zu tun?", fragte ich.
Rehfeld zuckte mit den Schultern. "Nichts. Außer, dass sie in seinem Adressbuch stand."
"Vielleicht war Lammers ja derjenige, der sie aushielt."
Diese Vermutung klang ziemlich behämmert, aber jetzt war sie einmal ausgesprochen und ließ sich nicht wieder rückgängig machen.
Lammers schien mir nicht zu jenen zu gehören, die finanziell in der Lage waren, sich eine Geliebte zu halten, mit Exklusivrechten, sozusagen.
Wenn er vermögend gewesen wäre, hätte er sicherlich eine andere Wohnung gehabt.
Nein, zu jemandem wie Lammers passte es eher, sich zweimal im Jahr einen Besuch im Eros-Center zu leisten. Und wahrscheinlich musste er da schon fleißig drauf sparen!
Aber genau in dem Punkt irrte ich mich, wie sich herausstellen sollte.
"Seltsam, dass Sie das sagen", meinte Rehfeld und stand jetzt ebenfalls auf.
Der Unterton, in dem er das gesagt hatte, gefiel mir nicht. Es war der Pass-nur-auf-ich-krieg-dich-schon-Ton, den die Fernsehkommissare immer dann an sich hatten, wenn sie sich ganz sicher waren, dass ihr Gegenüber Dreck am Stecken hatte.
Rehfeld kam zu mir herüber, blies sich auf wie ein Heißluftballon und streckte mir dabei seine stramme Wampe entgegen. "Mir scheint, Sie wissen mehr, als Sie mir weismachen wollen!"
"Ich habe Ihnen alles gesagt."
"So?"
"Ja!"
"Wie kommen Sie dann darauf, dass sich Lammers eine Geliebte leisten konnte? Er ist arbeitslos und lebt von der Sozialhilfe. Wie sind Sie darauf gekommen, dass er trotzdem genug Geld hatte, um ..."
Ich hob die Schultern und machte ein Gesicht, das möglichst unschuldig wirken sollte. "Es war einfach nur ein Gedanke!"
"Allerdings einer, der genau ins Schwarze trifft!"
"Ich verstehe nur Bahnhof!"
"Lammers verfügte über ein Nummernkonto in der Schweiz. Schon merkwürdig, nicht? Aber, dass Sie davon wussten, Hellmer, das ist noch merkwürdiger!"
Jetzt schlug es aber dreizehn! Eine ganze Sekunde brauchte ich, um diesen Verbalschlag zu verdauen. "Ich wusste nichts davon!", behauptete ich und fand mich selbst nicht so recht überzeugend dabei.
Rehfeld rollte genervt mit den Augen. "Ach, kommen Sie, Hellmer, Sie haben sich verplappert!"
Ich lächelte dünn. "Irgendwie scheinen Sie was gegen mich zu haben. Mögen Sie keine Western-Romane?"
Rehfeld grinste schief. "Nein, mag ich nicht. Ist das ein Fehler?"
"Das ist eine Sache des Standpunktes!"
"Ich weiß, dass der Trend zum Zweitbuch geht, aber man muss ja nicht jede Mode mitmachen, oder?" Rehfeld machte eine hilflose Geste und ging dann ein paar Schritte auf und ab.
Schließlich wirbelte er wieder zu mir herum und hielt mir beschwörend seinen dicken, fleischigen Zeigefinger unter die Nase.
Mir fiel auf, dass er abgekaute Nägel hatte. Aber womit sollte er sich auch in seinen vielen Überstunden beschäftigen, die er hier, zwischen seinen Akten verbrachte, der Arme!
"Ich habe mich bei den anderen Hausbewohnern über Sie erkundigt, Hellmer!"
"Herr Hellmer für Sie. Soviel Zeit muss sein!"
"Sie hatten noch am Tag vor Lammers Tod einen heftigen Streit im Treppenhaus mit ihm, Herr Hellmer. Nicht wahr? Einen Streit, der so laut war, dass man ihn ..."
"... bei Meyers noch hören konnte, obwohl sie Fernseher und Stereoanlage gleichzeitig eingeschaltet hatten!", schnitt ich ihm das Wort ab.
Er nickte. "So ähnlich, ja."
"Worauf wollen Sie eigentlich hinaus?", fragte ich.
"Ich glaube, dass Sie uns einiges verschweigen, Herr Hellmer."
"Und was zum Beispiel?"
"Ich hätte zum Beispiel gerne gewusst, worum es bei Ihrem Streit am Tag vor dem Mord ging."
"Haben Ihnen das die Meyers nicht gesagt?"
"Ich möchte es von Ihnen hören."
"So gute Ohren haben die beiden dann wohl doch nicht, was?"
"Also ..."
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2018
- ISBN (ePUB)
- 9783738918700
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (Juni)
- Schlagworte
- münster-wölfe toter killer zwei krimis