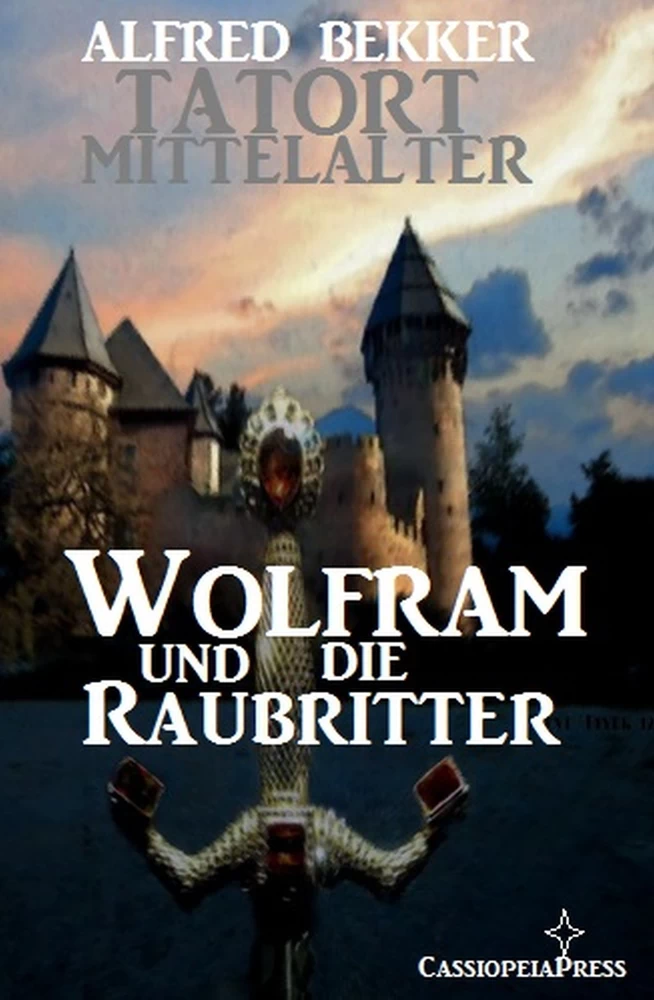Zusammenfassung
Tatort Mittelalter Band 3
von Alfred Bekker
Der Umfang dieses Buchs entspricht 112 Taschenbuchseiten.
Wolfram, Page auf Burg Wildenstein, und sein Freund Ansgar, der bereits Knappe ist, müssen eine wichtige Botschaft für Baron Wildenstein überbringen. Doch dabei werden sie von Raubrittern überfallen. Ansgar wird gefangen genommen und Wolfram kann fliehen. Ihr Burgherr ist nicht bereit, das geforderte Lösegeld zu bezahlen, doch Wolfram tut alles, um seinen Freund zu befreien.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
 |  |

Wolfram und die Raubritter

Tatort Mittelalter Band 3
von Alfred Bekker
Der Umfang dieses Buchs entspricht 112 Taschenbuchseiten.
Wolfram, Page auf Burg Wildenstein, und sein Freund Ansgar, der bereits Knappe ist, müssen eine wichtige Botschaft für Baron Wildenstein überbringen. Doch dabei werden sie von Raubrittern überfallen. Ansgar wird gefangen genommen und Wolfram kann fliehen. Ihr Burgherr ist nicht bereit, das geforderte Lösegeld zu bezahlen, doch Wolfram tut alles, um seinen Freund zu befreien.
 |  |

Copyright

Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2015 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
 |  |

1

Die beiden Reiter erreichten den Kamm des Hügels. Einer von ihnen zügelte sein Pferd und drehte sich im Sattel herum - ein zehnjähriger Junge, für den der hochbeinige Apfelschimmel ziemlich groß war.
Der Blick des Jungen ging zurück. In der Ferne lag auf einer Anhöhe Burg Wildenstein. Die grauen Mauern wurden von den Strahlen der Morgensonne in ein ganz besonderes Licht getaucht. Hier und da hingen auf den Wiesen noch Nebelbänke.
Es war kühl. Der Junge auf dem Pferd zog sich seinen Umhang enger um die Schultern.
„Nun, komm schon, Wolfram! Worauf wartest du noch?“, fragte der zweite Reiter, der inzwischen ebenfalls sein Pferd gezügelt hatte.
Der zehnjährige Wolfram wandte den Kopf in Richtung seines Gefährten.
„Auf gar nichts“, sagte er.
„Dann weiß ich nicht, weshalb du angehalten hast! Schließlich sollen wir doch vor Einbruch der Dunkelheit die Mühle am Krötenbach erreichen! Oder hast du vielleicht Lust dazu, bei Finsternis durch die Wälder zu irren?“
„Nein...“
„Na, also!“
Wolfram diente seit drei Jahren als Page auf Burg Wildenstein und durchlief damit die erste Stufe der Ausbildung zum Ritter. Zusammen mit seinem Freund Ansgar war er in aller Frühe aufgebrochen, um für Baron Norbert, ihren Burgherrn, eine Botschaft zur Mühle am Krötenbach zu überbringen.
Ansgar war vierzehn und damit schon eine Stufe weiter auf dem Weg zum Ritterschlag, den er zwischen seinem achtzehnten und einundzwanzigsten Lebensjahr erhalten würde – falls sich mindestens drei Ritter fanden, die bestätigten, dass er sich in der Zwischenzeit als würdig erwiesen hatte, in den Ritterstand aufgenommen zu werden.
Während Wolframs Aufgaben noch überwiegend darin bestanden, den Burgherrn und die Burgherrin zu bedienen und zu lernen, wie man sich an einem Burghof ritterlich benahm, so war es Ansgars Aufgabe, sich um das Pferd, die Waffen und die Rüstung seines Ritters zu kümmern. Sobald er etwas älter war, durfte er ihn auch in die Schlacht begleiten.
Wolfram übte sich zwar auch schon fleißig im Umgang mit dem Schwert und der Lanze, aber im Gegensatz zum älteren Ansgar musste er mit Holzwaffen trainieren, wie es für Pagen seines Alters üblich war.
Ansgar hatte sich schon des Öfteren deswegen über seinen Freund lustig gemacht.
Wolfram konnte das natürlich nicht leiden und ärgerte sich jedes Mal furchtbar darüber. Schließlich eiferte er in allem seinem älteren Freund so gut es ging nach.
Gleichgültig, ob es um den Faustkampf oder das Bogenschießen ging – Wolfram versuchte Ansgar ebenbürtig zu sein.
Das war natürlich kaum möglich.
Schließlich war Ansgar vier Jahre älter und dementsprechend größer und stärker.
Trotzdem gab Wolfram nie auf und wenn er dann von seinem Freund ausgelacht wurde, war das besonders verletzend für ihn.
Ansgars Stirn umwölkte sich, als Wolfram noch immer keine Anstalten machte, seinem Pferd endlich die Hacken in die Weichen zu stoßen und das Tier voranpreschen zu lassen.
Der Weg zur Mühle am Krötenbach war weit und es war alles andere als ein Vergnügen, zu dieser Jahreszeit in den düsteren Wäldern jener Gegend nach Anbruch der Dunkelheit herumzuirren.
Es war bereits November und die Tage waren schon spürbar kürzer geworden. Die Sonne ging früh unter und schon aus diesem Grund mussten sich die beiden Jungen beeilen, um die Mühle am Krötenbach doch noch vor Einbruch der Nacht zu erreichen.
Wolfram knurrte etwas Unverständliches vor sich hin.
Er ließ sein Pferd erneut den Hügel empor traben, von dem aus Wolfram noch immer zurück zur Burg blickte.
„Ist dein Gaul festgewachsen – oder was ist sonst geschehen?“, rief Ansgar.
„Einen Moment noch!“, erwiderte Wolfram und streckte dabei den Arm aus.
„Siehst du es nicht? Da kommt Kaspar!“
Ansgar blickte angestrengt in Richtung der Burg. Dann sah auch er, wie sich im hohen Gras etwas bewegte. Augenblicke später kam ein Hund mit grauem, zotteligen Fell aus dem Gras hervor und rannte schwanzwedelnd auf Wolfram und Ansgar zu.
Wolfram stieg aus dem Sattel und machte das Pferd an einem Strauch fest, um den Hund zu begrüßen. Kaspar sprang ihm an den Beinen hoch und schien sich unbändig darüber zu freuen, ihn gefunden zu haben. Das graue, ziemlich verfilzte Tier war ein Streuner, den es immer dann zur Burg Wildenstein hinzog, wenn er hoffen durfte, dort etwas von den Küchenabfällen bekommen zu können.
Manchmal war er tagelang verschwunden und streifte dann auf eigene Faust durch die Wälder und Wiesen des Wildensteiner Landes.
Für Wolfram und Ansgar war der Hund inzwischen zu einem treuen Gefährten geworden, der ihnen schon in manch brenzliger Situation geholfen hatte.
„Ist ja gut, Kaspar! Wir nehmen dich mit“, redete Wolfram auf das Tier ein.
„Ist das wirklich dein Ernst?“, fragte Ansgar inzwischen. Der Knappe war alles andere als begeistert von der Aussicht, dass der Hund sie auf ihrem Ritt zur Mühle am Krötenbach begleiten würde.
„Natürlich!“
„Der wird uns nur aufhalten, wenn er sich einen Dorn in die Pfote tritt und humpelt.“
„Ach, Ansgar, das passiert schon nicht!“
„Und wenn er plötzlich einen Hasen riecht und ihn die Jagdleidenschaft packt? Du weißt genau, dass er dann nicht zu halten ist und wir können in dem Fall erst einmal darauf warten, dass er wieder auftaucht!“
„Ich glaube, es ist ganz gut, einen Hund bei sich zu haben, wenn man durch die dunklen Wälder rund um den Krötenbach zieht“, war Wolfram überzeugt. „Außerdem haben wir ohnehin keine Wahl.“
„Wieso?“
„Na, dann versuch doch mal, dem Tier klar zu machen, dass es uns nicht einfach folgen soll!“
„Witzbold!“
„Du kennst Kaspar doch. Er ist schließlich kein abgerichteter Jagdhund, der seinem Herrn aufs Wort folgt, sondern hat seinen eigenen Willen!“ Ansgar atmete tief durch und machte anschließend eine wegwerfende Handbewegung.
„Mach doch, was du willst, Wolfram – aber komm jetzt endlich!“ Der Knappe ließ sein Pferd vorangaloppieren. Wolfram schwang sich wieder auf den Rücken seines Apfelschimmels und folgte dem Freund. Kaspar hechelte nach kurzem Zögern hinter den beiden Reitern her.
 |  |

2

Gegen Mittag machten sie in einem Dorf kurz Rast, dass auf ihrem Weg lag.
Sie tränkten die Pferde am Dorfbrunnen, aßen etwas von ihrem mitgenommenen Proviant und ritten dann rasch weiter, da sie keine Zeit zu verlieren hatten.
Als sie die Wälder erreichten, durch die der Krötenbach floss, dämmerte es bereits und die ersten Nebelschwaden krochen aus den Wiesen heraus, die die Waldgebiete hin und wieder unterbrachen.
Es wohnten nicht viele Menschen in diesem abgelegenen Zipfel des Wildensteiner Landes. Dass der Müller der Krötenbach-Mühle sich in diese Gegend zurückgezogen hatte, lag einfach daran, dass es kaum einen besseren Platz gab, um eine Wassermühle zu betreiben.
Dafür nahm er es dann auch in Kauf, dass das Korn einen langen Weg zu ihm hatte.
Ansgar zügelte sein Pferd, als sie erneut ein düsteres Waldstück hinter sich gebracht hatte und eine Lichtung erreichten.
Er drehte sich im Sattel herum.
„Jetzt sag bloß, du weißt den Weg nicht mehr“, meldete sich Wolfram zu Wort. Der ältere Ansgar war bereits einmal vor fast einem Jahr zusammen mit Ferdinand von Walden, dem Ritter, dem er zugeteilt war, hierher geritten und hatte vor Baron Norbert von Wildenstein damit geprahlt, dass es kein Problem für ihn sei, die Mühle zu finden.
Wolfram hatte die Worte seines Freundes noch gut im Ohr. „Nein, es ist nicht nötig, dass uns einer der Ritter oder Knappen begleitet! Ich kenne den Weg fast wie im Schlaf, wie Ihr sehen werdet, Herr! Höchstens in der Dunkelheit könnte man sich dort verirren, aber bis zu deren Einbruch werden wir längst dort sein!“ Sicherheitshalber hatte Baron Norbert von Wildenstein seinem Knappen den Weg dann noch einmal ausführlich und mit sehr eindringlichen Worten beschrieben.
Wolframs Ohren waren dabei natürlich ebenfalls weit offen gewesen.
Je mehr er sich von den Worten des Barons merken konnte, desto besser, war ihm klar gewesen.
Der Auftrag, den die beiden Jungen auszuführen hatten, bestand darin, dem Müller vom Krötenbach ein Dokument zu übergeben, mit dem er zu einem der Hoflieferanten des Barons ernannt wurde.
Ansgar trug dieses Dokument in einer Tasche bei sich, die ihm um die Schultern hing.
„Sag bloß, du bist dir jetzt nicht mehr sicher, wo es lang geht!“, meinte Wolfram.
Obwohl Ansgar vor dem Baron so sehr angegeben hatte, war Wolfram jetzt kein bisschen Schadenfroh. Schließlich wäre es auch für ihn ein großes Unglück gewesen, wenn sie die Mühle nicht vor Einbruch der Dunkelheit fanden.
Wie ein graues Tuch legte sich die Dämmerung über das Land. Die Sonne versank hinter den Baumkronen, an denen inzwischen kaum noch Blätter waren.
Der kühle Wind aus Nordosten ließ beide Jungen leicht frösteln. Wolfram erinnerte sich an die unheimlichen Geschichten, die man sich über die Wälder am Krötenbach erzählte. Angeblich waren dort in früherer Zeit Räuberbanden zu Hause gewesen, aber das war lange her. Seitdem Baron Norbert die Burg Wildenstein und das umliegende Land als Lehen übertragen bekommen hatte, war weder einer der Kornfahrer noch irgendein Händler überfallen worden.
„Nun sag schon, wohin wir reiten sollen!“, forderte Wolfram, nachdem Ansgar einige Augenblicke lang suchend den Blick über das dichte Unterholz hatte schweifen lassen. Mit einer Handbewegung gebot Ansgar Wolfram zu schweigen und der Jüngere merkte sofort, dass es dem Knappen jetzt auf einmal sehr ernst war.
Irgendetwas musste geschehen sein, was Wolfram bisher noch nicht bemerkt hatte.
Auch Kaspar wirkte auf einmal sehr aufmerksam und unruhig. Er hob immer wieder den Kopf und hielt die Nase hoch, so als versuchte er Witterung aufzunehmen.
Ein krächzender Schrei durchdrang die Stille.
Schwarze Schwingen erhoben sich von einer Baumgabel. Ein Greifvogel breitete sein Gefieder aus und erhob sich in die Lüfte. Zunächst flog er hoch empor, zog einen weiten Bogen durch die Luft und befand sich schließlich hoch über den Wipfeln der schon ziemlich kahlen Bäume.
Dann stürzte er hinab und verschwand im dichten Geäst des Unterholzes.
„Da ist irgend jemand“, raunte Ansgar. „Und vielleicht beobachtet er uns.“
„Aber...“
„Hast du den Falken gesehen?“
„Ja, aber erst als er empor geflogen ist. Vorher war er so perfekt getarnt, dass man sein Gefieder nicht von der Rinde des Baumes unterscheiden konnte, auf dem er saß.“
„Das war kein gewöhnlicher, wild lebender Greifvogel – sondern ein Tier, das zum Jagen abgerichtet wurde! Da können wir wetten! Die Art, wie er plötzlich zu Boden stieß....“
„Er könnte doch auch Beute entdeckt haben und deshalb von seinem Platz weggeflogen sein!“
„Der Waldboden unter dem dichten Unterholz dürfte selbst für den Falken kaum zu sehen ein! Außerdem hätte er sich im dichten Gestrüpp womöglich verletzt.“ Ansgar schüttelte entschieden den Kopf. „Nein, Beute hätte er auf der Lichtung machen können – es sei denn im Unterholz hat er seinen Herrn entdeckt, der ihm im Falknerhandschuh ein Stück Fleisch entgegenhielt.“ Die Jagd mit Greifvögeln war weit verbreitet und das dressieren dieser eigensinnigen Tiere galt als eine der höchsten Künste und wurde Beize genannt.
Außerdem war es die einzige Form der Jagd, die vielerorts auch den Nichtadeligen gestattet war. Falkner gehörten zu den angesehenen Männern an den Burghöfen und für einen gut abgerichteten Falken konnte man ein halbes Vermögen ausgeben.
Allerdings konnte man nicht einfach mit irgendeinem Greifvogel auf die Jagd gehen. Das war nämlich in der so genannten Hackordnung genau festgelegt.
Danach war der Adler dem Kaiser vorbehalten.
Nur er durfte mit seiner Hilfe Hasen und Rebhühner erlegen! Ein König ging mit einem etwas kleineren Geierfalken auf die Jagd, Prinzen und Grafen benutzen Wanderfalken und ein Baron wie Norbert von Wildenstein musste sich mit einem vergleichsweise kleinen Bussard begnügen. Dessen einfache Ritter wiederum jagten mit den als weniger edel geltenden Würgfalken. Diese „Hackordnung“ entsprach genau der Rangfolge auf der Burg. Ganz unten in dieser Rangfolge stand der Leibeigene, dem für die Jagd lediglich ein winziger Turmfalke zur Verfügung stand, so fern er sich diesen überhaupt leisten konnte. Dabei war es nicht so schwer, an einen dieser winzigen Falken heranzukommen. Viel aufwändiger war es, ihn ausbilden zu lassen und für seine Ernährung zu sorgen. Ohne genügend frisches Fleisch tat auch ein abgerichteter Greifvogel nämlich gar nichts – zumindest nicht das, was sein Herr von ihm verlangte. Der Vogel reagierte nur auf Belohnung, nie auf Bestrafung. Bestand keine Aussicht auf diesen Lohn in Form von Leckereien und vor allem frischen Fleischstückchen, konnte es sein, dass auch ein sehr edles Tier wie der Bussard des Barons, einfach auf und davon flog und für lange Zeit nicht wiederkehrte.
Neben genügend frischem Fleisch musste jemand, der auf Falkenjagd gehen wollte noch etwas anderes aufbringen, das mindestens genauso wichtig war: Viel Zeit. Um aus einem Falken einen treuen Jagdgefährten zu machen, musste man täglich mindestens eine Stunde mit ihm trainieren.
Ansgar ließ das Pferd ein paar Schritte über die Lichtung traben und zügelte es dann erneut.
Wolfram folgte ihm.
Kaspar rannte weiter in Richtung Waldrand, aber irgendetwas veranlasste ihn dann dazu, ziemlich abrupt zu stoppen. Der Hund duckte sich, klemmte den Schwanz ein und kehrte zurück.
Auch er spürt, dass dort jemand ist!, durchzuckte es Wolfram.
Aber wer?
Ganz sicher nicht eine Jagdgesellschaft der Ritter von Burg Wildenstein, denn dann hätten Wolfram und Ansgar davon zweifellos gehört.
„Der Vogel – ich glaube, ich habe so einen schon mal gesehen!“, war Wolfram plötzlich überzeugt.
„So, wo denn?“, zischte Ansgar kaum hörbar zwischen den Zähnen hindurch.
„Der Falkner Hardewind hat mehrere davon dressiert und verkauft. Ich habe ihn gefragt, wie diese Sorte heißt, und er hat geantwortet, es seien Hühnerhabichte!“ Ansgar atmete tief durch.
Bis zu diesem Augenblick hatte seine rechte Hand den Griff des langen Dolchs umfasst, den er an seinem Gürtel trug. Jetzt ließ er ihn los.
„Ein Hühnerhabicht? Bist du dir sicher?“
„Wieso?“
„Weil es sich dann bei dem Jäger nach der Hackordnung um einen freien Bauern handeln muss – und nicht um einen fremden Ritter!“ Ein fremder Ritter, der in das Wildensteiner Land gelangt wäre, hätte der Höflichkeit entsprechend zunächst einmal auf der Burg nachgefragt, ob es dem Baron recht wäre, wenn er in dessen Wäldern auf die Jagd ging.
Ein freier Bauer hingegen, der in diesem Land beheimatet war, hatte jederzeit das Recht, der Falkenjagd nachzugehen, so fern diese nicht gerade durch den jeweiligen Burgherrn eingeschränkt wurde. Das geschah immer dann, wenn der Wildbestand knapp war. Die wenigen Hasen und Rebhühner, die in schlechten Jahren noch durch die Wälder und Wiesen streiften, sollten dann für die hohen Herrschaften reserviert werden.
Mit der Zeit waren immer mehr Adelige dazu übergegangen, auch die Falkenjagd ihrer Untergebenen einzuschränken. Die Jagd mit Pfeil und Bogen oder Speer war dem einfachen Volk ohnehin verboten. Sehr zum Verdruss der Bauern, denn das Jagen von Wildschweinen, die auf den Feldern großen Schäden anrichteten, war mit einem Falken nun einmal nicht möglich.
Immer wieder kam es daher vor, dass Wilderer die Verbote der Adeligen missachteten.
Bei der Bevölkerung waren diese Wilderer beliebt, denn erstens sorgten sie dafür, dass es weniger Großwild gab, das die Felder schädigte und zweitens hatte das Recht, auch mit Pfeil und Bogen zu jagen, schließlich früher allen zugestanden.
Die Erinnerung daran hatten die Adeligen nicht auslöschen können. Sie lebte in vielen Erzählungen fort. Viele Bauern fürchteten nun, dass ihnen eines nicht mehr fernen Tages auch die Jagd mit dem Hühnerhabicht oder dem Turmfalke nicht mehr erlaubt sein würde.
Jetzt ertönte erneut ein Geräusch.
Etwas raschelte im Unterholz.
Zweige bewegten sich.
Kaspar bellte einmal laut, beugte den Kopf, knurrte zunächst und wich dann jedoch noch etwas weiter zurück, sodass er sich schließlich sogar noch hinter den Pferden der beiden Jungen befand.
Einen mutigen Hund haben wir da!, dachte Wolfram. Kaum zu glauben, dass er in anderen Situationen schon gezeigt hat, dass man sich voll und ganz auf ihn verlassen kann!
Aber im Moment sah es wirklich nicht danach aus.
Die Büsche teilten sich und ein breitschultriger Mann in einem graubraunen Wams trat hervor.
Schon sein Äußeres verriet, dass es sich tatsächlich um einen Bauern handelte.
Das Haar war über den Ohren abgeschnitten. Nur Adeligen war es schließlich erlaubt, lange Haare zu tragen. Und was die schmucklose graubraune Kleidung anging, so entsprach sie der geltenden Kleiderordnung. Gefärbte Kleidung durften nur höhergestellte Personen tragen. Jeder hatte seinen Platz in der Gesellschaft, so hatte es auch Wolfram gelernt. Und das bedeutete unter anderem auch, dass man einem jeden schon vom Äußeren her ansehen sollte, ob er Graf, Baron, Ritter oder nur ein Bauer war.
Der Mann trat noch einen Schritt nach vorn.
Der Hühnerhabicht saß auf dem Falknerhandschuh, mit dem er die linke Hand und den Unterarm schützte. Er war aus dickem Schweinsleder gefertigt, denn die Krallen des Habichts waren ja schließlich scharf genug, um einen Hasen zu erlegen.
Auf der anderen Seite hing dem Mann eine Tasche über der Schulter, in der sich zweifellos die Fleischbrocken befanden, mit denen der Bauer den Hühnerhabicht belohnte.
Der Raubvogel breitete die Flügel aus.
Er wirkte etwas nervös.
Sein Besitzer hatte ihm eine Haube über den Kopf gezogen, die seine überaus scharfen Augen bedeckte. Das diente dazu, den Vogel zu beruhigen, wie Wolfram sehr wohl wusste. Auch wenn der Umgang mit Jagdfalken noch nicht Teil seiner Ausbildung gewesen war, so hatte er doch des Öfteren schon Ansgar und die älteren Jungen dabei beobachten können, wie einer der Falkner von Burg Wildenstein ihnen ein paar Kniffe zeigte, mit denen die eigenwilligen Greifvögel zu treuen Jagdgefährten wurden.
Der Bauer verneigte sich.
„Verzeiht, hohe Herren, dass ich Euch erschreckt habe!“, sagte er.
Die Tatsache, dass er ein Erwachsener war und außerdem wahrscheinlich Haus, Hof und Kinder besaß, änderte nichts daran, dass er den beiden Jungen vom Rang her weit untergeordnet war. Schließlich waren Ansgar und Wolfram die Söhne adeliger Ritter und Burgherren, dieser Mann hingegen nur ein Bauer.
Der Mann atmete tief durch.
Er schien aus irgendeinem Grund sehr erleichtert zu sein.
„Wer bist du?“, fragte Wolfram.
„Mein Name ist Sebald und ich bewirtschafte hier in der Nähe einen Hof auf eigenem Grundbesitz.“
„Dann nehme ich an, weißt du auch, wo die Mühle am Krötenbach ist!“, glaubte Wolfram. „Auch wenn mein Freund hier es nicht gerne zugeben will, aber ich glaube, wir sind vom Weg abgekommen.“
Ansgar warf Wolfram einen wütenden Blick zu.
Er fühlte sich von dem jüngeren ziemlich bloßgestellt. Aber ihm blieb nicht viel Zeit, sich über Wolframs Worte zu ärgern.
Der Bauer antwortete mit ruhiger und vertrauenserweckender Stimme.
„Wenn ihr eine Weile in östliche Richtung reitet, müsstet ihr auf den Krötenbach stoßen. Und dem braucht ihr dann nur gegen die Strömung zu folgen, dann könnt ihr die Wassermühle von Meister Lamphart gar nicht verfehlen.“
„Ich danke dir!“, erwiderte Wolfram. „Dann werden wir es ja vielleicht doch noch vor Einbruch der Dunkelheit bis zur Mühle schaffen!“ Doch das Gesicht des Bauern Sebald blieb sehr ernst. Er blickte sich um, so als müsste er ständig vor irgendetwas oder irgendjemandem auf der Hut sein.
„Normalerweise hättet Ihr recht, junger Herr“, sagte er.
Wolfram runzelte die Stirn.
„Normalerweise?“, echote er.
„Im Augenblick würde ich Euch nicht empfehlen, diesen Weg zu nehmen!“
„Aber wieso nicht?“
„Um die Wahrheit zu sagen, ich würde Euch sogar raten, die Mühle am Krötenbach ganz zu meiden und einen weiten Bogen um sie herum reiten!“
„Das geht nicht, wir haben dort für den Baron von Wildenstein eine Botschaft zu überbringen“, mischte sich nun Ansgar in das Gespräch ein, dem es sichtlich missfiel, dass sein jüngerer Freund sich in den Vordergrund gespielt hatte.
„Jedenfalls soll niemand hinterher sagen können, dass ich Euch nicht gewarnt hätte“, erwiderte Sebald. „Ich bin einer Gruppe fremder, bewaffneter Reiter begegnet.“
„Ritter?“, hakte Wolfram nach.
Sebald lachte heiser.
„Ihrer Kleidung und Bewaffnung nach ja! Und ihre Wappen und Feldzeichen an den Lanzen und den Satteltüchern der Streitrösser sprachen auch dafür, dass es sich um Ritter handelte – aber ritterlich kann ihr Benehmen wohl nicht gewesen sein. Sie trieben Kühe und Schafe vor sich her, die mit den Zeichen der Wildensteiner Bauern versehen waren! Ein Händler mit seinem Handwagen schien ihr Gefangener zu sein und ich zweifle nicht einen Augenblick daran, es mit Raubrittern zu tun gehabt zu haben.“
Wolfram und Ansgar wechselten einen entsetzten Blick.
Selbst sie hatten davon gehört, dass es mancherorts Ritter gab, die es mit den ritterlichen Tugenden nicht so genau nahmen. Ritter, die vergessen hatten, dass es eigentlich ihre Pflicht war, die Schwachen zu schützen, anstatt ihnen ihr Eigentum wegzunehmen.
„Bist du diesen Raubrittern selbst begegnet?“, wollte Wolfram von dem Bauern wissen.
Dieser machte eine wegwerfende Handbewegung. „Zum Glück konnte ich das vermeiden und mich im Unterholz verbergen. Als ich Euch beide über die Lichtung reiten sah, glaubte ich erst, dass Ihr auch zu ihnen gehört. Deshalb habe ich mich zunächst versteckt.“
„Sag uns noch, ob du irgendwelche Wappen oder Feldzeichen erkannt hast!“, forderte Wolfram.
Sebald nickte. „Zwei gekreuzte Hellebarden in einem Kreis – dieses Wappen habe ich auf einer ganzen Reihe von Satteldecken und Lanzenbannern gesehen. Kennt Ihr dieses Zeichen?“
Die beiden Jungen sahen sich kurz an.
„Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte das Wappen des Grafen von Schnellenberg sein“, sagte Ansgar. „Wolfram, erinnere dich doch mal! Im letzten Jahr – oder war es im vorletzten? – da kam doch mitten im Winter einer der Ritter des Grafen von Schnellenbergs bei Eis und Schnee auf die Burg Wildenstein und Baron Norbert gewährte ihm fast eine Woche lang seine Gastfreundschaft.“ Wolfram nickte.
„Ja, ich erinnere mich. Das Wetter wurde dann besser und der Ritter zog seines Weges. Hieß er nicht Herwig?“
„Richtig!“, bestätigte Ansgar. „Sein Lautenspiel war fürchterlich. Sein Instrument schien stets ungestimmt zu sein.“
„Ich glaube eher, er hatte einfach keinen Sinn für den Gesang“, ergänzte Wolfram.
Der Junge erinnerte sich noch an die Abende, an denen der Ritter auf Burg Wildenstein geweilt und seine Gesänge zum Besten gegeben hatte.
Ein besonderes musikalisches Talent hatte Ritter Herwig zwar nicht gehabt, aber die langen Winterabende konnten auf einer kalten und ungemütlichen Burg sehr lang werden, da war jedwede Abwechslung willkommen.
„Ich muss jetzt nach Hause!“, sagte der Bauer schließlich. „Wer weiß, was aus dem Hof geworden ist und was diese Raubritter meiner Frau und meinen Kinder angetan haben könnten!“, meinte er. Mit der flachen Hand strich er sich über das Gesicht und schüttelte voll tief empfundener Verzweiflung den Kopf. „Wie gesagt, ich habe Euch junge Herren gewarnt! Hört auf mich! Und was die Botschaft an den Müllermeister vom Krötenbach angeht: Wer sagt Euch denn, dass der nicht auch längst mitsamt seiner Familie in die Wälder entflohen ist, um sein Leben und das Leben seiner Familie zu retten?“
 |  |

3

Mit diesen Worten zog der Bauer davon.
Die beiden Jungen sahen im etwas ratlos nach. Wenige Augenblicke später war er im dichten Unterholz verschwunden. Hin und wieder hörte man zunächst noch, wie ein Ast knackte. Dann machte es den Eindruck, als wären die beiden Jungen ihm nie begegnet.
Einen Augenblick hatte Wolfram das Gefühl, geträumt zu haben.
Nein, die ist die Wirklichkeit!, durchfuhr es ihm.
„Wir können nur hoffen, dass die Raubritter einen anderen Weg nehmen“, meinte Wolfram.
Ansgar lachte heiser.
„Und die einzige Mühle im weiten Umkreis dabei auslassen? So etwas kann doch nur ein kleiner Knirps vermuten, der von nichts Ahnung hat.“ Wolfram ging auf Ansgars Bemerkung nicht weiter ein. Die Streiterei hatte jetzt einfach keinen Sinn. Wenn die Raubritter noch in der Nähe waren, konnte die Lage für die beiden Jungen schnell brenzlig werden.
Andererseits hatten sie den unmissverständlichen Auftrag ihres Burgherrn, die Mühle am Krötenbach aufzusuchen und ihre Botschaft auszurichten.
„Wir werden uns doch so schnell nicht einschüchtern lassen“, sagte Ansgar voller Entschlossenheit. „Ich glaube jedenfalls nicht, dass Baron Norbert es als ehrenwert erachten würde, wenn wir jetzt einfach davon reiten würden.“
„Aber wenn wirklich Raubritter im Wildensteiner Land ihr Unwesen treiben, dann wäre es doch vielleicht besser, zurück zu reiten und den Baron darüber so schnell wie möglich zu informieren!“, erwiderte Wolfram.
„Und was, wenn dieser Bauer uns nur Angst machen wollte oder die Lage falsch eingeschätzt hat?“
„Das glaube ich nicht. Was er sagte, klang für mich überzeugend!“
„Du bist ja auch noch kleiner Naseweis und leicht zu beeindrucken!“, höhnte Ansgar. „Hör zu, lass es uns so machen: Wir reiten zur Mühle am Krötenbach und überbringen unsere Botschaft. Vielleicht hat der Müllermeister ja auch schon irgendetwas von den Raubrittern gehört. Anschließend kehren wir dann so schnell wie möglich nach Burg Wildenstein zurück, um den Baron zu informieren.“
„Gut“, stimmte Wolfram zu.
Wahrscheinlich hätte es auch im Augenblick gar keinen Sinn gemacht, Ansgar von etwas anderem überzeugen zu wollen. Als der Ältere hatte er einfach das Gefühl, diese Sache entscheiden zu können.
„Aber wir sollten einen weiten Bogen zur Mühle reiten“, beharrte Wolfram. „So, wie der Bauer es uns geraten hat!“
Ansgar machte eine wegwerfende Handbewegung und trieb sein Pferd bereits in Richtung des Waldrandes.
„So ein Unsinn!“, meinte er. „Die fremden Ritter werden längst weiter gezogen sein – und da keiner von uns vorherzusagen vermag, wohin ihre Reise ging, können wir auch genauso gut dem Weg am Krötenbach folgen, anstatt einen Bogen zu reiten!“ Ansgar dachte offenbar auch in dieser Sache nicht im Traum daran, mit sich reden zu lassen.
Wahrscheinlich hat er in Wahrheit nur Angst, dass er den Weg erneut verliert, wenn er einen Bogen reiten muss, anstatt einfach dem Bach zu folgen!, überlegte Wolfram.
Aber was blieb im übrig, als seinem Freund zu folgen?
Sie ritten in den Wald hinein.
Die Pferde stapften durch die herabgefallenen braunen Blätter. Nebel kam auf und es wurde empfindlich kalt. Die Dämmerung schritt rasch voran und es würde nicht mehr lange dauern, bis die Dunkelheit einsetzte.
Etwa nach einer Stunde erreichten sie endlich den Krötenbach, der seinem Namen alle Ehre machte. Die quakenden Laute waren aus der schlammigen Uferzone deutlich zu hören. Der Krötenbach schwoll um diese Jahreszeit immer durch die herbstlichen Regenfälle zur doppelten oder gar dreifachen Breite an und überschwemmte in manchen Jahren sogar ein paar Wiesen in Ufernähe.
Jetzt stand eine graue Nebelwand auf dem Wasser, aus der Schwaden den beiden Reitern entgegenwaberten. Diese Nebelschwaden erinnerten Wolfram an die Arme eines Ungeheuers, dessen wahre Gestalt man nicht erkennen konnte. Viele Geschichten erzählte man über diese Gegend. Von Geistern, bösen Hexen und Dämonen, die hier in manchen Nächten ihr Unwesen trieben.
Hin und wieder waren Wanderer und Reisende verschwunden, so hieß es.
Angeblich waren sie von Hexen verzaubert in den Morast gelockt worden. Was dort mit ihnen geschehen war, malten sich die Bewohner des Wildensteiner Landes in den grausigsten Farben aus.
Wolfram hatte einmal Pater Ambrosius, einen Mönch aus dem in der Nähe der Burg gelegenen Kloster St. Ingbert danach gefragt, was er von diesen Geschichten halte. Wolfram besuchte den Mönch regelmäßig, um bei ihm die Kunst des Lesens und Schreibens zu lernen und der gelehrte Mönch war seitdem für ihn eine Art großväterlicher Freund geworden, auf dessen Urteil er vertraute. Und wenn jemand etwas über die Mächte des Teufels wissen konnte, dann doch zweifellos ein Mönch, der in der Bibliothek des Klosters Zugang zu den Abschriften vieler weiser Bücher hatte.
Wolfram erinnerte sich genau an das heisere Lachen des Paters, als der Junge ihn nach den geheimnisvollen Begebenheiten in den Wäldern am Krötenbach befragt hatte.
„Das ist alles Aberglaube“, war Pater Ambrosius überzeugt. „Die Menschen geben damit ihrer Furcht vor Krankheit, Tod, Krieg und all den anderen schrecklichen Dingen, die jeden Tag über sie hereinbrechen können, eine Gestalt. Aber ich glaube nicht, dass diese Geschichten wahr sind. Du weißt doch, wie das ist! Einer erzählt sie dem anderen weiter, schmückt sie noch ein bisschen mehr aus und wenn sie dann zum zehnten Mal weitererzählt wurde, hört man ein Schauermärchen, das mit dem ursprünglichen Bericht gar nichts mehr zu tun hat.“
„Ihr glaubt, dass man sich nicht zu fürchten braucht, wenn man durch die Wälder am Krötenbach streift?“, hatte Wolfram sich noch mal vergewissert.
„Man sollte sich dort nur vor den Dingen fürchten, die auch sonst gefährlich sind: Tollwütige Tiere zum Beispiel oder der Morast am Flussufer! Davor sollte man sich in Acht nehmen. Aber das ist auch schon alles.“
Immer wieder vergegenwärtigte sich Wolfram diese Worte des Paters. Er ließ die damalige Szene noch einmal vor seinem inneren Auge erstehen und stellte fest, dass er dadurch ruhiger wurde.
Es gibt keinen Grund, warum Ambrosius nicht auch diesmal recht behalten sollte!, sagte sich der Page.
Schließlich war Pater Ambrosius einer der gelehrtesten Männer des Wildensteiner Landes.
In den morastigen, feuchten Untergrund am Flussufer kamen die beiden Reiter nicht schnell genug vorwärts und so zeichnete es sich schon recht bald ab, dass sie es unmöglich bis zur Mühle schaffen konnten, bevor es dunkel wurde.
Aber immerhin blieb ihnen der Bach als Orientierung.
Der Wasserstand war so hoch, dass sich an manchen Stellen Abzweigungen gebildet hatten und das Wasser in tiefer gelegene Tümpel abfloss, die ansonsten wahrscheinlich den gesamten Sommer über kaum Wasser führten.
Das Gelände stieg an. Der Untergrund war rutschig und erschwerte das Vorankommen zusätzlich.
Inzwischen wurde es dunkel.
Der fahle Mond stand am Himmel und spendete etwas Licht.
„Es wundert mich, dass wir von diesen fremden Rittern gar keine Spur gefunden haben!“, meinte Wolfram.
„Was erwartest du denn?“
„Zum Beispiel eine platt getrampelte Wiese oder so etwas!“
„Vielleicht haben sie einen anderen Weg genommen.“
„Das wollen wir hoffen!“
 |  |

4

Irgendwann tauchte aus dem Nebel ein dunkler Umriss auf.
Ein großer Schatten.
Erst als die beiden Jungen sich noch weiter näherten, war zu sehen, dass es sich um die Wassermühle am Krötenbach handelte. Der Krötenbach hatte hier ein hohes Gefälle und so erfüllte ein ohrenbetäubendes Rauschen die Luft. Der Bach bewegte das Wasserrad der Mühle und diese Kraft sorgte wiederum dafür, dass die Mühlsteine sich aneinander rieben und das Korn der Bauern zu feinem Mehl verarbeiteten.
Mehl, das in Zukunft auch an den Burghof geliefert werden sollte.
Zwar lag die Mühle am Krötenbach ziemlich abseits und es bedeutete einen erhöhten Aufwand für den Baron, Wagen hier her zu schicken, um die Mehlsäcke abzuholen, aber die letzte Ernte im Wildensteiner Land war schlecht gewesen und so war man auf der Burg darauf angewiesen, zusätzliche Vorräte aufzukaufen.
Die beiden Jungen stiegen von ihren Pferden und machten sie an einer Querstange vor dem Mühlengebäude fest, die eigens für diesen Zweck angebracht worden war.
Das Rauschen des Baches übertönte alles andere.
Die Fensterläden der Mühle waren geschlossen. Wolfram und Ansgar gingen zur Tür und klopften.
„Meister Lamphart!“, rief Wolfram – und seine Stimme hatte dabei große Mühe, das Rauschen des Wassers zu übertönen. „Meister Lamphart! Hier sind die Boten des Barons von Wildenstein!“
Es gab keine Antwort.
„Hier stimmt doch etwas nicht!“, war Ansgar überzeugt.
Seine Hand schloss sich um den Griff des kurzen Dolches, den er am Gürtel trug.
Sein Blick schweifte umher, aber er konnte nichts erkennen, was ihm verraten hätte, was hier los war. Er machte ein paar Schritte, suchte am Boden nach Spuren von Pferde und Wagen – und fand sie schließlich.
„Hier!“, sagte er. „Die Spur von einem zweispännigen Wagen und mindestens einem weiteren Pferd führen nach Norden. Wenn das nicht die Raubritter waren! Eine Mühle dürfte ein lohnendes Ziel für dieses Gesindel gewesen sein!“
„Der Bauer Sebald hat uns aber eine viel größere Gruppe beschrieben“, wandte Wolfram ein.
„Wahrscheinlich hat er einfach nur übertrieben, weil er das Herz in der Hose hatte!“
„Es könnte aber auch sein, dass dies die Spuren von Meister Lamphart und seinen Gesellen sind, die vielleicht von den fremden Rittern gehört und sich noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben! Das würde erklären, warum die Fenster und Türen geschlossen sind und sie offenbar noch von niemandem einfach aufgebrochen wurden!“
Ansgar knurrte etwas vor sich hin.
Er wollte natürlich nicht zugeben, dass die Argumente des Jüngeren stichhaltiger waren.
Er ging noch einmal zur Tür, holte den Dolch aus dem Gürtel und umfasste ihn mit seiner Faust.
Mit dem Knauf hämmerte er dann lautstark gegen das Holz. „Meister Lamphart!“, rief er, so laut, dass sich seine Stimme dabei heiser anhörte. Aber auch er erhielt keine Antwort.
Ansgar steckte den Dolch wieder weg und rüttelte an der Tür. Sie ließ sich nicht öffnen.
„Jetzt bräuchte man einen dieser Schlüssel, die man Dietrich nennt und mit denen sich alle Schlösser zu öffnen vermögen!“
„Trotzdem sollten wir uns da drinnen mal umsehen. Vielleicht finden wir ja irgendeinen Hinweis darauf, was nun wirklich los ist. Außerdem brauchen wir einen Platz zum übernachten – oder willst du da draußen in diesem Geisterwald auf dem nassen, schlammigen Boden schlafen. Ein Bett aus feuchten, glitschigen Blättern – na ich danke!“
„Und wie sollen wir das anstellen? Was glaubst du, was passiert, wenn es stimmt was du gesagt hast und Meister Lamphart sich vor den Raubrittern in Sicherheit brachte? Er könnte jederzeit zurückkehren und wäre wohl nicht sehr begeistert, wenn wir seine Tür beschädigt hätten!“
„Wer will denn die Tür beschädigen?“, widersprach Wolfram. „Vielleicht lässt sich eins der Fenster öffnen!“
Sie umrundeten die Mühle.
Die Fenster waren recht hoch angebracht.
Wolfram hatte einen Vorschlag.
„Wenn ich auf deine Schultern steige, müsste ich herankommen“, meinte er.
„Aber die Fenster werden von innen verriegelt sein!“
„Dann gib mir deinen Dolch. Die Klinge ist dünn genug um in den Spalt zwischen den geschlossenen Fensterläden hindurchzupassen – und vielleicht gelingt es mir so, den Riegel hochzuschieben.“
Ansgar seufzte.
Einen Augenblick noch kämpfte er innerlich mit sich, dann gab er dem Jüngeren nach. „Gut, wir versuchen es. Aber, dass du mir nicht die Dolchklinge abbrichst!“
„Nein, natürlich nicht!“
„Du weißt, was mir die Waffe wert ist!“
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2018
- ISBN (ePUB)
- 9783738918625
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (März)
- Schlagworte
- wolfram raubritter