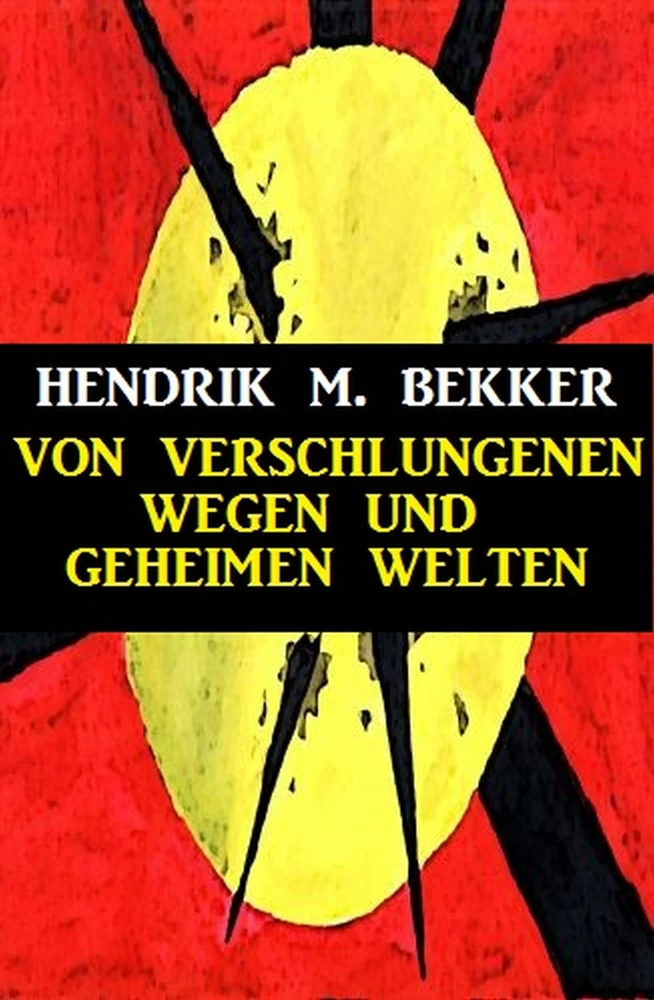Zusammenfassung
Phantastischen Erzählungen von Hendrik M. Bekker
Der Umfang dieses Buchs entspricht 353 Taschenbuchseiten.
Dieses Buch enthält folgende Erzählungen:
-Verlorene Gelegenheiten kommen nicht zurück ...
-Der alte General
-Balthasars Basar
-Wissen und nicht wissen
-Der Ring, der Wünsche erfüllt
-Mein Freund, der Zwerg
-Seelenloser Engel
-Die Anhalterin
-Morgen gehen wir sterben....
-Preisnachlass wegen Geisterbefall
-Verschlungene Wege
-Das blutige Gold der Kowaja-Berge
-Der Spiegel der Wahrheit
-Gefangener
-Gespräche mit Kain
-Der Besucher
-Eroberer der Galaxis: Der Tod im Blut
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Von verschlungenen Wegen und geheimen Welten
Published by Cassiopeiapress/Alfredbooks, 2018.
Von verschlungenen Wegen und Geheimen Welten | Phantastischen Erzählungen von Hendrik M. Bekker

|

|

Von verschlungenen Wegen und Geheimen Welten
Phantastischen Erzählungen von Hendrik M. Bekker

Der Umfang dieses Buchs entspricht 353 Taschenbuchseiten.
Dieses Buch enthält folgende Erzählungen:

|

|


-Verlorene Gelegenheiten kommen nicht zurück ...
-Der alte General
-Balthasars Basar
-Wissen und nicht wissen
-Der Ring, der Wünsche erfüllt
-Mein Freund, der Zwerg
-Seelenloser Engel
-Die Anhalterin
-Morgen gehen wir sterben....
-Preisnachlass wegen Geisterbefall
-Verschlungene Wege
-Das blutige Gold der Kowaja-Berge
-Der Spiegel der Wahrheit
-Gefangener
-Gespräche mit Kain
-Der Besucher
-Eroberer der Galaxis: Der Tod im Blut
Copyright

|

|


Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© Cover by Author
© dieser Ausgabe 2018 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Verlorene Gelegenheiten kommen nicht zurück ...

|

|


Karl Gordes saß gemütlich in seiner kleinen Küche. Er setzte die blau-weiße Teetasse ab und sah zur Uhr. Er fluchte laut und pustete die Kerze im Stövchen unter der Kanne aus. Dann sprang er auf und zog sich eine Jacke an. Während er das Haus verließ, schloss er noch schnell seine Wohnungstür ab und machte sich dann auf den Weg die Große Straße entlang. Es war die Haupteinkaufsstraße seiner Stadt. Er bog in eine Seitenstraße ein, in Richtung des alten Drogeriemarktes. Die Kette war pleite gegangen, seitdem hatte sich kein neuer Investor finden können. Dort fanden seit einiger Zeit kleinere Auktionen von Haushaltsauflösungen statt. Viele Leute hatten heutzutage keine Erben mehr und auf diese Weise konnte noch Geld für die Beisetzung gesammelt werden. Die Stadt hatte das Projekt begrüßt und unterstützte es mit der Überlassung einer ungenutzten Immobilie. Karl ging gerne zu den Auktionen.
Er hoffte auf den ein oder anderen Glückstreffer bei der Auktion. Außerdem genoss er es, sich die Leute anzusehen, die boten. Seitdem Jakob Hinrichs diese Auktionen regelmäßig durchführte, waren sie vom Geheimtipp zu einer regionalen Attraktion geworden. Ob ältere Leute, die Eiche-rustikal-Möbel bevorzugten, oder Studenten der örtlichen Hochschule, die sich preiswert aber hochwertig einrichten wollten, bis hin zu Hausfrauen, die einfach nur ein Schnäppchen machen wollten, alles war vertreten. Es erinnerte ihn an die Flohmärkte, auf denen er mit seinem Vater früher immer gewesen war. Es war ein geschäftiges munteres Treiben voller Fremder und doch interessanter Leute. Als Karl den kleinen, ehemaligen Drogeriemarkt betrat, hatte die Auktion schon angefangen. Er ließ sich am Eingang ein Schild mit Nummer geben und setzte sich ins Publikum. Gut drei Dutzend Menschen waren anwesend, für einen Donnerstagabend eigentlich ziemlich gut.
Wer ein Gebot abgab, hob das Schild. Durch die Nummer war klar, wer die Person war und man brauchte nur zu sagen, was man bereit war zu zahlen. Wer nicht bar oder mit Karte zahlen konnte, da er das Geld nicht besaß, bekam den ersteigerten Gegenstand auch nicht ausgehändigt. Dann wurde er beim nächsten Mal erneut versteigert.
Gerade kam ein verzierter fünfzig Jahre alter Schreibtisch unter den Hammer. Er erinnerte an den Bauhausstil der goldenen Zwanziger.
Dann kam ein Spiegel. Dieser Spiegel gefiel Karl sofort. Dabei war er nicht besonders auffällig gearbeitet, er war nicht einmal offenkundig wertvoll.
Doch Karl war sich ziemlich sicher, dass es ein mittelalterliches Stück sein konnte. Das hier war auf jeden Fall ein solide gearbeitetes Stück mit hohem Alter.
So was hatte einen gewissen Wert bei Sammlern und durchaus auch bei Museen. Ansonsten konnte er es immer noch jemandem verkaufen, der auch glaubte, dass es alt und wertvoll war.
Dazu kam, dass der Spiegel einen Holzrahmen hatte. Holz ließ sich C14-datieren und so das wahre Alter ziemlich genau feststellen. Kohlenstoff-14-Atome kamen in jedem Lebewesen vor und wenn man aufhörte einen Stoffwechsel zu haben, weil man tot war, zerfiel es langsam. Daraus ließ sich das Alter bestimmen, oft auf wenige Jahre genau. Karl hatte zum Glück einen Studienkollegen, der sich mit der Ausrüstung der Universität ein wenig dazu verdiente. Solche Altersnachweise waren gern gesehen in den höheren Antiquitätenhändlerkreisen. Auch mancher Kunde, der mehr des Prestiges wegen ein altes Stück kaufte, als weil er wirklich Ahnung hatte von Antiquitäten, wollte so einen Nachweis.
„Der folgende Spiegel von Fritz Jakobs wurde im Haus vorgefunden. Es ist möglicherweise ein Erbstück, das der verstorbene Herr Jakobs hinterließ. Das Alter wurde von einem Fachmann auf mehrere hundert Jahre geschätzt. Leider gibt es keine klar datierbaren Verzierungen. Der Spiegel ist ohne Holzwurm, ohne Sprung und solide gearbeitet. Er hat kein Hersteller- oder Werkstattzeichen. Ich erwarte die Gebote“, begann der Auktionator. Er war nicht ganz bei der Sache. Bei Stücken, die er für wirklich wertvoll hielt, wurde er deutlich enthusiastischer. Karl kannte das schon. Das hier war mehr das Standardprogramm.
Karl machte ein faires Angebot. Nicht allzu viel, aber doch einen vernünftigen Preis.
Zu seiner Überraschung bot ein etwas älterer Mann mit ihm. Er hatte ihn schon einige Male gesehen, immer wieder bot er für Gegenstände. Manches Mal bot er ziemliche Summen, um Dinge zu bekommen. Nach welchem Muster er das tat, wusste Karl nicht. Möglicherweise war er Antiquitätenhändler. Er wusste nur, dass er sich „Herr ten Dornan“ nennen ließ. Der Mann überbot ihn, viermal in Folge. Karl zögerte erst, dann bot er weiter mit. Langsam ging es Karl nicht mehr nur um den Spiegel, es ging auch ums Gewinnen. Der Mann ging immer einige Euro über seinen Betrag! Irgendwann reichte es Karl. Hier ging es jetzt ums Prinzip! Er bot einen Betrag hundert Euro über dem aktuellen Angebot. Ein Raunen ging durch den Raum. Der andere Mann schien im Kopf zu rechnen, dann war alles vorbei. Karl hatte gewonnen! Der Mann ging nicht mit. Karl seufzte zufrieden und überlegte dann, ob es wirklich sinnvoll gewesen war. Doch für langes Nachdenken blieb keine Zeit, die nächsten Angebote kamen. Nach mehreren interessanten Stücken, bei denen er überboten wurde, entschied er sich, dass es genug war. Er ging zur Abholstelle und zahlte den gebotenen Preis für den Spiegel. Er hatte das Geld in bar dabei. Am Abend würde man ihn liefern.
Später am Abend saß Karl vor dem Fernseher und sah sich die Sportschau an. Irland hatte gegen Deutschland gespielt, kein berauschendes Ergebnis für die Deutschen. Zumindest nicht, wenn man das vorher an den Tag gelegte Selbstvertrauen mit beachtete. Es klingelte an der Haustür.
Karl schlurfte zur Tür. Ein freundlich lächelnder Mann im Trainingsanzug begrüßte ihn.
„Moin, hier is‘ Ihr Paket, nech. Haben Sie heute ja ersteigert, Karl Gordes, nech?“
Karl nickte.
„Dann unterschreiben Sie mal hier, nech“, sagte der Mann im Trainingsanzug und reichte Karl ein Formular. Karl überflog es, es war eine Empfangsbestätigung. Er kannte das Formular schon, es war nichts Anstößiges daran. Nach dem Unterschreiben reichte er es dem Mann zurück. Daraufhin holte der Mann im Trainingsanzug ein großes Paket aus seinem VW-Bulli und trug es ihm in den Flur.
„So, viel Spaß, nech“, sagte der Mann und war auch schon verschwunden. Karl kam gar nicht dazu, ihm einen Fünfer in die Hand zu drücken und ihn zu bitten, den Spiegel nach oben zu bringen.
Er seufzte. Wieder einmal war die Welt zu schnell für ihn.
Zuallererst räumte er im oberen Stockwerk seines Reihenhauses im Flur ein Stück der Wand leer, dann machte er sich daran, den Spiegel nach oben zu schaffen. Sein Rücken machte ihm seit einiger Zeit zu schaffen, zu viel Büroarbeit, zu wenig Bewegung, sagte der Arzt.
Stufe für Stufe brachte er mühsam den Spiegel nach oben. Er hängte ihn in sein Lesezimmer. So nannte er den großen Raum voller Bücher im zweiten Stock seines Reihenhauses.
Er lebte alleine dort und empfing selten Besuch. Es war nicht so, dass er kein Interesse an anderen Menschen oder einer Partnerin gehabt hätte, es hatte sich nur nie ergeben.
Oft, wenn er versuchte Bindungen aufzubauen oder aufrecht zu halten, scheiterte er. So vermied er sie irgendwann, um auch den Schmerz zu vermeiden.
Im Lesezimmer hängte er den Spiegel auf. Er war schön gearbeitet und bereits für die Auktion gesäubert worden.
Karl nahm sich vor, ihn ein paar Tage hängen zu lassen, bevor er entschied, was er mit ihm tat. Immerhin war er ziemlich teuer gewesen. Er kochte sich einen neuen Tee und setzte sich aufs Sofa im Lesezimmer. Dabei machte er das Radio an. Irgendein Sender, bei dem die ganze Zeit geredet wurde.
Anschließend nahm er sich ein Buch und begann zu lesen.
Er mochte das Gerede des Radios im Hintergrund. Es gab ihm das Gefühl, dass es Leben im Haus gab.
Während er las, griff er immer wieder nach seiner Tasse. Dann klirrte es, als er sie verfehlte und sie umstürzte.
Er fluchte, sprang auf und eilte in die Küche, um etwas zum Aufwischen zu holen.
Während er den Tee vom Linoleum damit aufwischte, fiel ihm etwas Seltsames auf.
Er ließ das vollgesogene Küchenpapier liegen und trat zum Spiegel.
Erst jetzt begriff er, was ihn stutzig gemacht hatte.
Der Raum war der Gleiche wie der, in dem er stand. Nur war Karl nicht zu sehen.
Er ging ins Badezimmer und sah in den Spiegel. Dort war er, so wie er sich kannte.
Er zog ein paar Grimassen. Sein Spiegelbild tat es ihm gleich.
Dann trat er erneut vor den Spiegel im Lesezimmer. Immer noch war dort kein Spiegelbild.
Er trat näher heran und hauchte dagegen. Es bildete sich kein Fleck, wo sein Atem die Oberfläche berührte.
Dann beugte sich Karl so weit vor, dass seine Nasenspitze den Spiegel berühren musste.
Doch sie tat es nicht. Da war kein Spiegel, es war vielmehr wie beim Fassen durch einen Fensterrahmen.
Er schrak zurück.
Dann hängte er den Spiegel ab und lehnte ihn an die Wand.
Vorsichtig machte er einen Schritt hindurch und kletterte auf die andere Seite.
Der Raum war der gleiche, selbst der Spiegel lehnte dort, wo er es eben getan hatte. Der einzige Unterschied war, dass der Raum verkehrt herum war. Was links stand, war rechts und umgekehrt.
Er sah sich um.
„Schatz?“, fragte eine brünette Frau, die im Türrahmen zum Lesezimmer stand. „Ist dir nicht gut?“
Karl fand keine Worte. Diese Frau, er kannte sie! Es fiel ihm nur nicht mehr ein woher. Sein Blick wanderte ihre Silhouette hinab, über ihr einladendes tief ausgeschnittenes Dekolleté hinab zu ihrer Hüfte.
„Ähm“, setzte er an. Dann fiel es ihm ein. Er hatte sie schon mal getroffen. War das im Studium? War das eine Frau, mit der er sich mal verabredet hatte?
„Komm her“, sagte sie und trat zu ihm, da er sich nicht bewegte. Sie duftete nach irgendwelchen Blumen, doch er wusste nicht, was für welche. Ihm gefiel der Duft. „Wenn dir nicht nach reden ist, ist das auch in Ordnung“, flüsterte sie ihm ins Ohr.
Es klingelte, laut und drängend. Karl öffnete die Augen und sah sich um.
Er lag alleine in seinem Bett, in Boxershorts und Socken. Erneut betätigte jemand die Türklingel. Wieder drückte dieser jemand mehrmals, was dem Klingeln etwas Forderndes gab.
Karl stand auf und zog seine Jeanshose an. Wer auch immer ihn störte, musste mit seinem nackten Oberkörper vorliebnehmen.
An der Tür war ein älterer Mann in einem Anzug, über dem er einen Kurzmantel trug. Er deutete eine Verbeugung an.
„Guten Tag, Herr Gordes“, sagte der Mann. „Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie gestern einen Spiegel bei einer Auktion ersteigert haben?“
„Hmm“, brummte Karl.
„Hätten Sie Interesse, den Spiegel zu verkaufen?“
„Sie sind dieser andere, der mitgeboten hat“, stellte Karl fest, der das Gesicht plötzlich einzuordnen wusste.
„Balthasar ten Dornan, ja. Ich habe großes Interesse an diesem Spiegel.“
„Tja, der ist aber gerade nicht zu verkaufen“, stellte Karl patzig fest. Was fiel diesem Kerl ein? Wer von den Auktionsveranstaltern hatte dem seine Privatadresse gegeben?
„Sie haben sich gar nicht meinen Preis angehört“, stellte Balthasar ruhig fest. Karl begann die Tür zu schließen.
„Werde ich auch nicht.“
Bevor sie ins Schloss fallen konnte, schob Balthasar ten Dornan seinen Fuß dazwischen. Karl hörte, wie der Mann scharf einatmete.
„In Ihrem und meinem Interesse sollten Sie mich anhören“, stellte Balthasar fest. „Dieser Spiegel ist der Tod seines Besitzers.“
„Ach was, auf einmal ist er verflucht, wenn man nicht verkaufen will?“, erwiderte Karl.
„Ich beschäftige mich damit, solche Dinge aus dem Verkehr zu ziehen. Der Spiegel erahnt Ihre Wünsche und ...“, setzte Balthasar erneut an, doch Karl drückte seinen Schuh zur Seite und zog die Tür zu.
Er ging zum Frühstück. Das Klingeln des Fremden ignorierte er einfach, bis dieser aufgab. Er schüttelte den Kopf. Erst dieser seltsame Traum und dann so ein schlechter Verlierer, der ihm Blödsinn erzählte.
Er wusste noch, dass er vor dem Einschlafen durch den Spiegel getreten war und den Abend mit dieser hinreißenden Frau verbracht hatte, seiner Ehefrau, wie sie sagte. Er seufzte. Es war einer der realistischsten Träume seit Langem gewesen und dabei auch einer der besten.
Wobei, das mit dem Spiegeltreten kam ihm bekannt vor. Ob er das schon mal bei Stephen King gelesen hatte? Dessen Bücher hatte er früher gerne und immer wieder gelesen. Da musste sein Unterbewusstsein die Inspiration her haben.
Karl ging nochmal ins Lesezimmer und sah sich den Spiegel an. Dabei beugte er sich vor und packte mit der Hand darauf. Er fühlte die Kälte des Spiegels und seine Finger hinterließen deutliche Fettflecken.
Zufrieden lächelte er. Was für ein mieser Antiquitätenhändler, der Leuten mit Geschichten Angst machen will.
Karl sah auf die Uhr und fluchte. Er beeilte sich, um pünktlich zur Arbeit zu kommen und verließ das Haus.
Als er später abends nach Hause kam, fand er an seiner Haustür die Karte von Balthasar ten Dornan vor. Er hatte sie in den Briefkastenschlitz gesteckt.
Karl warf sie in den Müll und machte es sich mit einem Teller Dosenravioli in seinem Lesezimmer gemütlich.
Während er so den Stimmen im Radio lauschte, dachte er noch einmal über den Spiegel nach. Noch immer lehnte er an der Wand.
Er stellte die Schale ab und trat vor den Spiegel.
Als er sich vorbeugte, war dort kein Spiegelbild zu sehen.
Er atmete scharf ein.
Das kann nicht sein, ging es ihm durch den Kopf.
Er reckte den Kopf hinein. Tatsächlich, wie ein Fenster, überlegte er.
Erneut kletterte er hindurch und sah sich um. Das Lesezimmer sah ganz anders aus. Es waren viele Dinge dort, die dort nicht sein sollten. Die persönliche Note von jemand anderem, ging es ihm durch den Kopf.
Dann rief jemand nach ihm. Es war eine Frauenstimme. Er ging die Treppe hinab und fand dort eine Frau vor, mit flammenden roten Locken. Sie half einem kleinen Jungen beim Ausziehen seiner Winterstiefel. Dabei berichtete er ihr mit gewichtiger Miene von seinem Schultag.
„Schatz, ist irgendwas?“, fragte die Frau. Diese Frau kannte er. Es war eine Kollegin, die er vor einigen Jahren mal zum Essen eingeladen hatte. Eine freundliche Dame, die er sehr anziehend gefunden hatte. Aber er hatte sich wohl nicht richtig um sie bemüht und so war sie irgendwann in eine andere Abteilung versetzt worden und der Kontakt abgebrochen.
Einige Wochen später saß Balthasar ten Dornan auf einem der billigen Klappstühle bei einer Auktion.
„Wir haben hier einen Spiegel, in sehr gutem Zustand. Er wurde von seinem Vorbesitzer erst kürzlich erworben und es handelt sich um ein sehr altes Stück“, begann der Auktionator sein neuestes Stück anzupreisen.
Balthasar hob seine Nummer und rief eine Zahl. Der Spiegel musste aus dem Verkehr gezogen werden. Diesmal durfte ihn niemand überbieten. Karl Gordes hatte ihm nicht geglaubt. Der Spiegel ernährte sich von der Lebenskraft der Menschen und zeigte ihnen dafür, was sie sich wünschten. Die Illusion war perfekt und so versanken die Menschen immer tiefer, bis von ihnen nicht mehr übrig blieb als ausgemergelte Hüllen.
Ein anderer überbot Balthasar. Balthasar hielt dagegen, doch der Fremde zog die Stirn ärgerlich in Falten und verdoppelte den Preis. Balthasar ten Dornan fluchte. So viel Geld hatte er nicht dabei ...
ENDE
Der alte General

|

|


Zehn nach halb neun. Damit ist der Chef definitiv zu spät. Mir soll es recht sein. Vermutlich hat Herr Dr. Fernh irgendwas Wichtigeres zu tun.
Ich stehe auf von der Bank in unserem provisorischen Pausenraum.
„Sollen wir?“, frage ich in die Frühstücksrunde. Eine obligatorische Reaktionssekunde passiert erst mal gar nichts. Dann ernte ich das erste langsame Nicken.
Wir haben schließlich auch ohne den Chef alle was zu tun. Wir, das meint eine bunt gemischte Truppe, die hier für die Stadtarchäologie arbeitet: Praktikanten von der Universität, die hier erste Erfahrungen sammeln, zwei Ehrenamtliche, die hier mal reinschnuppern, und die Hand voll Leute, die uns „echten“ Archäologen vom Arbeitsamt zugeteilt wurde. Deren Arbeitskraft ist nämlich preiswerter als alles von Leuten machen zu lassen, die das studiert haben.
Aber naja, auch die Stadt muss sehen, wo ihr Geld bleibt.
Ich bin nach dem Chef hier die Nummer zwei, also muss ich jetzt mal für Bewegung sorgen.
Wir schnappen uns Spaten und Eimer, Schaufeln und ein Radio.
Wir wissen alle, was zu tun ist. Da muss nicht viel erklärt werden. Auf einer Vierzig-Quadratmeter-Fläche müssen wir die ein Meter siebzig tiefe Grube nochmal um dreißig Zentimeter abtiefen. Eigentlich dachten wir, wir sind schon auf der richtigen Höhe. Aber jemand hatte sich verrechnet. Dreißig Zentimeter klingt nicht viel, ist aber eine ganze Menge bei der Fläche.
Fehler passieren, genauso wie man unvorhergesehene Dinge findet. Bomben im zweiten Weltkrieg haben manchmal Krater in die Erde gefressen, oder wir finden Rohrleitungen oder Stromkabel, die nirgendwo verzeichnet sind, manchmal noch mit Strom drauf. Alles schon vorgekommen. Aber Gott sei Dank ist das hier keine Notgrabung, wo uns Bauarbeiter und Bauherren im Nacken sitzen. Wir sondieren hier nur für einen Grundstückseigentümer, wie tief er bei seinen Baumaßnahmen gehen kann. Hier in der Innenstadt kann man dabei allerhand finden und solange kein Bauplan ansteht, hat man auch keine großen Geldverluste, weil alle warten müssen.
Dazu können wir schon mal testen, ob wir die Relikte jüngerer deutscher Geschichte finden: Bomben, meist nur die Reste, manchmal aber auch Blindgänger.
Irgendwer erzählte mal, das inoffizielle Motto der Minensucher der Bundeswehr wäre: „Wer suchet, der findet, wer drauftritt verschwindet.“
Das ist nur halb so witzig, wenn man mal die Schaufel in die Erde rammt und es ein sehr metallisches „klonk“-Geräusch gibt.
Trotzdem ist die Gefahr natürlich doch eher geringer als in den meisten Indiana Jones-Filmen dargestellt. Es ist unumgänglich, über Archäologen zu reden, ohne den Vergleich heranzuziehen. Das muss jeder Student im Verlauf seines Studiums zu ertragen lernen. Einmal ist das ja witzig, aber irgendwann ...
Ich beginne damit, die Erde, die Alex mir mit dem Spaten vorlockert, in die Eimer zu schippen. Es hat geregnet, der Boden ist lehmig und vollgesogen. Jetzt allerdings scheint die Sonne.
Gehört halt alles dazu, wenn man was finden will. Ich will nicht wissen, wie anstrengend eine Grabung in Ägypten ist.
Alex, oder Alexander Pilsner, lässt kurz den Spaten sinken.
Ich und auch alle, die hier gerade die Graberei-Arbeit machen, wissen, was jetzt kommt.
Aus seiner ausgebeulten Westentasche zieht er eine alte Holzpfeife mit kleinen Metallverzierungen.
Dann schiebt er seine Schiebermütze auf seinen nach hinten gegelten, langsam lichter werdenden Haaren zurück und stopft die Pfeife genüsslich.
Anschließend nimmt er Streichhölzer heraus und nach dem Stopfen der Pfeife wird sie erst mal genüsslich angezündet. Dass es ein Genus sein muss, zeigt sein völlig zufriedenes Lächeln.
Uns steigt dabei immer nur der süßliche Tabakrauch in die Nase. Alex ist arbeitslos und hilft hier ehrenamtlich aus. Er ist sicher so um die vierzig mit einem wettergegerbten Gesicht, das ihn älter aussehen lässt.
Dann geht die Schaufelei weiter.
Lutz, einer der Praktikanten der Uni hier, nimmt einen vollen Eimer an. Irgendwer muss heute fragen, diesmal ist Lutz dran.
„Alex, Laura ist doch neu hier. Erzählst du uns und ihr nochmal, wie du hierhergekommen bist?“
Alexander erzählt gerne Geschichten, die sich zwar nie gegenseitig widersprechen, deren Wahrheitsgehalt ich aber mal dezent anzweifeln will.
Alex pafft noch ein, zwei Mal genüsslich und lässt zwei kleine Wölkchen aufsteigen. Dann, die Pfeife noch im Mundwinkel, nimmt er seinen Spaten wieder auf und macht sich an die Arbeit.
Erst denken wir schon, er wäre heute nicht in Stimmung und würde nichts erzählen.
Doch dann beginnt er: „Es ist ja schon über hundert Jahre her, da wurde ich im schönen Staate Virginia in den jungen, Vereinigten Staaten von Amerika geboren. Aufgewachsen bin ich aber dann in Boston. Hat mich auch sehr geprägt, denk ich mal. Jedenfalls kam dann der große Krieg. Also der Krieg des Nordens gegen den Süden. Der Süden, wir, wurden da rein gezwungen.“
„Naja“, sagt Laura, die neue Praktikantin, laut. Sofort ruhen alle Blicke auf ihr. Wir mögen Alex‘ Geschichten. Gerade bei solchen Gelegenheiten helfen sie, die Arbeit schneller zu erledigen.
„Der Süden wurde doch nicht gezwungen“, merkt sie nun etwas kleinlaut an. Alexander pafft erneut ein paar Wolken, bevor er fortfährt.
„Geht so. Als Sohn Virginias war ich hin und her gerissen, für wen ich kämpfen solle“, setzt er seine Geschichte fort.
„Moment, so alt können Sie doch niemals sein“, fährt Laura dazwischen.
Entnervt schnaube ich.
„Das fällt dir erst jetzt auf?“, stelle ich fest. „Er erklärt das.“
Laura sieht mich skeptisch an.
Alexander lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
Ein paar kleine Wölkchen steigen auf, bevor er fortfährt.
„Muss ja nichts erzählen", brummt Alexander, während er eine weitere Wolke aufsteigen lässt.
„Damit die Neue ins Bild kommt, fange ich mal an mit dem Grund meines Hierseins. Wir belagerten eine kleine Stadt, die vom Norden besetzt war. Die Blauröcke hatten sich verschanzt in der Schule der Stadt. Wir saßen in den Gebäuden darum herum. Die Sonne brannte und auch in den Häusern war es so warm, dass die Uniform wie eine zweite Haut anklebte. Ich war seiner Zeit bereits General, General Alexander Pilsner. Trotz allem hatte ich nur einen Revolver. Der Süden war für diesen Krieg nicht so gut gerüstet wie der industrialisierte Norden. Wir belagerten also dreißig Mann in der Stadthalle mit gerade mal zwei Dutzend Konföderierten. Das allerdings wussten die Blauröcke nicht, weil ich die Jungs angewiesen hatte, Lärm für ein Bataillon zu machen.“
„Kommt jetzt die Hexe?“, fragt Lutz mich, während er mehrere Eimer aus der Grube hochhievt. Ich nicke.
„Dann geh ich mal pissen“, entschuldigt er sich eloquent.
Alexander ignoriert ihn geflissentlich in seinem Redefluss.
„In dem Ort gab es viele Russen, die aus demselben Grund in die USA kamen, wie alle anderen auch: ein besseres Leben. Jeder der damals in die Staaten kam, ließ sich gerne bei Landsleuten nieder. So gab es immer mal Dörfer, in denen man kaum wen fand, der Englisch gut sprach. Die Hexe hieß jedenfalls Swara oder so, auf jeden Fall wurde sie mir so vorgestellt. Sie sollte uns segnen.
War, muss ich gleich sagen, nicht meine Idee. Glaubte nicht an so einen Humbug. Die Anwohner wollten, dass wir so schnell es geht gewinnen. Möglichst, so nehme ich an, ohne viel kaputt zu machen. Außerdem ist der Kampf für die Freiheit so eine Sache. Alle finden ihre Freiheit toll und wenn sie bedroht ist, wird sie für manche erst wirklich wertvoll. Nur selbst für sie kämpfen, das ist es dann doch nicht jedem wert. Außerdem nach Möglichkeit nicht vor oder eigenen Haustür, sondern weit weg. So bist du als Soldat auch meist unbeliebt.
Swara jedenfalls strich uns mit einer in irgendwas getunkten Feder über die Stirn und sprach dabei in ihrer Heimatsprache, oder wirres Zeug, ich kann kein Russisch. War schon älter, die Frau, man sah ihr aber die verblassende Schönheit an. Schwarze Augen, schwarzes Haar, und Haut, also meine ist mehr gegerbt worden durch die Sonne. Sie war sicher schon Jahre älter als ich, aber man konnte das nicht genau sagen. Sie hatte einfach irgendwas Besonderes an sich. Jedenfalls sind wir dann raus, haben uns verteilt. Jeder wusste, wo er sein sollte. Hexenwerk oder nicht, wir wollten das Ganze beenden und reinstürmen. Ich...“, so geht es eine ganze Weile voran, wie er alleine mehre Gegner tötete. Laura hängt bei der Beschreibung des kurzen aber heftigen Gefechts genauso an seinen Lippen wie wir anderen. Seine Stimme ist einfach so, dass man ihr zuhören muss.
„Ich warf ihm den leeren Revolver entgegen und duckte mich unter seinem Hieb weg. Ein fester Tritt von mir, und seine Familienplanung hatte sich erledigt. Dann war es vorbei. Keiner von denen stand mehr und wir hatten nur Steve und Peters verloren.“
„Wie aber kamst du her?“, fragt Laura jetzt spitz.
„Ich hab mich mit der Alten eingelassen“, brummt er. Er pafft mehrere Wolken.
„Eingelassen?“, fragt Laura.
„Ja, lautstark, sie war nicht so alt, wie du dir das vielleicht vorstellst“, erwidert er und grinst anzüglich. Laura bekommt rote Ohren und wendet den Blick ab.
„Dann hab ich den Fehler meines Lebens gemacht. Ich hab ihr den verdammten Ring geklaut. Ich war so fasziniert von ihm. Es war wie eine Stimme in meinem Kopf, die schrie, ich solle ihn mitnehmen. Als ich mich ein paar Tage später schlafen legte, war noch alles normal. Ich spielte mit dem Ring, hatte ihn am Finger, als ich einschlief. Als ich aufwachte, war ich hier.“
„Also ein magischer Ring?“, fragt Lutz unnötigerweise.
„Vermutlich“, stimmt ihm Alexander zu.
„Aber kannst du ihn nicht einfach anstecken und einschlafen und wieder zurückkommen?“, fragt Laura.
Alexander nickt.
„Immer wieder, immer wieder“, brummt er und pafft vor sich hin, während er mit der Schaufel Erde in den Eimer füllt.
*

AM NÄCHSTEN TAG ERSCHEINT er nicht zur Arbeit. Da wir ihn lieb gewonnen haben, wundern wir uns schon am Ende der Woche. Schließlich sehen wir eine Schlagzeile in der Zeitung, die uns zu denken gibt:
Mitvierziger aus von innen verschlossener Wohnung verschwunden. Alexander P., Hartz IV-Empfänger, war mehrere Tage nicht bei seinen Bekannten in der Kneipe erschienen. Daraufhin überredeten diese den Vermieter, seine Wohnung zu öffnen, bei der sich die Post im Postfach stapelte.
Seine Wohnung war von innen verschlossen, seine Kleidung war noch da und seine Pfeife lag neben seinem Bett auf seinem Nachttisch. Er allerdings ist verschwunden.
Die Polizei ermittelt.
Von einem Verbrechen sei aber nicht auszugehen.
Vielleicht ist er in seiner Zeit wieder aufgewacht. Wir jedenfalls hoffen es.
ENDE
Balthasars Basar

|

|


Micha Jakobs rannte, so sehr wie er noch nie gerannt war in seinen fünfzehn Lebensjahren.
Er konnte hinter sich die Schritte seiner Verfolger hören. Ihr Johlen schien näher zu kommen.
„Gleich haben wir ihn“, rief Dustin hinter ihm.
Micha bog in die erste Straße ab, die sich ihm bot. Flüchtig bemerkte er das Straßenschild. Brookinger-Straße. Er fand sich in einer fast menschenleeren Gasse wieder. Ein Pärchen schlenderte an den Schaufenstern vorbei. Er wusste, dass er nur Sekunden hatte, bevor seine Verfolger in die Straße abbiegen würden. Er musste sich entscheiden.
Er wählte das erstbeste Geschäft und stürmte hinein. „Balthasars Basar“ stand in verschnörkelter, altdeutscher Schrift über dem Eingang auf einem Metallschild.
Micha ging eiligen Schrittes in den Laden hinein, um nicht vom Schaufenster aus gesehen zu werden.
Der Laden war vollgestopft mit Antiquitäten. Auf alten Regalen, Vitrinen und Kommoden stapelten sich allerlei Dinge. Micha fand eine Lücke zwischen zwei Regalen, die breit genug war, um durch sie zum Schaufenster hinaus auf die Straße zu sehen. Er konnte Dustin und seine Spießgesellen vorbeilaufen sehen. Sie waren langsamer geworden, sie rannten nicht mehr.
Dustin verprügelte mit Vorliebe Micha. Vor einer Weile hatte er sich irgendwie dazu entschieden, dass er die übliche Drangsaliererei verstärken wollte. Micha hatte keine Ahnung, wieso. Er hatte ihm nie etwas getan, und als Dustin ihm schlicht das Geld für das Essen in der Cafeteria weggenommen hatte, hatte er es aushalten können. Doch nun schlugen sie ihn.
Er versuchte nicht mit ihnen alleine zu sein. Sie trauten sich nur, wenn keiner in der Nähe war, der sie verpetzen konnte.
Als sie aus seinem Sichtfeld waren, atmete er leise auf. Er war ihnen entwischt. Dieses Mal. Er schlenderte durch den Laden. In seinen Augen schien vieles nur Gerümpel zu sein. Aber auch Schmuck lag dazwischen. Nichts davon war mit einem Preis ausgezeichnet. Ob es hieß, dass man hier nicht über so etwas zu reden brauchte ? Oder dass man darüber noch verhandeln konnte?
Sein Blick blieb an einer kleinen Schatulle hängen, die mit einem verworrenen Muster überzogen war. Einem plötzlichen Drang folgend öffnete er sie. Darin fand er eine Halskette. Irgendetwas faszinierte ihn daran. Es war ein kleiner silberner Anhänger an einer Metallkette. Der Anhänger war geformt wie eine Träne und es war ein Zeichen auf ihm eingraviert. Micha nahm die Kette und ließ sie nach einem kurzen Blick über die Schulter in die Tasche gleiten. Er schloss die Schatulle, aus der er sie genommen hatte.
„Kann ich dir helfen?“, hörte er plötzlich eine Stimme einige Meter hinter sich. Ein älterer Herr kam hinter einem Regel hervor. Er hob eine Augenbraue, als er Micha sah.
„Suchst du was Bestimmtes, Junge?“, fragte er erneut.
Micha schüttelte den Kopf. Er versuchte ganz ruhig zu wirken. Plötzlich fühlte sich die Kette schwer in seiner Tasche an.
„Nein, ich seh mich nur um, Herr...“, brachte er hervor.
Der ältere Mann nickte langsam. „Gestatten, Balthasar. Balthasar ten Dornan. Das ist mein Antiquitätenladen“, erklärte er. „Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du nichts anfassen würdest, ohne zu fragen.“ Er nickte dabei auf ein Schild, das Micha bis dahin gar nicht aufgefallen war. Darauf stand in großen schwarzen Buchstaben: „Du packst es an, dir fällt es runter, du zahlst es.“
Micha nickte. „Verstanden.“
Er schlenderte in Richtung des Ausgangs, hier und dort stehenbleibend und etwas musternd.
Alles in ihm wollte nur nach draußen, bevor Balthasar bemerkte, dass er ihm etwas gestohlen hatte. Doch er wusste, dass er es noch nicht sofort riskieren konnte, nicht nur weil Balthasar Verdacht geschöpft hätte. Auch weil Dustin immer noch dort draußen sein konnte.
*

NACH EINIGEN MINUTEN wagte er sich zur Tür und warf einen vorsichtigen Blick durch das eingelassene Fenster. Dustin und seine Spießgesellen waren nirgends zu sehen.
So traute er sich hinaus, über die Brookinger-Straße zurück auf die Große Straße und zurück zur Wohnung seines Vaters.
Während er die Große Straße entlangschlenderte, sah er sich immer wieder misstrauisch um. Micha hoffte inständig, dass Dustin ihn nicht entdecken würde. Langsam wanderten dabei seine Gedanken zu dem Antiquitätenladen zurück. Gleichzeitig wanderte seine Hand in die Jackentasche und umschloss die Kette mit dem Anhänger.
Micha wusste, dass er sich eigentlich schlecht fühlen sollte. Er müsste ein schlechtes Gewissen haben, da er jemanden bestohlen hatte. Doch jeder Zweifel schien verschwunden, wenn er den Anhänger in seiner Tasche berührte.
Es war richtig gewesen. Auf eine seltsame, verquere Art. Er konnte es nicht in Worte fassen, ähnlich wie wenn man lange Zeit auf eine Speisekarte sah und nach einer Weile der Unentschlossenheit einfach wusste, was genau das Richtige war. Es war ein tiefliegender Impuls.
Plötzlich sah er aus den Augenwinkeln einen Schatten. Er wirbelte herum, doch bis auf einen menschenleeren Ladeneingang war dort nichts.
Micha schüttelte unwillkürlich den Kopf und ging weiter. Erst glaubte er, dass er sich den Schatten nur eingebildet hatte. Dann aber sah er ihn erneut. Nur kurz, aus dem Augenwinkel. Er war undeutlich. Sobald er hinsah, war er verschwunden.
Micha überlegte, ober er langsam verrückt wurde. Er steckte seine Hände wieder in die Jackentaschen und ging zügigen Schrittes weiter nach Hause.
Micha.
Micha wirbelte herum. Hatte da jemand nach ihm gerufen?
Panisch suchten seine Augen die Straße nach Dustin und seinen Spießgesellen ab. Doch er konnte sie zwischen all den Menschen nirgends sehen. Auch konnte er niemanden entdecken, den er kannte und der ihn hätte beim Namen rufen können.
Er beschleunigte seinen Schritt. Er wollte nach Hause. Heute war definitiv nicht sein Tag.
*

ZURÜCK ZU HAUSE ÖFFNETE er sich eine Dose Ravioli, füllte sie in einen Topf und stellte den Herd an. Er hatte den Schatten nicht noch einmal gesehen und war froh darüber. Vielleicht wurde er doch nicht verrückt, überlegte er.
Sein Vater war noch nicht zurück von der Arbeit. Er kam erst spät und wenn, dann war er meist zu erschöpft, als dass Micha mit ihm hätte reden können.
Er war die einzige Verwandtschaft, die er noch hatte. Keine Großeltern. Keine Mutter. Sie war vor Jahren nach einem Streit mit dem Vater gegangen, seitdem waren sie geschieden. Micha war damals gerade erst vier gewesen. Er konnte sich noch ein wenig an sie erinnern. Nach langem Hin und Her hatte sein Vater das Sorgerecht erstreiten können, da Michas Mutter erkannt hatte, dass das Kleinkind Arbeit bedeutet hätte.
Sein Vater arbeitete viel, damit es für sie beide reichte. Micha wusste, dass er es für ihn tat, trotzdem wünschte er sich manchmal, dass er öfter da wäre. Doch er wusste, dass das nicht möglich war. Er erinnerte sich noch gut, wie sein Vater einmal, als Micha noch klein gewesen war, zu ihm gesagt hatte, dass das Leben immer nur ein „Entweder-Oder“ war.
Meistens im Leben konnte man nicht beides haben.
Während die Ravioli warm wurden, faltete sich Micha einen Papierflieger. Dieser segelte durch die offene Balkontür hinaus und blieb auf den Fliesen liegen. Er erzitterte in der leichten Brise, doch war sie zu schwach, um ihn wirklich zu bewegen.
*

WENIG SPÄTER SAß MICHA mit einem Teller Ravioli am Küchentisch. Während er aß, fiel ihm die Kette wieder ein. Er holte sie aus seiner Tasche und betrachtete sie. Das Licht der Küchenlampe spiegelte sich darin und brachte sie zum Funkeln. Er schlenderte zu dem großen Spiegel, der im Flur ihrer Wohnung hing, und legte die Kette um.
Plötzlich beschlich ihn ein seltsames Gefühl. Micha sah sich um. Hatte er dort eben Schritte gehört? War da ein Schatten gewesen?
Micha....
Micha erschrak und schrie kurz auf. Er presste sich die Hand auf den Mund. Da war eine Stimme! In seinem Kopf, es war nicht sein Gedanke gewesen. Er sah über seine Schulter. Dort war niemand.
Nein, du bist nicht verrückt. Du bist sehr weise, um genau zu sein.
Dieses Mal fiel Micha auf, dass neben seinem Spiegelbild jemand stand. Er war nur undeutlich zu erkennen. Wie ein Schatten. Angsterfüllt sah er sich um, doch da war immer noch niemand mit ihm im Flur. Der Schatten war keinen Meter von ihm entfernt. Er griff in die Luft, doch er traf auf keinen Widerstand. Als er in den Spiegel sah, war er immer noch da. Micha hatte das Gefühl, ihn aus dem Augenwinkel neben sich zu sehen.
Ich bin da, ohne da zu sein. Hab keine Angst. Ich will dir nichts Böses.
„Wer bist du?“, fragte Micha laut, um sich zu konzentrieren. Die Stimme in seinem Kopf machte ihm immer noch panische Angst. Das Herz schlug ihm bis zum Hals.
Ich bin ein Magier, durch ein missglücktes Experiment bin ich an dieses Stück Metall gebunden worden. Ich warte schon so lange darauf, dass jemand die Kette umlegt, damit ich endlich wieder jemanden zum Reden habe. Ich bin gebunden an sie, kann mich nicht von ihr entfernen. Nur wer sie trägt, sieht mich.
„Du bist ein Zauberer?“, fragte Micha skeptisch mit herablassendem Tonfall.
Zweifelst du etwa an meinem Wort?
„Fragte mich mein Hirngespinst“, ergänzte Micha.
Ich beweise es dir.
„Na, jetzt bin ich gespannt.“
Sieh den Papierflieger an. Konzentriere dich auf ihn. Stell dir vor, er würde brennen.
Micha sah skeptisch auf den Balkon. Dort erzitterte der Papierflieger immer noch in einer leichten Brise.
Du musst daran glauben, stell dir das Bild vor. Streng dich an. Du hast die Gabe dazu. Ich weiß es.
Tatsächlich begann der Flieger an einer Ecke zu brennen. Munter breitete sich die Flamme aus.
Siehst du? Ich hatte recht.
Michas Augen weiteten sich panisch, als ihm klar wurde, was das bedeutete. Er setzte sich zurück an den Esstisch. Er starrte einen Moment auf den Herd und versuchte seine Gedanken zu ordnen. Die Stimme schien zu verstehen, dass er verwirrt war und schwieg.
„Wie bist du an diese Kette gebunden worden?“, fragte er schließlich.
*

BALTHASAR TEN DORNAN saß zur gleichen Zeit nicht weit entfernt in der kleinen Wohnung über seinem Laden. Vor ihm dampfte eine Portion Linsensuppe verführerisch. Doch bevor er sich dieser widmen durfte, hatte er noch etwas zu erledigen. Er ging noch einmal nach unten in den Laden, kontrollierte, ob die Ladentür verschlossen war, und malte mit dem Finger auf der Tür ein Zeichen in die Luft, das kurz aufglimmte. Wie die Funken einer Wunderkerze glimmte das Symbol auf. Es war ein Schutzzeichen. Damit niemand in den Laden hinein konnte, ohne dass Balthasar es bemerkte. Auch konnte nichts den Laden unbemerkt verlassen.
Er überlegte, was von beidem das Schlimmere wäre.
Balthasar schlenderte ruhigen Schrittes durch seinen Laden und besah sich einige seiner neueren Stücke.
Der Junge, der heute bei ihm gewesen war, hatte ihn überrascht. Er musste eine gewisse Begabung zur Magie haben, sonst hätte er den Antiquitätenladen nicht einmal sehen können. Nein, er hätte ihn selbst dann nicht sehen dürfen. Menschen mit leichtem, ungenutztem, magischem Potenzial konnten seinen Laden auch nicht wahrnehmen. Für sie existierte er einfach nicht, genau wie für all die anderen magisch Unbegabten. Dieser Junge musste eine besonders starke Veranlagung haben. Es kam Balthasar seltsam vor, dass er nicht darin geübt schien sie zu nutzen. Er würde ihn bei nächster Gelegenheit mit einem Bannspruch belegen, der verhinderte, dass er jemandem von diesem Laden erzählte. Im besten Fall würde jemand den Jungen nur für verrückt halten, weil er ein Geschäft sah, was nicht da war. Im schlimmsten Fall würde es Balthasar Arbeit machen.
Balthasar überlegte, wo der Junge gestanden hatte, als er ihn das erste Mal gesehen hatte. Bald hatte er das Regal gefunden. Er blickte flüchtig hinein. Alles schien an seinem Platz zu sein.
Balthasar wollte sich bereits wieder abwenden, um zu seinem Essen zu gelangen, als ihn eine dunkle Ahnung beschlich. Anhand des Staubs auf dem Regal konnte man sehen, dass die Gegenstände länger nicht bewegt worden waren. Bis auf eine kleine Schatulle, die mit einem verworrenen Muster verziert war. Schriftzeichen in einer alten Sprache.
„Oh Gott, nein“, entwich es Balthasar, als er die Schatulle öffnete und sie leer vorfand. Man hatte ihn bestohlen. Er musste diesen Jungen finden!
*

UND SO BANNTE ER MICH an und in das Amulett.
Die Stimme hatte Micha erzählt, wie sie einst gegen einen anderen Magier gekämpft hatte. Einen bösen und finsteren Hexer, der ihn an die Kette gebunden hatte.
„Und du erinnerst dich nicht mehr an deinen Namen?“
Es ist alles so unsagbar lange her. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht einmal mehr meinen eigenen Namen.
Die Stimme schwieg einen Moment.
„Hör mal“, setzte Micha an, dessen Blick auf die Uhr gewandert war.
Du willst mich ablegen. Ich flehe dich an, tu es nicht.
„Ich muss aber morgen zur Schule und jetzt erstmal schlafen. Das war heute ziemlich viel. Ich brauche ein wenig Schlaf“, erklärte Micha. „Aber ich lege die Kette morgen früh, sofort wieder um. Gleich wenn ich zur Schule gehe. Versprochen.“
Ich bitte dich, tu es nicht.
Die Stimme war nun leicht verzweifelt. Irgendetwas an ihr sorgte dafür, dass sich Michas Nackenhaare aufstellten.
„Ich gebe dir mein Ehrenwort, ich lege die Kette morgen früh wieder an“, erklärte Micha. Eine Weile war es vollkommen still.
Ich setzte meine Hoffnungen und mein Vertrauen in dich.
Dann war es wieder still. Micha legte die Kette ab und steckte sie in seine Jackentasche. Müde stand er auf, um ins Bett zu gehen.
*

AM NÄCHSTEN MORGEN legte Micha die Kette wie versprochen um, bevor er sich aufmachte zur Schule. Es dauerte nicht lange, bis er die Stimme erneut hörte.
Du hast dein Versprechen gehalten.
„Natürlich“, flüsterte Micha. Er ging eine Seitengasse entlang, in der niemand war. Trotzdem wollte er nicht, dass ihn zufällig irgendjemand mit sich selbst reden sah. Im Augenwinkel sah er den vertrauten Schatten des Magiers.
Vor wem fürchtest du dich?
„Vor niemandem, wieso?“
Weil du diesen Weg gehst, um etwas auszuweichen. Es ist dir unangenehm.
Micha erschrak, wie gut der Fremde in seine Gedanken sehen konnte. Konnte er sie womöglich lesen?
„Vor Dustin und seinen Spießgesellen“, erklärte Micha. „Sie schikanieren mich. Seit einiger Zeit schlagen sie mich auch, wenn sie mich in die Finger bekommen.“
Nicht mehr.
„Wie?“
Sie werden es nicht mehr tun. Du hast nun mich. Mit meiner Hilfe kannst du weit mehr, als nur einen Papierflieger anzuzünden. Ich kann dir helfen, dass deine kühnsten Wünsche wahr werden. Dass Menschen sich deinem Willen beugen. Dass niemand es mehr wagt, sich über dich lustig zu machen.
Während die Stimme ihm mit verführerischem Klang von all dem erzählte, was sie konnte, tauchten plötzlich Dustin und mehrere andere Jungen in der Gasse auf.
Micha blieb wie angewurzelt stehen.
„Na, Jakobs? Gestern einen schönen Stadtbummel gemacht?“, sagte Dustin und grinste dämlich, während er auf Micha zuging. Vier andere Jungen flankierten ihn dabei und fächerten langsam auseinander.
„Was willst du, Dustin? Ich habe dir nichts getan, lass mich in Frieden und benimm dich wie ein Erwachsener“, rief Micha. Er hatte es satt.
„Behauptest du, ich benehme mich kindisch?“, keifte Dustin zurück.
Nein, eher wie ein boshafter kleiner Drecksack. Einer von denen, die mal eine Grenze gezeigt bekommen sollten.
Micha musste unwillkürlich bei dem Gedanken grinsen.
„Ich sorg dafür, dass dir das Grinsen schon noch vergeht“, knurrte Dustin, der das Lächeln falsch verstand.
Er war in Schlagreichweite und holte aus. Micha, der geahnt hatte, dass Dustin mit links schlagen würde, ließ sich nach hinten fallen. Der Schlag ging ins Leere. Dafür trat Dustin zu. Er trug Stiefel. Schmerzhaft bohrte sich die Fußspitze in Michas Seite und trieb ihm die Luft aus den Lungen.
Konzentriere dich auf ihn. Lass ihn leiden.
Nein, dachte Micha, ich kann ihn doch nicht einfach anzünden!
Doch! Lass ihn brennen!
In diesem Moment bekam Micha einen weiteren Tritt in die Seite. Plötzlich schien sein Unterleib nur noch aus Schmerzen zu bestehen.
Wütend fixierte er Dustin und konzentrierte sich.
Ja, so ist es gut. Tu es, er hat es verdient!
Alle Jungen schrien plötzlich auf. Dustins Arme hatten Feuer gefangen und das Feuer befiel nun auch seinen Rücken. Schreiend wälzte sich dieser nun auf dem Rücken und versuchte verzweifelt das Feuer zu löschen. Die Jungen starrten Micha an und rannten panisch schreiend davon.
Micha begriff, dass er das getan hatte. Alleine mit dem schreienden Dustin, bekam er Angst.
Das war nicht richtig, ging es ihm durch den Kopf. Er versuchte die Kette abzunehmen, doch sie schloss sich enger um seinen Hals, so dass sie ihm ins Fleisch schnitt.
Du wirst jetzt nicht aufhören. Nicht wo es anfängt interessant zu werden, knurrte die Stimme in seinem Kopf.
„Lass ihn, bitte“, rief Micha und blickte den brennenden und schreienden Dustin an. Micha versuchte sich darauf zu konzentrieren, dass die Flammen erloschen, doch nichts geschah.
Eitler Mensch, glaubst du, dass dein Wille größer ist als meiner?
In diesem Augenblick rannte der alte Mann aus dem Antiquitätenladen an Micha vorbei zu Dustin. Er berührte diesen vor sich hin murmelnd und das Feuer ignorierend an der Stirn. Auf einmal waren die Flammen erloschen!
Dustin lag ruhig auf dem Boden und sah Balthasar erstaunt an. Dieser beugte sich zu ihm hinunter und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Anschließend malte er ein Zeichen in die Luft, das kurz aufglühte wie Funkenschlag. Dann erhob sich Dustin und ging die Straße entlang, Micha und Balthasar vollkommen ignorierend.
Die Kette schnitt Micha inzwischen immer fester in den Hals.
Balthasar nahm Micha an der Schulter und ging mit ihm die Gasse entlang.
Glaube ihm nicht, höre ihm nicht zu. Lass ihn brennen.
„Es tut weh“, röchelte Micha, dem die Kette inzwischen so sehr in den Hals schnitt, dass er fürchtete, ihm würde der Kehlkopf eingedrückt.
„Oh, entschuldige“, sagte Balthasar und berührte den Verschluss der Kette. Dabei murmelte er Worte in einer Sprache, die Micha noch nie gehört hatte.
Wage es nicht, alter Mann.
Dann herrschte Stille in Michas Kopf. Die Stimme war fort. Balthasar nahm die Kette und steckte sie in seine Jackentasche.
„Wie heißt du, Junge?“, fragte er.
„Micha Jakobs“, erklärte dieser wahrheitsgemäß. „Es tut mir leid, dass ich die Kette gestohlen habe, es tut mir wirklich, wirklich leid.“
Balthasar musterte ihn und nickte. Er schien Micha zu glauben.
„Ich handle mit magischen Antiquitäten, weißt du“, erklärte er. „Natürlich auch mit normalen Antiquitäten. Aber eigentlich eher mit den magischen. Mit gefährlichen. Manchmal auch mit Dingen, von denen ich selbst nicht genau weiß, wozu sie gemacht wurden. Gibt viele Magier, die das interessiert. Normalerweise finden auch nur Magier meinen Laden. Du hättest ihn gar nicht sehen dürfen. Diese Kette, sie bannt einen Dämon. Der hat mit dir geredet. Und dich vermutlich auch dazu gebracht sie zu stehlen, da du magisch beeinflussbar bist. Du bist begabt, aber ohne Ausbildung wird da nie mehr raus als gute Intuition.“
„Was ist mit Dustin passiert? Gerade brannte er noch, dann ging er ohne eine Verletzung seines Weges“, fragte Micha.
„Illusionsmagie“, sagte Balthasar. Als er Michas fragenden Blick sah, setzte er hinzu: „Du hast ihn nicht angezündet. Das könntest du gar nicht, naja, vielleicht mit genügend Anleitung durch den Dämon. Aber so konnte er mit deiner Hilfe nur eine Illusion von Feuer erzeugen. Die Illusion war schon heiß und Dustin fühlte sich als würde er brennen. Aber es war eben nur eine Illusion, mit der man schwache Geister manipuliert.“
„Also war er gar nicht in Gefahr?“
„Das würde ich nicht sagen. Er hätte sich etwas antun können, wegen der Schmerzen. Oder aber auch, wenn er älter gewesen wäre, einen Herzinfarkt haben können, da die Illusion von Schmerz auch weh tut.“
Inzwischen waren sie in der Brookinger-Straße angelangt.
„Ich werde auch niemandem etwas von Ihrem Laden sagen“, versprach Micha.
Balthasar lächelte traurig. „Das wirst du sicher nicht, das glaube ich wohl.“
Er sah Micha direkt in die Augen. Dieser konnte den Blick nicht abwenden, etwas schien ihn zu zwingen.
„Waren da noch andere Jungen?“, fragte Balthasar.
Micha nickte und nannte ihm die Namen der anderen.
„Danke. Das tut mir jetzt wirklich leid, aber es erscheint mir unumgänglich“, erklärte Balthasar und malte ein Symbol vor Micha in die Luft. Dabei sprach er leise ein paar Worte.
*

MICHA JAKOBS RANNTE, wie er noch nie gerannt war in seinem Leben. Er war auf dem Schulweg falsch abgebogen und in der Brookinger-Straße gelandet. Er fragte sich immer noch, wie ihm das hatte passieren können. Jetzt aber war es für ihn das Wichtigste, nicht zu spät zur Schule zu kommen.
Er hoffte sehr darauf, dass Dustin ihm heute nicht wieder begegnen würde.
ENDE
Wissen und nicht wissen

|

|


Jonathan sah auf den umgestürzten Baum in seiner Einfahrt und ging einige Schritte um ihn herum. Er war gerade einmal knappe zehn Zentimeter neben dem Seitenspiegel aufgeschlagen. Das Auto hatte keinen einzigen Kratzer. Jonathan überlegte, ob das nicht Grund genug wäre an eine höhere Macht zu glauben, entschied sich aber angesichts der Zerstörung in der restlichen Siedlung dagegen.
Es hatte ein Sturm letzte Nacht gewütet, der ganze Schneisen in die dichten Fichten und Tannen gerissen hatte. Ähnlich wie beim Sturm Kyrill war das Sauerland gerade so mit blauem Auge davongekommen.
Natürlich war es ein Freitag gewesen, so dass der Samstag zum Aufräumen blieb. Jonathan war froh, dass seine Tochter ihm helfen konnte, hätte aber seine Freizeit doch gerne anders verbracht.
Während er einen schweren Ast zum Waldrand trug, flitzte Karina mit einem Eimer Laub an ihm vorbei. Seine neunjährige Tochter wusste, wohin damit. Nahe hinter dem Waldrand war eine Senke, in der alle Nachbarn ihre Grünabfälle entsorgten. Manche auch mal etwas Schrott, aber jeder hütete sich davor, das der Polizei zu melden, denn dann wäre ja die Fläche bekannt geworden. Und wohin dann mit dem Grünabfall?
Also wurde der ein oder andere Toaster sowie ein Fernseher dort abgeladen, ohne dass es jemanden interessiert hätte.
Nun brachte auch Jonathan mit Karina all den Abfall dorthin, den der Sturm verursacht hatte. Dabei half ihnen noch Ben. Wie Karina war er neun Jahre alt und hatte blondes Haar.
Jonathan hatte vor über einem Jahr von seiner Tochter erzählt bekommen, dass sie und Ben geheiratet hätten. Dabei wollte sie das nochmal von ihrem Vater erklärt bekommen. Nach der Erklärung hatte sie verkündet, dass sie doch eher verlobt seien. Vor allem dem Küssen stand sie dabei skeptisch gegenüber und das müsste man dann ja wohl, sagte sie.
Dabei war es dann auch geblieben, was ihren Vater doch etwas überrascht hatte.
Während Jonathan den schweren Ast auf der Schrottplatz-Lichtung ablegte, sah er den Kindern zu.
Ben und Karina spielten bei den „Höhlen“, einer Ansammlung von Ästen und Schrott sowie einer Hecke, die so mit dem Grünabfall der Jahre überschüttet worden war, dass sich kleine Gänge und Höhlungen ergeben hatten. Er hasste es, wenn Karina da reinging. Was, wenn sie da einbrach? Aber wenn er in der Nähe war, gestattete er es. Besser er war da, als wenn er es rigoros verbot und sie es dann tat, wenn niemand in der Nähe war, der helfen konnte. Dass ein einfaches Verbot ein Kind je von etwas abgehalten hätte, wenn es unbeobachtet war, hielt er für ein Gerücht. Er wusste ja, wie er in dem Alter gewesen war. Er hätte sich nicht an ein völliges Verbot gehalten. Zu verlockend war doch dieses Höhlensystem. Als die beiden im Höhlennetzwerk waren, geschah etwas, das Jonathan den Atem anhalten ließ.
Vor ihm lag ein alter Fernseher.
Der Fernseher, in der rustikalen Optik der Sechziger gehalten, war an!
Er war eingebettet in das dichte Ast- und Erdwerk der Wände des Höhlensystems. Und er zeigte Bilder, wenn auch flackernd und ohne Ton.
Jonathan lief hin und besah sich das genauer.
Das konnte doch nicht sein, woher sollte der Strom kommen?
Ein junger, nervös wirkender Mann und eine breit lächelnde Frau feierten Hochzeit auf dem Bildschirm. Jonathan ging näher heran.
Woher kannte er die beiden? Dann verstand er die Ähnlichkeit.
Das waren Ben und Karina! Sie waren beide Anfang zwanzig. Er wollte sich abwenden, sich von einer Einbildung nicht in Beschlag nehmen lassen.
Doch es ging nicht.
Er konnte den Blick nicht abwenden. Er sah, wie glücklich die beiden waren, wie sie, älter, ein Kind tauften. Lächelnd setzte Jonathan sich hin und sah zu.
Dann veränderte sich die Szenerie und Jonathans Mund wurde trocken.
Ben schlug seine Tochter! Sie taumelte, krachte gegen einen Ecktisch. Dann lag sie da, Blut lief aus der Wunde.
Hundert Male hatte Jonathan den Tod im Fernseher gesehen, doch nun war es etwas anderes. Jetzt war es jemand, der ihm nahe stand, nein, am nächsten.
Das Bild zeigte nun, wie Ben seine Tochter, SEINE TOCHER, in den Garten zog und im Dunkeln verscharrte. Dann wurde der Bildschirm schwarz.
Jonathan schluckte und sprintete die wenigen Meter bis zu dem Bildschirm.
„Was soll das?“, brüllte er den Fernseher an. „Zeig mir mehr!“ Ihn erstaunte die Heftigkeit seiner Reaktion selbst.
Doch der Fernseher blieb stumm.
Jonathan schlug dagegen, doch davon tat ihm nur die Hand weh.
„Entschuldigen Sie, geht es Ihnen gut?“, erklang hinter ihm die unsichere Kinderstimme von Ben.
Jonathan wirbelte herum und packte den Jungen am Kragen, er hob ihn hoch und schüttelte ihn. Er war wütend, frustriert und verunsichert.
„Du“, zischte er dabei.
Dann schien der rationale Teil seines Verstandes endlich hinterherzukommen.
Er ließ den Jungen herab.
„Es tut mir leid“, murmelte Jonathan und der Junge sah ihn verwirrt mit tränenden Augen an. Ben blinzelte, kämpfte die Tränen nieder. Dann lief er weg. Direkt zu Karina, die in der Nähe stand und das alles mitangesehen zu haben schien.
Sie sah verwirrt ihren Vater an und und nahm geistesgegenwärtig Ben in den Arm.
„Ist schon gut“, versuchte Jonathan es halbherzig noch einmal mit Beschwichtigung.
Als keines der Kinder reagierte, sagte er es noch einmal lauter: „Es tut mir leid.“
„Ist okay, denke ich“, sagte Karina. „Sollen wir weiterarbeiten?“
„Ja, ich mach eine kurze Pause“, stimmte Jonathan zu.
Er ging nach Hause, in Gedanken immer wieder die Bilder wiederholend, die er gesehen hatte.
Es verstörte ihn, was doch nicht sein konnte.
Aber was nützte ihm zu wissen, dass ein Fernseher kein Orakel war, wenn er doch genau das gesehen hatte.
Oder hatte er sich das eingebildet?
Das half alles nichts, entschied er. Er wusste ja nicht mal, ob er die Zukunft gesehen hatte.
Was, wenn es nur eine Prognose war, aufgrund dessen was gerade an Fakten da war in der Gegenwart?
Die Zukunft war doch nicht unveränderlich, oder?
Er suchte aus den bereits für Weihnachten eingekauften Süßigkeiten für Karina einen Schokonikolaus heraus. Er würde bis Weihnachten eben einen neuen kaufen müssen. Mit dem machte er sich zu den Kindern auf, die noch immer fleißig die Trümmer des letzten Sturms beseitigten. Als Ben ihn sah, zog er misstrauisch die Augenbrauen hoch und verschränkte die Arme vor der Brust.
Er sah, fand Jonathan, erschreckend alt dabei aus. War er es gewohnt, seine Umwelt feindlich zu sehen?
Gab es nicht Gerüchte, dass bei Ben zu Hause gerne einmal zugelangt wurde?
Nein, entschied Jonathan, du machst dich verrückt. Das ist nur überinterpretieren, lass das.
„Ben, es tut mir leid“, sagte Jonathan und reichte Ben den Nikolaus. Dieser, immer noch die Stirn in Falten, nahm ihn an.
„Danke“, sagte er skeptisch.
„Es tut mir sehr leid, ich war nicht ich selbst“, sagte Jonathan und meinte es auch so.
Ben nickte. „Okay.“
Mehr war aus ihm wohl im Moment nicht herauszubekommen, entschied Jonathan und fing wortlos an mitzuhelfen.
Schweigend schafften sie die Trümmer fort.
*

ABENDS GING JONATHAN mit seinem Hund eine große Runde durch den Ort.
Theoderich, benannt nach einem der Merowinger-Könige, zog ziemlich. Jonathan schlenderte ihm eindeutig zu sehr grüblerisch vor sich hin.
Dabei kamen sie am Haus von Bens Familie vorbei. Jonathan sah, dass Licht brannte und versuchte von der Straße ins Haus zu sehen.
Er kam sich mies dabei vor, doch war die Neugier zu groß.
Was, wenn er die Vision abwehren konnte?
Die Gardinen waren nicht zugezogen und gaben den Blick frei aufs Wohnzimmer. Er sah Bens Mutter auf dem Sofa. Sie brüllte etwas. Ben kam herein. Er brachte ihr etwas, eine Flasche. Dann schickte sie ihn mit einer Handbewegung weg. Jonathan erkannte den misstrauischen Gesichtsausdruck wieder. Dieses Stirnrunzeln, mit dem Ben ihn auch bedacht hatte, als Jonathan sich hatte entschuldigen wollen. Seine Mutter zündete sich eine Zigarette an und schien sich zu entspannen. Jonathan setzte seinen Weg fort, Theoderich wurde zunehmend unruhig.
Nachdenklich ging Jonathan mit seinem Hund weiter die Runde.
Was sollte er nur tun?
Es gab so viele Unbekannte, die Zukunft betreffend. So viele Variablen, die das Ergebnis verändern konnten. Oder hatte er sich das nicht doch alles nur eingebildet? Hatte er in letzter Zeit zu viel gearbeitet. Dann kam Jonathan eine Erkenntnis, wie ein Blitz.
Was, wenn er durch seine Taten erst den Jungen zu dem machen würde? Ihn zu dem machte, was er gesehen hatte?
Unbewusst hatte er den Weg zum Fernseher eingeschlagen.
Dieser lag dunkel da, zeigte nur Schwärze.
„Zeig es mir nochmal“, sagte Jonathan. Theoderich sah ihn irritiert an und legte den Kopf schief. Der Hund verstand nicht, mit wem geredet wurde, oder sollte er gemeint sein?
Der Bildschirm bliebt schwarz.
Wenn ich einen freien Willen habe, dachte Jonathan, dann gibt es nicht die Zukunft an sich. Alles, was geschieht, ist dann in Bewegung, abhängig von den Voraussetzungen des Jetzt.
Grüblerisch starrte er vor sich hin.
Theoderich setzte sich gelangweilt neben ihn.
„Das wird nicht passieren“, entschied Jonathan und machte sich auf den Weg nach Hause.
Es lag doch, wie alles in der Zukunft, in seiner Hand, oder?
ENDE
Der Ring, der Wünsche erfüllt

|

|


Annas Fuß verfing sich an einer Wurzel, und sie schlug der Länge nach hin. Sie stemmte sich auf ihre Unterarme und musste husten, der Waldboden war trocken. Es hatte seit Tagen nicht geregnet.
„Was zum...“, presste sie zwischen zusammengebissenen Lippen hervor. Ihr Bein schmerzte, sie hatte es sich an einem Stein aufgeschlagen. Durch den Staub in der Wunde brannte es. Doch das war nicht der Grund für ihr Erstaunen. Vor ihr lag ein kleiner Ring, halb versunken im Dreck. Er war matt silbern mit kleinen Gravuren. Sie hob ihn vorsichtig auf und begutachtete ihn. Die kleinen Gravuren konnten auch Buchstaben sein, wurde ihr klar. Ihr gefiel der Ring. Sie steckte ihn an und betrachtete ihr Knie. Ein zwei Zentimeter langer, dreckiger Riss zog sich an ihrem Bein entlang. Blut sickerte hinunter. Na, dachte sie, wenigstens hab ich eine kurze Hose an. Sie wischte sich das Blut mit einem Taschentuch etwas ab und sah sich um. Sie hatte die Wurzel übersehen wegen der überwältigenden Aussicht, die sich ihr hier bot. Sie wohnte seit sie 17 geworden war im Sauerland, also seit anderthalb Jahren. Trotzdem beeindruckte sie die Aussicht über das Tal, in dem sie lebte, immer wieder aufs Neue. Die Listertalsperre zog sich unter ihr entlang und war spiegelglatt. Ihr Handy vibrierte. Erstaunt, hier überhaupt Empfang zu haben, zog sie es aus der Tasche.
sei um sechs zu hause, wir grillen, lg mama
Sie blickte noch einmal hinunter und riss sich dann vom Ausblick los. Bis sechs war nicht zu viel Zeit, deswegen würde sie sich beeilen müssen.
––––––––

DAS GEMEINSAME ESSEN verlief ereignislos, wie so oft. Während Anna von ihrem Zimmer aus der Sonne beim Sinken zusah, fiel ihr plötzlich ein, dass sie noch Mathe-Hausaufgaben zu erledigen hatte. Also setzte sie sich mit übertriebener Langsamkeit an ihren Schreibtisch und holte ihr Buch heraus. Eine Weile las sie die Aufgaben, bei deren Lösung sicher die Bernoulli-Kette benutzt werden würde, ging es ihr durch den Kopf. Ach, lass stecken, dachte sie. Sicher hat Herr Furholz Verständnis dafür, dass ich es nicht konnte. Sie wusste, dass es anders sein würde, Furholz war streng, selbstverliebt und von den blonden hochgegelten Haaren bis zu den ledernen Altherrenschuhen unsympathisch.
Sie schob den Gedanken beiseite und versicherte sich: Er wird nicht sauer sein, es gibt keinen Eintrag, wenn ich es mir wünsche!
Am nächsten Tag hatte sie Mathe in den ersten beiden Stunden und völlig vergessen, die Hausaufgaben von jemandem abzuschreiben. Herr Furholz betrat den Raum und beendete jeden Gedanken ans Abschreiben. Er setzte sich ans Pult und öffnete seinen Ordner. Anna erhob sich pflichtschuldig und wollte zu ihm, sie überlegte fieberhaft, was für eine Ausrede bei ihm ziehen würde. Ihr fiel keine ein.
„Hören Sie, Herr Furholz, ich hab leider nicht gewusst, wie ich die Aufgabe machen soll“, erklärte sie. Sie versuchte dabei möglichst nach einem Haufen Elend auszusehen, um sein Mitleid zu erwecken. Sie hoffte inständig, dass er welches habe, auch wenn man oft das Gefühl hatte, dass er dazu nicht fähig sei.
„Und deswegen hast du natürlich gar nichts gemacht“, fügte Herr Furholz hinzu. Sie nickte langsam. „Na, das lass ich diesmal durchgehen.“
„Wie bitte?“, entfuhr es Melanie aus der ersten Reihe. „Sie haben mich deswegen gerade eingetragen!“
„Ja, aber sie hat auch noch nicht so oft die Hausaufgaben nicht gehabt wie du“, erwiderte Herr Furholz. Damit war das Thema beendet, Anna sollte sich setzen. Die Stunde wollte nicht enden für Anna, doch als sie endlich herum war, gehörte sie zu den Ersten, die aus dem Raum waren. Sie war die ganze Stunde durchgekommen, ohne drangenommen zu werden. Wie immer hatte sie sich möglichst klein gemacht und interessiert gewirkt. Sie hatte bemerkt, dass Furholz weniger die dran nahm, die ihn direkt ansahen, als die, die seinem Blick auswichen. So entwickelte sich bei ihr die Diskrepanz zwischen Innerem und Aussehen, innerlich brüllte sie immer „Nimm mich bitte nicht dran!“, äußerlich zeigte sie das Bild einer interessierten, aber introvertierten Schülerin. Manchmal klappte es, heute war endlich mal wieder so eine Stunde gewesen.
Während sie den Flur entlangging, unterhielt sie sich mit Anastas, ihrer besten Freundin. Anastas‘ Eltern waren Deutschrussen, wobei Anastas das Los der Migranten getroffen hatte. War sie bei ihrer Oma in Russland, war sie „die Deutsche“, die nur mit seltsamem Akzent Russisch sprach, war sie in Deutschland, war sie „die Russin“. Das hatte bei ihr über die Zeit zu einem extremen Einkapseln geführt, Anna war eine ihrer wenigen wirklichen Freundinnen.
„Du hattest wirklich Glück“, meinte Anastas zu Anna. Sie hatten während Mathe nicht reden können, da Herr Fuhrholz sie schon vor Wochen auseinander gesetzt hatte. Anastas hatte Anna immer wieder geholfen, was er irgendwann gemerkt hatte.
„Ja, normalerweise hätte er mich auseinandergenommen und mich aufgeschrieben. Zusammen mit den anderen Malen wäre dann ein Blauer fällig geworden“, stimmte Anna zu. Ein „Blauer“ war ein Blauer Brief, eine schriftliche Benachrichtigung der Eltern über die Lernleistung der Schüler. Anna war zwar bereits volljährig, trotzdem versandte ihre Schule und vor allem Herr Furholz gerne solche Briefe, da er der Meinung war, dass man mit der Volljährigkeit kaum als erwachsen gelten würde.
„Woher hast du eigentlich diesen Ring?“, fragte Anastas.
„Du bemerkst auch alles“, sagte Anna zwinkernd. „Hab ihn im Wald gefunden. Schade für den, der ihn verloren hat, aber schön für mich.“
„Naja, du musst ihn ja auch quasi behalten, immerhin, wo hättest du ihn auch abgeben sollen? Beim Förster?“, stimmte ihr Anastas lächelnd zu. „Vielleicht ist es ja ein Glücksbringer, wenn man bedenkt, was heute passiert ist?“
„Ja, vielleicht.“
„Hast du Daniel eigentlich inzwischen gefragt, ob er mal mit dir ausgeht? Ins Kino?“, fragte Anastas nach einigen Minuten.
„Was? Nein, ich wünschte, er würde fragen, ich trau mich einfach nicht“, erwiderte Anna. Sie setzten sich beide auf eine der Bänke, die in der großen Eingangshalle des mehrstöckigen Schulgebäudes waren. Um sie herum waren andere Bänke und einige Tische, diese Ecke gehörte nur den „Oberstüflern“, Daniel Irmenau saß einige Meter von ihnen entfernt. Er hatte kurzes blondes Haar und war seit zwei Jahren Annas Schwarm.
„Er wird aber nie fragen, weil du dich ja kaum traust mit ihm zu reden“, hakte Anastas nach. Anna blickte sie böse an.
„Gibt mir da wirklich jemand Beziehungstipps, der selbst gerne eine Mauer um sich zieht?“
„Ich hab Ahnung, was Introvertiertheit mit deinen Chancen einen Partner zu bekommen macht“, erwiderte Anastas schnippisch. In diesem Moment erhob sich Daniel.
Geht er auf mich zu?, ging es Anna durch den Kopf. Nein, Blödsinn. Doch?
Daniel ging direkt zu ihr!
„Hey, sag mal, wie wär‘s, wenn wir Freitag ins Kino gehen?“, fragte er. Anna war einen Moment völlig perplex und konnte nicht antworten. Sie hatte es immer mal wieder in letzter Zeit geschafft mit Daniel zu reden, aber dass er sie nun fragte! Dieser Ring musste ihr Glück bringen, ging es ihr durch den Kopf.
„Ja, natürlich“, brachte sie hervor, während Anastas‘ Fuß unauffällig den ihren anstubste.
„Gut, dann morgen Abend am Kino, um Viertel vor Acht“, sagte Daniel und wandte sich ab.
Anna sah ihm hinterher. „Ist das gerade wirklich passiert?“, brachte sie hervor. Sie blickte Anastas an. „Ist das wirklich passiert? Er hat von sich aus, nüchtern, mich, mich auf ein Date eingeladen?“
Anastas musste kichern. „Ja, scheint so. Dein Gesicht ist zu dämlich.“
––––––––

ANNA SCHWEBTE IM SIEBTEN Himmel, während sie später mit dem Bus nach Hause fuhr. Alles in ihr jubelte und sie fühlte sich, als könnte sie Berge versetzen.
Mit fröhlichen, ausholenden Schritten wanderte sie von ihrer Bushaltestelle hinauf zu ihrem Haus, in ihr Zimmer. Voller guter Laune setzte sie sich an ihre Mathe-Hausaufgaben. Morgen würde sie ein Date mit Daniel haben. Mit Daniel. Er war einer der süßesten Jungen der Schule. Es war perfekt.
Während des späten Mittagessens fiel ihre gute Laune auch ihren Eltern auf.
„Ach, ich bin nur so gut gelaunt“, erwiderte sie. „Aber, dabei fällt mir ein, mich müsste morgen jemand in die Stadt bringen, zum Kino, geht das?“
„Tut mir leid, ich muss den Wagen heute Abend zur Werkstatt bringen, das weißt du“, erklärte ihr Vater. „Morgen ist es noch nicht fertig. Geht es nicht ein anderes Mal?“
„Was? Nein, nein das geht nicht, du musst mich fahren!“
„Ich würde ja, aber ich muss den Wagen jetzt wegbringen“, erklärte ihr Vater, inzwischen nicht mehr ganz so ruhig. Er stand auf. „Der Termin ist der einzige in diesem ganzen Monat, es geht nicht anders. Du musst eben flexibel sein, wenn du etwas von anderen willst!“
„Flexibel?“, presste sie hervor. Ich geb dir gleich flexibel, ging es ihr durch den Kopf, doch sie verkniff sich den Kommentar.
Mein ganzes Leben hängt vielleicht davon ab. Ich kann ihm nicht einfach absagen!
Die Gedanken in ihrem Kopf rasten.
„Hör mal, Anna, das geht doch sicher auch nächsten Freitag“, versuchte ihre Mutter zu schlichten. Anna stand auf und stürmte wortlos, wütend davon.
Ihr Vater schüttelte den Kopf. „Wann das wohl besser wird mit der Launenhaftigkeit?“, murmelte er.
––––––––

ANNA SAß IN IHREM BETT und hörte Musik. Sie war wütend, doch mangels eines besseren Ventils musste die Musik ausreichen.
Ihre Gedanken rasten, sie wünschte, dass sie ihre Eltern los wäre.
Oder zumindest meinen Vater, immer verbietet er alles! Immer macht er alles kaputt! Wenn ich ihn doch los wäre!
Sie begann zu dem Stakkato des Schlagzeuges langsam den Ring an ihrem Finger zu drehen. Nach einer Weile bemerkte sie, dass sie wegdämmerte und legte ihren MP3-Player zur Seite. Sie schlief erschöpft vom Tag ein und fiel in einen tiefen Schlaf.
Sie hatte schlimme Albträume. Sie sah ihren Vater, wie er ihren alten VW-Passat den Berg hinabfuhr, die dunklen gewundenen Straßen entlang. Plötzlich tauchte hinter einer Kurve ein LKW auf, wie so oft sehr weit auf der Gegenfahrbahn. Ihr Vater konnte nicht schnell genug reagieren, schrie und zog das Lenkrad etwas zur Seite. Anna erwachte schweißgebadet in ihrem Bett. Eine Weile lag sie nur da, das Pochen ihres eigenen Herzens im Ohr und lauschte in die Stille. Sie versuchte zu verarbeiten, was sie gerade gesehen hatte.
Es war nur ein Traum, sei kein dummes Kind, sei erwachsen, schluck es runter.
Sie atmete langsam ein und aus, zwang sich dazu, ihren Atem zu beruhigen.
Plötzlich hörte sie ein Geräusch. Sie hielt den Atem an. Es kam nicht von ihr. Es war leise. Vom Stockwerk unter ihr?
Ja, vom Wohnzimmer. Ein Wimmern. Wie ein Hund. Ein gequälter Laut.
Anna stand langsam auf und ging vorsichtig durch ihr Zimmer zur Tür. Der durch das Fenster einfallende Mond war die einzige Lichtquelle. Sie öffnete die Tür zur Flurgalerie, von der aus man ins Wohnzimmer ein Stockwerk weiter unten sehen konnte.
Ihre Mutter saß auf dem Sofa, das Telefon in der Hand, und weinte.
Eine Weile bewegte sich Anna nicht und sah ihr nur beim Weinen zu, unfähig, etwas zu sagen und mit einem unguten Gefühl in der Magengegend.
Dann endlich riss sie sich aus ihrer Lethargie los.
„Was ist los, Mama?“, fragte sie. Ihre Mutter fuhr hoch und sah zu ihr. Anna ging zur Treppe und hinunter ins Wohnzimmer, während ihre Mutter sich mit ihrem Ärmel versuchte, die Tränen wegzuwischen, dabei verwischte sie nur ihr Make-up.
„Was ist?“, fragte Anna erneut.
„Nichts“, nuschelte ihre Mutter. Anna setzte sich zu ihr auf das Sofa.
„Wenn du schon lügst, dann besser“, erwiderte Anna.
„Es geht um deinen Vater“, erklärte ihre Mutter. „Er hatte einen Autounfall. Er ist... Er... Er ist tot.“ Sie schluchzte. Während sie es aussprach, wurde sie vollkommen ruhig, ihr Blick war in weite Ferne gerichtet.
„Was?“, keuchte Anna. Die Welt fühlte sich so unwirklich an. Wie ein Traum, aus dem man in Sekunden aufwachen würde. Alles um sie war kalt. Sie ging nach draußen auf ihren Balkon, ohne recht zu wissen, wohin sie ging. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Es war nicht vorgesehen, nichts in ihr wusste, was zu tun war. Sie war vollkommen überfordert, fühlte sich deplatziert. Ihre Hände rangen miteinander, während sie vom Balkon sah.
Ich wünschte, ich wäre tot, ging es ihr durch den Kopf. Alles wäre vorbei, alles wäre gut. In diesem Moment fiel ihr Blick auf den Ring an ihrem Finger. Das war das Letzte was sie sah. Die Holzbretter, die den Boden des Balkons bildeten, brachen und sie stürzte, mit dem Kopf voran, auf den gepflasterten Hof.
Der Ring wurde zusammen mit ihr beerdigt. Noch heute, heißt es, liegt er auf irgendeinem Friedhof.
ENDE
Mein Freund, der Zwerg

|

|


„Du wirst heute Abend länger bleiben, und zwar für jede Minute, die du zu spät warst, eine Viertelstunde“, keifte mich Herman Rilisky an. Er leitete das Museum, in dem ich mein Praktikum verbrachte. Wobei „abarbeitete“ vielleicht eher passte. Eigentlich war es eine tolle Idee gewesen, zumindest solange es nicht Realität war. Man muss ein schulisches Praktikum machen, um Erfahrungen in der richtigen Berufswelt zu sammeln, du hast einen Monat keine richtige Schule, keine Hausaufgaben. Klang super. Okay, das Finden eines Jobs war schon schwerer, denn was bleibt einem jungen, eher bequemen, geschichtsinteressierten Kerl an Auswahl, wo man ein Praktikum machen könnte. Irgendwie bin ich dann beim Museum gelandet, ein Kumpel eines Freundes meiner Tante, hatte mir dazu verholfen, vielleicht war da aber auch noch irgendein anderer Verwandter mit beteiligt, was weiß ich.
Jedenfalls, war ich heute einmal wieder zu spät, ich hatte verschlafen und durfte nun vier Stunden länger arbeiten, so viel konnte ich im Kopf schon mitrechnen.
Ich arbeitete mehr oder weniger als Mädchen für alles, ich war Putzkraft, Dinge-Herum-Schieber und eigentlich für alles da, was anfiel.
Ich verbrachte die nächsten Stunden damit, das zu tun, was die Putzfrauen irgendwie nie so richtig hinbekamen, nämlich hier sauber zu wischen. Ich gebe zu, ich bin selbst kein sehr ordentlicher Mensch, aber Rilisky konnte dafür sorgen, dass man seinen Charakter gerne änderte. Er war irgendwas über 60, sicher nicht mehr lange von der Rente entfernt und hatte mit Geschichte wenig am Hut, er war das, was ich einen lupenreinen Bürokraten und Erbsenzähler nennen würde. Was ihm auch alles menschlich fehlte, das machte er durch sein Organisationstalent wieder weg. Ansonsten wäre er vermutlich auch nicht immer noch der Leiter dieser Einrichtung. Während langsam das Licht der untergehenden Montagssonne hinter den Fenstern schwächer wurde, kam ich schlussendlich in der hintersten Abteilung der sechs Oberbereiche an. Finsteres Mittelalter. Hier gab es alles, von Rüstungen, Schwertern bis hin zu Kirchenverzierungen, wie zum Beispiel Gargoyles und anderen Teufelsfratzen, die Dämonen fernhalten sollten. Plötzlich tippte mich jemand an der Schulter an und ich nahm meinen Kopfhörer aus dem Ohr.
„Hab's schon gehört, du musst länger arbeiten“, zirpte eine Stimme, die dafür sorgte, dass sich meine Eingeweide zusammenzogen. Alina Rose, Nichte von Rilisky und in meiner Schulstufe. Wir hatten uns unabhängig voneinander hier beworben, anders war es auch nicht zu erklären, dass wir beide hier waren. Sie verabscheute mich und vor allem meinen besten Freund, den sie als „widerlichen, fetten Sack“ bezeichnete. Sie selbst war der Prototyp einer Puppe. Helles Gesicht, wasserstoffblondes Haar und Schminke, die geradezu dazu einlud, Witze zu reißen. Sie selbst gehörte allerdings in meiner Stufe zur Highsociety, zumindest bezeichnete sich diese Gruppe selbst als sehr elitär. Was elitär an überteuerter Markenkleidung und diskriminierendem Verhalten war, hatte sich mir nie ganz erschlossen.
„Tja, shit happens“, erwiderte ich und blickte wieder demonstrativ in Richtung meines Moppes, bis sie sich abwandte. Sie hätte mich zu gerne aufgezogen, denn sie wusste genau, dass ich nicht ansatzweise die üblichen verbalen Angriffe loslassen konnte wie sonst, immerhin konnte sie über Rilisky dafür sorgen, dass meine Praktikumsbewertung sehr, sehr, sehr schlecht ausfiel. Und das wollte ich ihr nicht gönnen.
Einen Moment blickte sie mich noch an, wandte sich dann ab und ich konnte die nächsten Minuten jeden ihrer Schritte von mir weg hören, denn ihre Pfennigabsatz-Stiefel klickten laut, sehr laut.
Etwas später, ich war gerade fast fertig, kam Rilisky noch einmal vorbei. Er meinte, da ja noch etwas von der abzuarbeitenden Zeit da wäre, könnte ich mich ja mal dem Aufräumen der Kellerräume widmen, damit würde ich sowieso die nächsten Tage zubringen.
Entgegen Riliskys Hoffnung war ich sogar wirklich dankbar dafür, denn die Kellerräume waren immer faszinierend für mich, dort fühlte ich mich wieder wie ein Dreijähriger, der die Welt entdeckt. Dort lagen haufenweise Exponate.
Bald staubte ich im Keller einen Gegenstand nach dem anderen ab und räumte ihn fein säuberlich in Kisten ein, die Kisten dann meist in Regale.
Die meisten Dinge hier waren bereits gut verpackt, doch selbst wenn ich etwas kaputt gemacht hätte, hätte es vermutlich erst jemand in Jahren gemerkt, denn die Dinge hier interessierten scheinbar niemanden mehr.
Ich allerdings hatte meinen Spaß an Steinschlossgewehr-Repliken, Schwertern mit zerbrochener Klinge, Dolchen und alten Folianten, die allerdings meist nicht älter als 80 Jahre waren oder Nachbildungen. Die wirklich alten Stücke waren weitaus besser verpackt und in einem anderen Raum als dem, in dem ich war.
Irgendwann fand ich eine Abschrift eines Buches örtlicher Legenden und Mythen, die gut geschrieben war, und begann langsam darin zu lesen. Irgendetwas über einen Dämon, der in einem großen, würfelförmigen Felsen gebannt worden war. Was mich besonders daran interessierte, war, dass ich einen großen, würfelförmigen Felsbrocken hier unten bereits einmal gesehen hatte. Ich ging nach hinten in den Raum und fand dort den gesuchten Stein. Es war eine einzelne H-förmige Rune darauf eingraviert.
Ich schrieb mir eine Notiz in mein Handy, um am nächsten Tag mal Steven, einen der Museumsführer zu fragen, was es mit dem Stein auf sich hätte. Gerade als ich mich abwandte, piepte meine Uhr. Mitternacht. Verdammt, ich hatte gnadenlos meinen Feierabend verpasst und die Überstunden würden mir niemals angerechnet. Klasse.
Etwas summte hinter mir. Ich blickte mich um. Es hatte etwas von einer Resonanz, so wie bei manchen elektrischen Geräten. Während ich mich umsah, fiel mein Blick auf den Stein. Er wirkte seltsam, seine Oberfläche schien flüssig zu sein. Ich blinzelte, das musste am Licht hier unten liegen, meine Augen spielten mir scheinbar einen Streich.
Dann geschah etwas, das mich laut aufschreien ließ. Eine Hand kam heraus. Ich stolperte rückwärts und riss dabei einige Gegenstände hinunter. Einer davon brachte mich dann wohl zu Fall und ich schlug hart mit dem Kopf auf den steinernen Boden. Es wurde dunkel um mich herum.
„Hey, Junge, geht es dir gut?“, brummelte eine mir unbekannte Stimme. Ich öffnete vorsichtig ein Auge, langsam kam die Erinnerung daran zurück, was geschehen war. Ein bärtiges Gesicht war über mich gebeugt und blickte mich neugierig und irgendwie nervös an.
„Ja, danke, ich...“, begann ich, doch dann schreckte ich zurück. Das bärtige Gesicht saß auf einem Körper, der höchstens 1,20 Meter groß war. Breitschultrig und in einem ledernen Wams saß dort vor mir der Klischee-Zwerg, wie man ihn aus den Fantasy-Verfilmungen im Kino kannte.
„Ruhig, es geht keine Gefahr von mir aus. Ich bin Oanarr, ein Dvergatal der alten Zeit und wer bist du?“, erklärte der Zwerg und reichte mir seine Hand. Er wirkte irgendwie unbeholfen.
„Niclas, Niclas Schmidt“, erwiderte ich verdattert und gab ihm die Hand.
„Entschuldige, wenn ich dich erschreckt habe“, erklärte Oanarr. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass hier jemand ist.“
„Du bist also wirklich aus dem Stein gekommen? Ich hab das WIRKLICH gesehen?“
„Oh ja, hast du und ich wünschte auch, es wäre anders“, erwiderte Oanarr und setzte sich auf eine der herumstehenden Kisten. Er blickte mich an und räusperte sich unbeholfen.
„Entschuldige, aber was machst du hier?“, fragte er dann, als wäre ich ein Eindringling.
„Ich arbeite hier“, erklärte ich.
„Als was? Hier war seit Jahren keiner mehr, wenn ich den Stein verließ“, erwiderte der Zwerg.
„Naja, hier unten liegen halt alle möglichen Dinge, die man nicht mehr braucht, was machst du hier?“
„Ich bin hier, weil er hier ist“, sagte Oanarr nach einem Moment und deutete dann auf den Stein.
„Wie?“
„Ich bin verflucht“, begann er. „Ich bin an diesen Stein gebunden, am Tage muss ich in ihm ruhen, in der Nacht bin ich frei zu gehen, wohin ich will, doch wird es Tag, zwingt mich unsagbarer Schmerz dazu, zum Stein zurückzukehren. Wenn ich es nicht tue, leide ich Qualen, bis ich beim Stein bin oder die Nacht erneut hereinbricht.“
Ich blickte ihn sprachlos an, irgendwo in mir war der rationale Teil meines Gehirns gerade dabei, Selbstmord zu begehen und der Rest meines Verstandes akzeptierte somit vorerst, dass hier ein Zwerg mir seine Lebensgeschichte erzählte.
„Ich kann mich deswegen nicht allzu weit von dem Brocken hier entfernen“, fuhr Oanarr fort. „Ich verbringe meine Zeit damit, mir hier unten anzusehen, was da ist oder die Bücher zu lesen.“
„Daher kannst du auch meine Sprache, nicht wahr?“, erkannte ich plötzlich. Ich erinnerte mich an verschiedenste Wörterbücher, die hier gelegen hatten.
„Richtig.“
„Wie alt bist du ?“, fragte ich verdutzt.
„Insgesamt? Ich denke fast ein Dutzend Jahrhunderte, aber weißt du, ich zähle nicht mehr, schon lange nicht mehr. Der Fluch verhindert meinen Tod, auf sehr makabere Weise“
„Makaber?“
„Sterbe ich, so erwache ich aufs Neue wieder im Stein. Ich will ehrlich sein, ich habe es bereits mehrere Male probiert“, erklärte Oanarr und seufzte.
„Isst du?“, fragte ich nach einer Weile des Schweigens, in der Oanarr verloren vor sich hin starrte.
„Manchmal“, erwiderte er. „Ich benötige es nicht zwingend.“
„Wieso wurdest du verflucht?“, kam es mir auf einmal in den Sinn.
„Ich...“, begann Oanarr, doch dann polterte etwas. Jemand kam die Treppe hinunter. Als ich mich wieder ihm zuwandte, trat er gerade in den Stein hinein. Es war als würde er in einen See steigen, die Oberfläche des Steins schlug Wellen.
„Niclas?“, fragte Herr Schont, als er die Treppe hinunter kam. Er war der Nachtwächter und hatte eine gedehnte kölsche Sprechweise.
„Samma wat machst du denn noch hier unten?“
„Ich arbeite meine Überstunden ab“, erklärte ich und blickte noch einmal zum Stein. Seine Oberfläche war wieder vollkommen glatt als wäre nichts gewesen.
„Ach, hat Herman wieder rumjemotzt? Lass stecken und geh, dat passt schon. Is schon spät jenuch“, erwiderte Schont und blickte mich erwartungsvoll an. An jedem anderen Tag hätte ich ihm freudig gedankt, aber heute nicht. Doch was sollte ich machen? Ich wollte sein Angebot keinesfalls ausschlagen, denn noch mochte er mich. Wobei mir schleierhaft war, wieso, ich glaube aber, es lag daran, dass ich ihm in den Pausen zuhörte, es schien sich hier sonst kaum jemand mit ihm zu beschäftigen.
„Danke, hast was gut bei mir“, erwiderte ich und setzte ein freundliches Lächeln auf.
Unfreundlich weckte mich eine männliche Stimme, die mir erklärte, dass das Wetter heute keinesfalls angenehm würde. Mein Radiowecker plärrte weiter, während ich mich verschlafen aus dem Bett quälte. Ich wankte ins Bad, dabei kamen mir die Ereignisse der letzten Nacht wieder in den Sinn. Hatte ich das alles nur geträumt? Oder war es echt? Ich war unsicher. Aber es konnte doch nicht echt sein. Oder?
Ich nahm mir vor, heute wieder bis nachts zu bleiben.
Der restliche Tag wälzte sich ereignislos hin, bis es endlich Abend wurde. Ich hatte freiwillig angeboten, wieder im Keller aufzuräumen, und genau das tat ich bis Mitternacht. Rilisky war anfangs skeptisch wegen meines plötzlichen Eifers, aber nachdem er mich mehrmals kontrolliert hatte, schien er beruhigt. Irgendwie wirkte er, als wäre das sein Verdienst.
Wieder gegen Mitternacht fing die Oberfläche des Steins an, Wellen zu schlagen. So als würde er sich aus etwas Harzartigem ziehen, wand Oanarr sich aus dem Stein.
Schnaufend blickte er mich überrascht an.
„Wieder hier?“, fragte er und setzte sich zu mir auf eine alte Holzkiste, in der irgendetwas vor sich hin moderte. Ich reichte ihm ein Wurstbrot, das ich noch übrig hatte, und nickte.
„Hier, probier mal, du kommst ja nicht oft zum Essen“, sagte ich. Verdutzt blickte er das Brot an. Dann biss er hinein, so dass Krümel in seinen Bart fielen.
„Danke“, sagte er, „ich komme wirklich nicht oft dazu. Es ist so, dass ich durch den Fluch eigentlich nichts brauche, aber wenn ich nichts esse, bekomme ich trotzdem Hunger. Allerdings gewöhnt man sich daran, es gab jetzt eine Weile schon nichts mehr für mich.“
Eine Weile saßen wir schweigend da, bis Oanarr anfing mir Geschichten zu erzählen. Aus einer Zeit, als die Menschen hier noch in Stämmen gelebt hatten und die Elfen noch den Kontakt pflegten zu ihnen. Über sein Leben in der verborgenen Zwergenstadt Svartalfheim.
Am nächsten Tag fand ich wieder einen Grund, um Mitternacht im Keller zu sein, so dass wir uns erneut unterhalten konnten. Oanarr wirkte sehr überrascht, mich wieder zu sehen.
„Dachtest du nicht, dass ich wiederkommen würde?“, fragte ich ihn, als ich die Überraschung in seinem Gesicht sah.
„Nein, doch ich war nicht ganz sicher“, erklärt er.
„Soll ich dir wieder eine Geschichte aus alter Zeit erzählen?“, fragte er nach einem Moment der Stille. Ich nickte. Daraufhin erzählte er mir von harten Kämpfern und wie er einst gemeinsam mit anderen Zwergen und Menschen auszog, einen Drachen zu erschlagen. Wie sie dessen Knochen nach dessen Tod weiterverarbeiteten zu allerlei Gegenständen. Unter anderem zu einer kleinen Flöte, die Oanarr noch immer bei sich trug. Er zeigte mir sogar, wie man darauf spielen konnte. Sie hatte einen hohen, fröhlichen Klang.
Bald kam die Zeit, dass mein Praktikum sich dem Ende neigte.
„Mach dir keine Gedanken deswegen“, beruhigte Oanarr mich, als ich ihm erklärte, dass ich bald nicht mehr zu ihm kommen können würde.
„Wieso? Ich mag dich, du bist mir ein Freund geworden, ich will nicht, dass wir uns nicht mehr sehen“ erwiderte ich aufgebracht.
„Dies ist so oder so das letzte Mal, dass wir uns treffen“ sagte er. Er deutete auf die Rune im Felsen. Sie schien weniger tief eingeritzt zu sein, sie schien zu verblassen.
„Wieso? Was bedeutet das?“
„Ich bin frei“, sagte Oanarr. Er grinste schief.
„Frei?“
„Ich war verflucht, der Verräter am Stammesführer der Menschen wurde verflucht, solange zu leben, bis er Reue empfindet. Und die Freundschaft eines Menschen gewinnt“, erklärte Oanarr. Langsam schien er älter zu wirken. „Ich habe die Reue in meinen Herzen vor langer Zeit gefunden, doch wie sollte ich einen Menschen finden und seine Freundschaft gewinnen? Die meisten, die ich traf in den Jahren, hatten Angst. Bis auf dich. Du hast mich befreit“, erklärte Oanarr und reichte mir seine kleine Flöte.
„Aber...“, wollte ich ansetzen, doch in diesem Moment fing Oanarr an zu zerlaufen. So als würde er zu Sand. Oder Asche. Er schien nun um die Zeit zu altern, die er bereits lebte.
„Ich danke dir“, hörte ich Oanarr noch sagen. Alles geschah wie in Zeitlupe. Er, sowie alles was er bei sich trug, zerfiel zu feinem grauen Pulver.
Weg war er.
ENDE
Seelenloser Engel

|

|


Marius Geras alter Opel fühlte sich für ihn an wie ein Wüstenschiff, als er die von Schlaglöchern gepflasterte Straße entlangfuhr. In Gedanken ärgerte er sich zum hundertsten Mal, dass er sich auf sein Navi verlassen hatte und sich quer durch die Pampa hatte führen lassen. Inzwischen hatte er sich gnadenlos verfahren und wusste nicht im Geringsten, wo er war. Die Sonne begann schon tiefer zu stehen, denn es war bereits sieben Uhr.
Wunderbar, das wird peinlich, ging es ihm durch den Kopf, als er abbog zur einzigen Einfahrt des einzigen Hauses in Sicht. Es war ein älteres Haus, vermutlich ein in den 60er oder 70er Jahren renovierter Bauernhof. Es war niemand zu sehen, und die gepflasterte Einfahrt war leicht von Unkraut bewachsen.
Vertrauenserweckend...
Er hielt an und schaltete den Motor aus. Nach einem Blick auf sein Handy wusste er, dass er keine Alternative hatte. Dessen Akku war und blieb tot.
Kaum zwei Jahre alt und schon spinnt der Akku rum, so was nennt sich dann Qualität, dachte Marius, während er ausstieg und den Wagen abschloss.
Er ging zur Haustür und klopfte. Da nach dem ersten Klopfen niemand reagierte, versuchte er es energischer. Beim dritten Mal knackte etwas in der Tür, und sie öffnete sich. Scheinbar war ein Teil des Holzes morsch.
Verdammt, wohnt hier überhaupt noch jemand?
Marius strich sich eine Locke seines braunen Haares aus der Stirn und öffnete vorsichtig die Tür. Er war neugierig, ob das Haus wirklich leer stand.
Ich habe jahrelang Taekwondo gemacht, es ist hell, was soll mir schon passieren?, beruhigte er sich in Gedanken selbst.
„Hallo?“ rief er laut.
Niemand antwortete. Direkt hinter der Tür war ein kleiner küchenartiger Raum, in dem vermutlich auch gegessen wurde, denn es stand ein großer runder Tisch in der Mitte des Raumes. Darauf lag eine alte Kladde. Eine dünne Staubschicht lag auf dem leicht vermoderten Deckel. Der ganze Raum wirkte als hätte man ihn lange nicht benutzt.
Vorsichtig hob Marius die Kladde hoch und schlug sie auf. Als erstes war da ein einzelner Zettel auf dem stand:
Lieber Samuel, wenn du das hier liest, ist etwas schief gegangen. Ich habe heute versucht, mein Problem auf eigene Faust zu lösen. Ich denke nicht, dass dir wirklich klar ist, was mir so zu schaffen macht. Darum habe ich mir diese Kladde zugelegt, in das ich seit einer Weile hineinschreibe. Ihr vertraute ich mich an, wenn immer ich etwas hatte, was dich nicht belasten sollte. Es tut mir Leid, ich liebte dich bis zum letzten Atemzug.
Deine Katharina
Marius hob eine Augenbraue. Wilde Spekulationen gingen ihm durch den Kopf. Hatte sie Selbstmord begangen? Was war hier geschehen?
Er legte den Zettel zur Seite und betrachtete die erste vollgeschriebene Seite. Währenddessen sank langsam die Sonne tiefer und das Licht im Raum wurde schlechter. Er ging nach draußen und setzte sich in sein Auto.
Er begann zu lesen.
––––––––

15.5.1967
Liebes Tagebuch,
Alexa hat mir vorgeschlagen, dass ich ein Tagebuch anfange. Es würde mir gut tun. Also nun, versuche ich es. Mein Name ist Katharina, ich bin 22 Jahre alt. Oder eher 19. Ich bin vor drei Jahren nach einem bösen Sturz von der Treppe gestorben. Doch ich blieb nicht tot. Samuel, mein Geliebter, weigerte sich, meinen Tod zu akzeptieren. In seiner Verzweiflung machte er alles, was mich ihm zurückbringen könnte. Er erzählte mir, wie er es geschafft hatte. Er sagte, er habe ein Ritual durchgeführt, ein Opferritual, das er in einem der Zauberbücher seiner Urgroßmutter gefunden habe. Sie hat ihm nicht viel hinterlassen und war eine seltsame alte Frau, sagte er, er hat sie nur einmal getroffen, als er noch sehr klein war und seine Eltern noch in Ungarn lebten. Bevor sie hierher kamen.
Durch dieses Ritual hat er, so sagte er, den Teufel beschworen. Mit ihm hat er einen Pakt geschlossen, dass er mein Herz wieder schlagen lasse und das Leben wieder einkehre. Das tat es. Ich erwachte, in einem Sarg. Mein Liebster hatte mich bereits ausgegraben. So kehrte das Leben in mich zurück, es ist seltsam. Ich weiß nicht, wo ich war, als ich tot war, ich weiß nur noch, wie ich fiel. Irgendetwas fühlt sich komisch an, seit ich zurück bin. Kalt. Alexa, meine Schwester, sagt, das käme vielleicht daher, dass meine Seele sich daran gewöhnen müsse, wieder hier zu sein. Es wäre die Kälte des Totenreichs.
18.5.1967
Liebes Tagebuch,
das Leben ist wundervoll, Samuel ist für mich da wie noch nie zuvor. Er weicht nie von meiner Seite und strengt sich hart an, dass alles immer perfekt ist. Er strengt sich, finde ich, viel zu viel an. Aber eigentlich ist es auch süß von ihm. Er will immer noch nicht sagen, was seine Hälfte des Teufelspaktes war. Ich hoffe, nichts Schlimmes, wie das Erstgeborene oder etwas Derartiges.
12.6.1967
Liebes Tagebuch,
heute haben wir eine Reise begonnen. Wir übernachten in einem kleinen Dorf und werden morgen da sein, hat Samuel mir versprochen. Ich weiß immer noch nicht, wo es hingeht. Aber er meinte, es würde mich ablenken und wieder Leben spüren lassen. Ich bin sehr gespannt.
13.6.1967
Weimar, wir sind in Weimar.
Die Stadt pulsiert vor Leben, es ist faszinierend hier. Wir haben den ganzen Tag in Museen verbracht, es tut gut, unter Menschen zu sein. Samuel ist wundervoll, deswegen war er in letzter Zeit so lange arbeiten, um das hier mit Überstunden zu bezahlen.
4.7.1967
Irgendetwas stimmt nicht mit mir, ich spüre es deutlich. Umso mehr Zeit ich mit den anderen verbringe, merke ich, dass da eine Kälte in mir ist. Ich werde Samuel noch einmal wegen meines Verdachtes fragen. Es ist so abwegig und doch fürchte ich, dass es so böse ist, dass es wahr sein kann. Wer weiß schon, was der Teufel denkt?
9.7.1967
Ich hatte vielleicht Recht. Samuel hat mir erzählt, was er wörtlich erbeten habe. Dass Leben in meinen toten Körper zurückkehre. Kein Wort von meiner Seele. Ist es das? Das, was ich fühle? Ist meine Seele nicht hier, in meinem Körper, sondern noch immer im Totenreich? Ist es nicht so, dass der Pfarrer immer sagte, dass Seele und Körper zwei verschiedene Dinge sind?
Ich weiß nicht, was ich gegen diese Kälte tun soll in mir, sie wird immer stärker. Ich werde immer gleichgültiger den anderen gegenüber.
13.7.1967
Liebes Tagebuch,
ich habe einen Entschluss gefasst. Morgen, wenn Samuel nicht da ist, werde ich das Ritual wiederholen, das er mir beschrieben hat. Ich werde einen Pakt mit dem Teufel abschließen, dass ich meine Seele zurückbekomme. Ich will doch nur glücklich mit ihm werden. Ich werde es schaffen.
––––––––

ES KLOPFTE AN MARIUS Fenster und er hätte fast vor Schreck aufgeschrien, denn inzwischen war die Sonne fast untergegangen und er hatte niemanden bemerkt, während er las.
„Na, kann ich Ihnen helfen?“, fragte ein älteres Gesicht eines Mannes in den Sechzigern. Es war eingerahmt von dunklen Barthaaren, die bereits erste graue Anzeichen hatten.
„Ja, entschuldigen Sie, dass ich hier so ungebeten Ihr Grundstück betrete“, begann Marius und erklärte, dass er sich verfahren hatte.
„Kein Problem, ich kann Ihnen einen Straßenatlas zeigen, er ist nicht mehr der Neuste, aber ich denke mal, so viele Straßen sind nicht dazugekommen“, erwiderte der Mann und nickte zu einem kleineren Nebengebäude des Haupthauses.
Marius folgte ihm dorthin und fand sich in einer rustikalen, aber gemütlichen Küche wieder.
„Entschuldigen Sie, wie unhöflich von mir“, sagte er nun und reichte dem älteren Mann die Hand. „Marius Geras mein Name.“
„Samuel Stovok“, erwiderte der Alte und erwiderte den Handschlag.
„Samuel?“
„Ja, schon ein so schlechtes Gehör in so jungen Jahren? Weniger laute Musik würde ich da empfehlen“, erwiderte Samuel schmunzelnd.
„Entschuldigen Sie, aber als ich vorhin im Haupthaus klopfte, ging die Tür auf“, begann Marius, während Samuel ihm aus einem Regal einen schweren Straßenatlas von 1999 reichte.
„Kenn ich, die hält nie richtig zu“, erwiderte dieser.
„Und dabei fand ich ein kleines Büchlein“, beendete Marius den Satz.
Samuel erstarrte. „So?“
„Ich frage mich nun, ist es echt?“, fragte nun Marius das, was ihm die ganze Zeit durch den Kopf ging.
„Was?“
„Ihr Pakt mit dem Teufel.“
„Ja.“
„Was?“
„Ich habe einen, und er hat mich übers Ohr gehauen“, sagte Samuel und setzte sich auf einen alten knirschenden Holzstuhl.
„Wie das?“
„Ich bat ihn, den Körper meiner Angebeteten wieder zum Leben zu erwecken, und das tat er, doch er gab ihr nicht ihre Seele zurück, weswegen sie immer unzufriedener wurde. Deswegen hat sich mein wundervoller Engel das Leben genommen“, erklärte er.
Marius starrte ihn entgeistert an. „Ah ja, und wie rufen sie den Teufel?“, fragte er. Er war hin und hergerissen, ob er ihm glauben sollte, die Möglichkeit, dass der Teufel erschien, war ihm doch etwas zu fantastisch.
„Sie glauben mir nicht?“, fragte Samuel. „Ich beweise es Ihnen gerne.“
„Und wie?“
„Nicht weit von hier ist der Ort, wo ich ihn normalerweise rufe, keine 20 Meter entfernt.“
Er stand auf und ging zu seiner Haustür. „Kommen Sie mit, wenn Sie mir nicht glauben.“
„Gerne“, sagte Marius und gab seiner Neugierde nach. Sie gingen in eine alte Scheune. In ihr war der Boden schwarz wie Asche. Samuel entzündete mehrere Gaslaternen, die den Raum in ein schummriges Dämmerlicht tauchten.
Auf dem Boden waren Symbole mit Steinen gelegt. Alle zusammen waren in einem großen Pentagramm angeordnet.
„Eine gute Kulisse für einen Horrorfilm, doch wirklich“, sagte Marius, um seine Nervosität zu überspielen. Er fragte sich, was er hier machte, ob er bescheuert wäre. Doch er wollte sehen, ob der Alte die Wahrheit sagte.
„Komm, komm in den Kreis“, sagte Samuel und begann etwas auf Latein zu sagen. Marius hatte in der Schule Latein recht schnell wieder abgewählt, so dass er nicht ein einziges Wort dessen verstand, was Samuel sprach. Doch es schien wohl eine Beschwörungsformel zu sein. Es schien wärmer im Raum zu werden. Marius trat einen Schritt zurück, aus dem Kreis.
Das bilde ich mir doch nur ein, dachte Marius.
Dann geschah es. Die Steine schienen von innen heraus zu glühen. Sie leuchteten kurz blenden hell auf, so dass Marius eine Hand vor die Augen halten musste. Zwischen seinen Fingern hindurch glaubte er ein zwei Meter großes Wesen zu sehen, mit Hörnern und einer dämonischen Fratze. Als das Licht verschwunden war, stand dort ein Mann, Ende 30 mit den ersten grauen Strähnen im schütteren Haar. Er trug einen Anzug.
„Ah, Samuel, es ist lange her,“ sagte dieser.
„Hier, die letzte Schuld ist beglichen“, erklärte dieser.
„Dieser dort? Er ist die letzte der 99 Seelen, die du mir für das zweite Leben deiner Geliebten schuldest. Mein Beileid noch einmal, für ihre Entscheidung. Aber naja, Frauen, was soll man machen?“, sagte dieser gut gelaunt und trat einen Schritt auf Marius zu. Dieser drehte sich um und rannte.
„Du Narr, er ist nicht im Bannkreis“, rief der Mann im Anzug, doch Marius war schon draußen. In wenigen, weiten Schritten erreichte er seinen Wagen und startete den Motor. Er drückte das Gas voll durch und fuhr mit quietschenden Reifen davon.
––––––––

„NUN, ICH DENKE, DIE eine Seele, die du mir schuldest, das können wir auch anders verrechnen“, sagte der Mann im Anzug.
„Was, wie?“
„Deine.“
„Nein, ich will zu ihr, sie...“
„Glaubst du wirklich, ich würde dich gehen lassen?“
ENDE
Morgen gehen wir sterben....

|

|


8.April 1945
Königsberg
Ostpreußen
Ludwig Buchner duckte sich in den Graben und schloss die Augen. Um ihn herum donnerte es. Granaten explodierten nicht weit von ihm. Als er die Augen kurz öffnete, sah er einen Soldaten nicht weit seiner Deckung laufen. Anton. Ludwig erinnerte sich an seinen Vornamen. Dann schlug eine Granate direkt vor Anton ein und zerfetzte ihn. Wieso passiert das? Wieso lässt Gott all dieses Unglück zu? Ludwig zuckte weg und schluchzte. Er weinte bereits seit einer Weile, weil ihm der beißende Qualm in den Augen brannte.
Es donnerte erneut. „Vorwärts, gebt ihnen keinen Meter“, rief jemand. Ludwig wollte aufspringen. Er wollte kämpfen. Doch etwas in ihm konnte nicht mehr.
––––––––

„BUCHNER, RICHTIG?“, fragte eine Männerstimme. Ludwig schreckte aus seinem unruhigen Traum auf. Einen Moment lang glaubte er, sich alles eingebildet zu haben. Den Krieg. Die Toten. Das Blut. Das Leid. Dann fiel sein Blick auf die Ruine hinter dem Mann, der ihn angesprochen hatte. Irgendwo im zerbombten Königsberg stieg noch Rauch auf. Vielleicht ein Feuer, das bisher übersehen worden war.
„Sie sollen in die Wagengasse. Wache schieben mit einem. Ich glaube einem Offizier, ‚von der Mark‘ oder so“, erklärte ihm der andere. Er war kaum älter als Ludwig, nicht einmal Mitte Zwanzig.
„Jawohl“, erwiderte Ludwig mechanisch.
„Ablösung kommt, wenn ich sie finden kann“, erklärte der Mann. Ludwig nickte nur müde.
––––––––

LUDWIG FUHR SICH DURCH sein kurzgeschorenes schwarzes Haar und setzte seine Mütze wieder auf. Er betrat das Haus vor ihm. Genau genommen betrat er den Rest eines Hauses. Die Decke war eingestürzt und nur noch die Mauern standen. In der Mitte saßen an einem kleinen Feuer zwei Männer.
„Wer da?“, fuhr der eine hoch. Er hob sein Gewehr blitzschnell und zielte auf Ludwig. Als er die vertraute Uniform sah, entspannte er sich etwas.
„Name?“, fragte er.
„Leutnant Buchner, Ludwig“, erwiderte Ludwig automatisch. Er setzte sich zu den beiden ans Feuer. Er trug eine abgewetzte und dreckbeschmierte Uniform, genau wie der Mann, der auf ihn gezielt hatte. Dieser entspannte sich etwas.
„Hauptmann Ansgar von der Mark“, erwiderte dieser nun. Ludwigs Blick wanderte zum Kragen des Soldaten. Er wollte salutieren, doch Ansgar winkte ab.
„Heute Abend will ich hier keinen Salut sehen“, sagte Ansgar entschieden. „Hinterher knallt mich einer ab, weil Sie ihm zeigen, dass ich Offizier bin.“
„Und Sie sind?“, fragte Ludwig den anderen Mann. Ein Zivilist, das war leicht an seiner bunten Mischung aus Kleidung zu erkennen. Und er war unbewaffnet.
„Jonathan Jakobs, Pastor“, erklärte dieser und reichte Ludwig die Hand. „Kannst du sagen“, fügte er hinzu. Ludwig sah, dass der andere mehr als doppelt so alt wie er selbst sein musste. Ludwig selbst war gerade einmal 23 Jahre alt und vor wenigen Monaten erst an die Front geschickt worden. Seitdem war er in Ostpreußen unterwegs gewesen. Vor kurzem war der Befehl gekommen, Königsberg um jeden Preis zu halten. Gestern erst war wieder ein blutiger Tag gewesen.
„Der Tod hält reiche Ernte“, sagte Ansgar, als hätte er Ludwigs Gedanken gehört.
„Es ist immer schon so gewesen. Nur der Tod kann hier noch gewinnen“, fügte Ansgar hinzu.
Ludwig schüttelte den Kopf. „Wir bekommen Verstärkung, mir wurde gesagt, es ist bereits welche auf dem Weg.“
„Genauso wie gestern, Junge. Heute haben sie das Kapitulationsangebot der Russen abgelehnt. Sie werden uns zerfleischen“, sagte Ansgar. Er sah deprimiert in die Flammen.
„Eine Frage brennt schon seit einer Weile in mir, Herr Pastor. Darf ich?“ Ludwig sah in die Flammen, als er dies sagte. Jonathan blickte auf und nickte.
„Gerne.“ Das Feuer knackte munter vor sich hin. In der Ferne waren Geräusche zu hören.
„Wie kann Gott das zulassen?“, fragte Ludwig nach einer Weile, die sie stumm am Feuer saßen. Er sah dabei Jonathan direkt an.
„Ist er denn nicht gütig?“
Ansgar lachte. Es war ein kaltes, freudloses Lachen.
„Die Frage eines Kindes. Sieh dich um Junge, hier ist kein Gott. Sie haben dich im Konfirmandenunterricht angelogen! Vielleicht war hier nie einer. Wenn hier einer war, hat er die Stadt verlassen, genau wie alle die, die Verstand besaßen.“ Bei den letzten Worten sah er Jonathan an. Der Pfarrer lächelte ihn freundlich an. Das schien Ansgar nur noch missmutiger zu machen.
„Es ist nicht so einfach“, setzte der Pfarrer an. „Gott ist nicht einfach böse oder gut, nur weil es dir gerade mal schlecht geht.“
„Mal schlecht geht? Mal schlecht geht?“, knurrte Ansgar.
„Aber der Krieg ist doch schlecht, oder nicht? Wieso lässt er die Russen unseren Leuten das alles antun?“, fuhr ihm Ludwig dazwischen.
Immer noch lächelte der Pfarrer, auch wenn es ein trauriges Lächeln war.
„Wer hat den Krieg denn angefangen? War das Gott?“
„Nein“, musste ihm Ludwig zustimmen. „Das waren wir. Aber er hat ihn zugelassen.“
„Er gab dir einen freien Willen. Du hast dich entschieden“, erwiderte der Pastor ruhig.
„Wahl? Welche Wahl hatten wir denn?“ Ansgar sah wütend in die Flammen. „Da war keine Wahl.“
„So trivial es klingt, doch“, erwiderte Jonathan. „Ihr hättet alle ‚nein‘ sagen können. Denkt ihr, ein Krieg beginnt, wenn sich alle hinsetzen und sagen: Nein, ich mach nicht mit?“
„Aber die Front ist zusammengebrochen. Sie drängen uns zurück. Wir haben Befehl die Stadt zu halten. Wir haben doch Befehel, sie zu Verteidigen.“ Ludwig sah etwas hilfesuchend zu Ansgar.
Jonathan schüttelte langsam den Kopf. „Verteidigen, ja? Wieso mussten wir uns denn fern unserer Grenzen verteidigen? Deutschland hat angegriffen. Fühlten wir uns Bedroht? Einer Bedrohung begegnet man nicht, indem man den anderen bedroht. Du wirst angegriffen? Wehr dich, doch werde nicht selbst zum Angreifer.“
„Also sollen wir uns doch nicht auf die andere Wange schlagen lassen?“, fragte Ansgar und lächelte böse.
Jonathan nickte.
„Es geht bei diesem oft zitierten Wort, denke ich, nicht darum, sich verprügeln zu lassen. Es geht darum, nicht Wut mit Wut, Schlag mit Schlag zu begegnen. Wenn du einen Angreifer entwaffnet hast, nimm die Waffe, mach sie kaputt und lass es dabei bewenden. Benutze sie nicht noch gegen den Angreifer.“
„Dann sag das mal dem Russen“. Ansgar spuckte ins Feuer. „Die werden uns bluten lassen, genauso wie wir sie haben bluten lassen.“