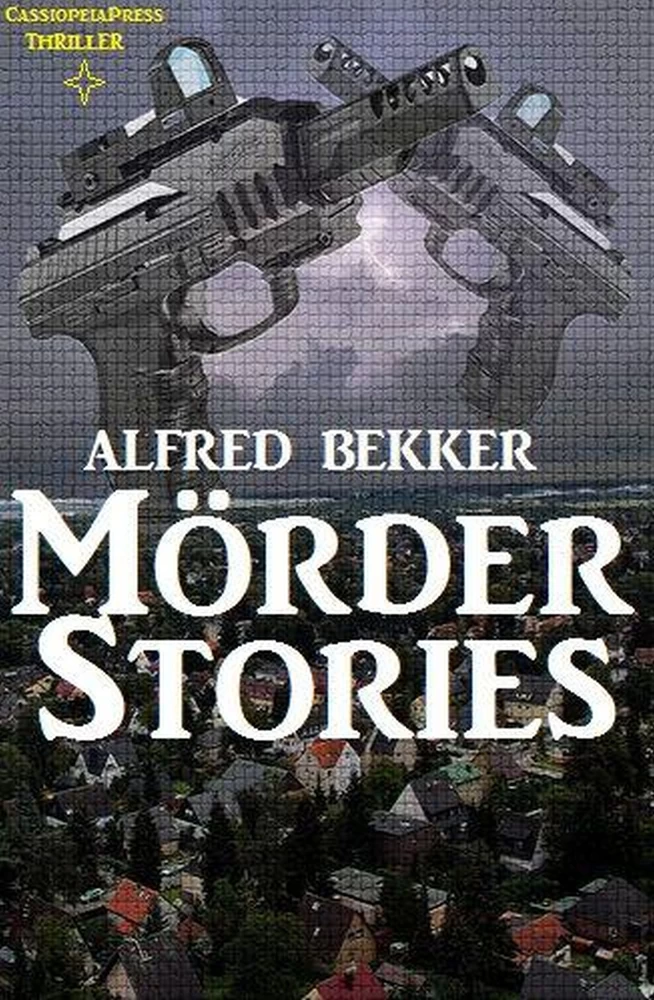Zusammenfassung
Neun Erzählungen des bekannten Autors mit einem gemeinsamen Thema: Mörder!
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Mörder-Stories
Published by Alfred Bekker, 2018.
Mörder-Stories


Alfred Bekker | Mörder-Stories

|

|

Alfred Bekker
Mörder-Stories

Mit Illustrationen von A.Bekker
© by Alfred Bekker
www.AlfredBekker.de
www.Postmaster@AlfredBekker.de
All rights reserved
Ein CassiopeiaPress Ebook
Ausgabejahr dieser Edition: 2017
Alfred Bekker | Mörder-Stories | Inhalt

|

|

Alfred Bekker
Mörder-Stories
Inhalt

Hinter dem Mond
Zweisam in Sonsbeck
Treffpunkt Hölle (mit W.A.Hary)
Der Herr des Schwarzen Todes
Passauer Mords-Dessert (mit Rupert Bauer)
Eis in den Bergen
Langes Leben, schneller Tod
Das Böse regiert

Alfred Bekker: | Hinter dem Mond

|

|

Alfred Bekker:
Hinter dem Mond

Eine laue Julinacht Anno 1969.
Da ist ein Raumschiff.
Da ist ein blutiges Messer.
Und da ist ein Junge, der tot im Gras liegt.
Das alles ist in der Erinnerung untrennbar miteinander verbunden.
Aber alles der Reihe nach.
Im Jahr 1864 steht Friedrich Wilhelm Kötter aus Ladbergen im Münsterland an Deck eines Schiffs, das gerade in den New Yorker Hafen einläuft, und blickt seinem neuen Leben entgegen.
Der Mond geht auf und Kötter kann in diesem Augenblick nicht ahnen, dass man ein Jahrhundert später den Mond vor lauter Lichtern in der Stadt, die niemals schläft, gar nicht mehr zu sehen vermag.
Noch weniger kann er ahnen, dass 1969 ein Mensch den Mond betreten wird. Und d
ass es ausgerechnet sein Urenkel sein wird, der diesen großen Schritt für die Menschheit vollbringt, hätte er sich wohl nicht einmal im Traum vorzustellen vermocht.
»Das ist Amerika!«, ruft einer der anderen zerlumpten Auswanderer Kötter zu und klopft ihm auf die Schulter. »Sieh es dir an! Hier ist alles möglich.«
Aber Kötter macht eine wegwerfende Handbewegung.
»Bauer bleibt Bauer«, meint er, »auch hier.«
Ein Jahrhundert später.
Am 21. Juli 1969 ist keine Nacht wie andere Nächte. Überall sitzen die Menschen an den Fernsehern, sehen auf ein paar verwackelte Schwarzweißbilder und auf die klugen Gesichter von Raumfahrtexperten, die erläutern, was dort gerade zu sehen ist, und herumorakeln, wie lange es wohl noch dauern wird, bis der Adler endlich gelandet ist und Neil Armstrongs Fuß seinen Abdruck in den Mondstaub geprägt hat.
Überall haben weltraumbegeisterte Kinder und Jugendliche ihren Eltern die Erlaubnis abgetrotzt, diesen größten Moment der Menschheitsgeschichte live mitzuerleben, und versuchen nun verzweifelt, ihr Gähnen zu unterdrücken und nicht einzuschlafen, bevor der große Augenblick gekommen ist.
Fast überall. D
a gibt es nämlich ein kleines Dorf im Münsterland, das diesem Zwang zur kollektiven, andachtsvollen Menschheitsverbrüderung widersteht. Ein Dorf, das zum Mantel der Geschichte sagt: Weh mir aus den Augen und streife mich ja nicht! Ein Dorf, dessen größter Spross gerade diese unglaubliche Tat vollendet und das dabei der Versuchung widersteht hinzuschauen.
Denn als Neil Armstrong, der Urenkel jenes Friedrich Wilhelm Kötter aus Ladbergen, sich gerade bei seinem berühmten Satz, in dem er von einem kleinen Schritt für einen Menschen, aber einem Riesenschritt für die Menschheit spricht, verhaspelt, ist in der Bauernschaft Ladbergen-Wester Schützenfest. Und wer käme schon auf die Idee, das wichtigste Ereignis des Jahres zu verschieben. Selbst das Ereignis des Jahrhunderts – ja, des Jahrtausends! – wird daran nichts ändern.
In Ladbergen-Wester sitzt niemand vor dem Fernseher.
Fast niemand. Ein sechsjähriger Junge sieht fern. Er hat sich den Wecker gestellt, der ihn alle zehn Minuten aufschrecken lässt, damit er nur ja nicht einschläft. Er gähnt und sieht auf den Fernsehschirm, wo ein Mann im kobaltblauen Anzug mit wichtiger Miene sagt: »Wir bekommen jetzt gerade Neuigkeiten aus Houston.«
Er heißt Ralf und seine Eltern sind nicht zu Hause. Sie sitzen zusammen mit dem Rest der erwachsenen Dorfbevölkerung im Festzelt. Und die anderen Kinder schlafen. Manche vor Erschöpfung, weil sie vorher soviel Unsinn gemacht haben und herumgetobt sind.
Heute war schließlich niemand da, um es zu verbieten.
Vielleicht hat auch von denen der eine oder andere davon geträumt, sich die Mondlandung anzusehen, wenn er schon nicht mit ins Festzelt zum Biertrinken darf. Aber Ralf ist wohl der einzige, der es geschafft hat, dies auch in die Tat umzusetzen.
Er ist das Ganze sehr planvoll angegangen. Er hat sich darüber informiert, wann mit der Landung zu rechnen wäre, hat vorher etwas geschlafen und sich dann den Wecker gestellt, damit er pünktlich aufwacht. Schließlich wollte er nicht das Risiko eingehen, alles zu verpassen.
Auf dem Boden verstreut liegen ein halbes Dutzend Bücher über die Raumfahrt, über die Planeten und über ferne Sterne. Da steht alles drin, was man bisher darüber weiß.
Das ist nicht sehr viel.
Ralf ist erst sechs, aber er kann besser lesen als manch einer aus dem vierten Schuljahr, von denen einige noch ziemlich herumstottern, wenn sie ein Stück vorlesen sollen, das sie vorher nicht geübt haben.
Die vier Tage Reise zum Mond, die Umkreisungen des Orbiters, das Ausklinken der Landefähre und schließlich das Aufsetzen auf der Mondoberfläche – Ralf kennt jeden einzelnen Schritt auf dem Weg dorthin. Er hat die Berichte über die vorhergehenden Apollo-Missionen, die alle nur bis in die Umlaufbahn des Mondes kamen, verfolgt, und er hat keine der Sendungen von Professor Heinz Haber verpasst.
Ralf hat nicht alles verstanden, was dort erklärt wurde. Aber das, was er nicht verstanden hat, hat er in den Büchern nachgeschlagen und nun fast alles begriffen.
Er hat sich das Lesen selbst beigebracht und ist deshalb ein Jahr früher in die Schule gekommen.
Wäre doch gelacht, wenn es da etwas geben sollte, was er nicht herausfinden könnte.
Seine Neugier ist so grenzenlos wie das Universum selbst.
Ralf sieht auf die Uhr.
Eigentlich hat sein Freund Andreas angekündigt, in der Nacht zu ihm zu kommen, damit sie gemeinsam die Mondlandung erleben könnten.
Andreas wohnt ein Haus weiter – gut hundert Meter entfernt –und seine Eltern würden es nicht merken, wenn er das Haus verließe.
Schließlich sind sie bis zum frühen Morgen ebenso im Festzelt beschäftigt wie Ralfs Eltern.
Andreas ist ein Jahr älter als Ralf, aber trotzdem hatte der immer schon den Eindruck, dass er nicht ganz so helle ist. Man musste ihm manchmal die Dinge dreimal erklären, wenn man sicher sein wollte, dass er sie auch richtig begriff.
Deshalb hat sich Ralf auch große Mühe gegeben, ihm eindringlich klarzumachen, wie er den Wecker zu stellen habe, damit er pünktlich aufwache.
Offenbar vergeblich.
Andreas müsste längst hier sein, geht es Ralf ärgerlich durch den Kopf,
dieser Dussel!
»Hey, bist du jetzt mein Lehrer oder was?«, hatte ihn Andreas noch angefahren, als Ralf seine Kontrollfragen stellte, um herauszufinden, ob sein Freund tatsächlich begriffen hatte, was zu tun war. »Du brauchst nicht zu denken, dass ich doof bin. Nur, weil sie dich früher eingeschult haben, brauchst du dir noch längst nix einzubilden!«
Auch wenn Andreas nicht der Hellste war – Ralf fand es doch angenehm, ihn um sich zu haben.
Dann hatte er jemanden, dem er von seinen Ideen erzählen konnte.
Jemanden, der ihm fasziniert zuhörte, wenn er davon sprach, wie eine Mondfähre aufgebaut war, wie der Orbiter funktionierte, wie stark die Rakete sein musste, die all das aus der Anziehungskraft der Erde herauskatapultierte und so zielgenau in den Weltraum hineinschleuderte, dass es den Mond erreichte.
Über dreihunderttausend Kilometer.
Eine Zahl, die sich nicht mal Ralf vorstellen kann.
Andreas kann fehlerfrei bis 22 zählen. Ralf hat es immerhin schon mal geschafft, einfach so und aus Spaß, die Zahlen bis 1000
aufzuschreiben, ohne eine zu vergessen.
Aber 300 000 – das ist einfach nur ein magischer Begriff.
Ein Kilometer – da weiß er ziemlich genau, wie viel das ist. Einen Kilometer muss man laufen, um ins Dorf zu kommen und im Kiosk von Oma Oelrich ein Bessy-Heft zu kaufen.
Genau tausend Schritte. Ralf hat es abgezählt.
Und hundert Schritte sind es bis zum Haus von Andreas‘ Eltern.
Wenn er den Wecker richtig gestellt hätte, wäre er aufgewacht und hergekommen, denkt Ralf.
Er sieht die verwackelten Schwarzweißbilder der Landefähre EAGLE, sieht die Umrisse von Neil Armstrong. Das ist er also. Der zweite große Moment. Der Adler ist gelandet und jetzt ist Armstrong ausgestiegen und der erste Mensch betritt den Mond.
Mit so einer Fähre möchte ich mal fliegen, denkt Ralf. Wenigstens einmal.
Nach dieser Nacht wird er das nie wieder denken.
Einige Augenblicke lang versinkt er in seinem Traum von einer Zukunft als Astronaut. Den ersten Mann auf dem Mond gibt es ja nun schon, aber da draußen sind noch viele Planeten. Warum sollte er nicht der erste Mann auf dem Mars werden?
Dass Neil Armstrongs Vorfahren aus Ladbergen stammen, darüber haben sie in der Schule geredet. Was ein Ladberger geschafft hat, könnte doch auch einem zweiten gelingen, denkt Ralf.
Er hört einen Schrei und fährt zusammen.
Ein Schrei so hell und schrill – eine Kinderstimme!
Ralf sitzt da und kann sich nicht bewegen, denn obwohl sie so verzerrt klang, hat er die Stimme sofort erkannt. Andreas!
Ein Geräusch lässt ihn sich zum Fenster drehen. Auf dem Fernseher hat man jetzt gerade wieder zurück ins Studio geschaltet und ein Experte sagt ein paar kluge und salbungsvolle Worte über die Zukunft der Menschheit und den Blick von einem anderem Himmelskörper auf die ferne Erde, der uns allen bewusst machen könnte, wie verwundbar wir doch sind. Die Erde als verletzliche Insel des Lebens im All. Ralf hört nicht zu. Er geht zum Fenster.
Ist Andreas vielleicht in einen Kuhfladen getreten? Hat er deshalb so geschrien? Memme!
Er nimmt seine Taschenlampe, die er letztes Weihnachten bekommen hat und die seitdem fast ständig seine Hosentasche ausbeult.
Ralf öffnet das Fenster.
Ein kühler Hauch kommt herein. Und zusammen mit diesem Hauch auch ein wimmernder Laut. Da ist irgendetwas geschehen.
Irgendetwas Schlimmes.
Ralf sieht noch mal zum Fernseher. Immer noch Studio. Nicht Houston. Nicht der Mond. Kein Armstrong, keine EAGLE.
»Andreas?«, ruft Ralf.
Aber da gibt es keine Antwort. Das Wimmern ist verstummt.
Ralf steigt nach draußen. Er läuft ein paar Schritte. Der aufkommende Wind biegt die Bäume und lässt sie rascheln.
»Wo bist du denn, du Blödmann?«
Er lässt den Strahl seiner Taschenlampe suchend durchs Dunkel wandern.
Und dann sieht er ihn. Andreas liegt im Gras.
Er sieht das Blut.
Viel Blut.
Und in den starren Augen spiegelt sich das Mondlicht. Der Mund steht offen – wie gefroren im Schreck.
Da liegt auch ein Messer.
Die Klinge blitzt auf.
Zumindest dort, wo sie nicht mit Blut beschmiert ist.
Dann knackt ein Ast. Ralf lässt den Lichtkegel herumfahren. Eine Gestalt schält sich aus der Dunkelheit heraus.
Ein Mann.
Er hebt den Arm vor das Gesicht, denn die Lampe blendet ihn. Ralf sieht nur die Hand und die Stirn und die hakenförmige Narbe.
Und das Blut an seinem Hemd und dem Ärmel.
Der Mann dreht sich um, stolpert davon. Er geht ganz seltsam. Mit seinem Bein stimmt was nicht.
Ralf hat schon mal jemanden gesehen, der sich so bewegte. Das war im Urlaub am Strand.
Der Mann lief vor ihm her. Ralf starrte die ganze Zeit sein Bein an, bis er bei einer Sandburg stehenblieb, zum Schenkel griff, das Bein abschnallte und in den Sand steckte.
»Das kommt vom Krieg«, hatte ihm sein Vater später erklärt.
Dieser Mann geht genauso. Er hat ein Holzbein.
Aber schon einen Moment später sieht Ralf ihn nicht mehr. Er ist einfach verschwunden, so als hätte es ihn nie gegeben – und Andreas liegt da, wie eine starre Puppe, so als hätte er nie gelebt.
Anno 2009.
Vierzig Jahre später.
Der Fernseher läuft. Die alten Bilder werden noch einmal gezeigt.
Immer wieder aufs Neue. Die Landung von Apollo 11 – in einigen Programmen sogar die Originalübertragung in voller Länge.
Ralf sieht den Adler landen.
Und sitzt wie erstarrt da. Denkt plötzlich an das Blut, das Messer, den toten Andreas und den Mann in der Dunkelheit.
»Wolltest du nicht auch immer Astronaut werden?«, fragt die demente Achtzigjährige im Rollstuhl, die ab und zu noch mal einen hellen Moment hat, ansonsten mit Ralfs Mutter aber nur den Name gemein zu haben scheint.
Ralf antwortet nicht.
»Komisch, du hast dich so sehr dafür interessiert, das weiß ich noch genau. Aber das hatte sich dann ganz plötzlich erledigt ...«»Ja«, murmelt er. »Das hatte es.«»Schade, dass du so weit weg wohnst.«
Nein, denkt er. Das ist gut so.
»Ich hoffe, man sorgt hier in diesem Altenheim gut für dich«, sagt er.
Sie beugt sich vor. »Ich habe da einen Herrn kennengelernt. Der ist nett.«»Ah, ja ...«»Hat aber genauso wenig Haare wie dein Vater früher.«
Zweiundfünfzig ist Ralfs Vater nur geworden. Verkehrsunfall, Kreuzung Lengericher Straße/Saerbecker Straße. So etwas nannte man wohl Schicksal.
––––––––

EINE DORFKNEIPE.
Ralf ist wegen eines Klassentreffens nach Ladbergen gekommen.
Und jetzt sitzen sie beim Bier – alle die, die damals das Lesen lernten, als Neil Armstrong zum Mond flog.
»Aber der Ralf, der konnte dat schon!«, sagt einer. »Obwohl er der Jüngste war.«
»Hatte ich mir selbst beigebracht«, sagt er.
»Du wolltest doch damals immer schon was Besonderes werden.
Astronaut, glaube ich, oder? So wie unser größter Ladberger, hier, wie heißt er noch – Nils Armstrong.«
Neil – nicht Nils, will Ralf ihn korrigieren, aber er behält die Worte für sich. Was soll‘s?
»Naja, aber Professor für Chemie ist ja auch nix Schlechtes oder?
Nicht gerade so was wie eine Reise zu den Sternen, aber ich schätze mal, das liegt ja auch daran, dass die mit den Astronautenprogrammen damals erstmal eine Pause eingelegt hatten, wenn ich das richtig sehe ...«»Ist damals nicht der Andreas umgekommen?«, fragt eine Frau. Jetzt ist sie dünn und hager wie ein Hering. Damals, hat Ralf noch gut in Erinnerung, konnte sie kaum aus den Augen sehen, wenn sie lachte, so dick waren ihre Wangen. Wie die meisten, die am Tisch sitzen, ist sie nie aus Ladbergen herausgekommen. Anders als Ralf.
Ilona heißt sie. Die dicke Ilona, denn es gab auch noch eine andere, die dünn war. Zu Ralfs Verwirrung ist allerdings in den letzten vierzig Jahren die dünne Ilona dick geworden und die dicke dünn.
»Ja, richtig der Andreas«, sagt jemand anderes. »Ralfi, das war doch dein bester Freund, oder?«»Ja«, murmelt Ralf. Er hört den Stimmen der anderen zu, ihrem Wortschwall aus Erinnerungen und Halbwahrheiten. Das gesammelte Dorfgerede eben, abgeschliffen und in seinem wahren Kern etwas verfälscht durch die Zeit.
»Ich meine, die Polizei, die hat ja damals nicht so richtig herausfinden können, wer das nun eigentlich gewesen ist.«»Ja, aber es gab in den nächsten Jahren noch drei weitere Kinder, die hier in der Gegend umgebracht wurden.«»Ich meine, so 'n Wort wie Kinderschänder, da hat man ja damals nur hinter vorgehaltener Hand von gesprochen.«»Ich weiß noch, dass wir einige Zeit kaum raus durften und unsere Eltern uns überall hingebracht haben.«»Ja, das hat sich dann aber bald auch gelegt. Ich meine, du kannst Kinder doch nicht rund um die Uhr überwachen!«»Hat sich das nicht in der Nacht des Schützenfestes abgespielt?«»Die Nacht des Schützenfestes! Das war doch die Nacht der Mondlandung«, sagt jemand. »Allerdings muss ich zugeben, dass mir das auch jetzt erst aufgefallen ist, weil alle Leute über das Jubiläum von Nils Armstrong sprechen.«
Wieder Nils, denkt Ralf, weil ihn das etwas ablenkt. Eigentlich will er nichts mehr davon hören. Seit er Andreas gefunden hat, ist sein Interesse an Raumschiffen wie weggeblasen. Und wenn jemand das Wort »Apollo« ausspricht oder »Armstrong« oder »EAGLE« oder
»Orbiter«, dann kann es sein, dass er Schweißperlen auf die Stirn bekommt. Immer noch. Wahrscheinlich würde das auch nicht mehr aufhören. Nur ganz dunkel erinnert sich Ralf daran, wie er später vom Dorfpolizisten befragt wurde und noch später von einem Kriminalhauptkommissar und danach von einem Mann, von dem er bis heute nicht weiß, wer das war, aber der immer sehr verständnisvoll nickte, wenn er einen Satz beendete.
Die Zeit unmittelbar nach dieser Nacht erscheint Ralf im Rückblick wie ein verworrener Alptraum. Und manchmal hat er das Gefühl, bis heute nicht wirklich daraus aufgewacht zu sein.
»Echt, dat muss ein Auswärtiger damals gewesen sein«, hört er jemanden sagen.
»Ja, und warum sind dann noch weitere Kinder umgekommen?«, fragt jemand anderes und stört damit den lokalpatriotischen Grundkonsens am Tisch.
»Ja, aber kannst du dir denn vorstellen, dass jemand, der mit unseren Eltern zusammen im Festzelt gesessen und Bier gesoffen hat, so was tun würde? Jemand hier aus der Gegend?«»Vielleicht sogar jemand, der mit Neil Armstrong verwandt ist«, sagt Ilona. Diesmal die dünne, die jetzt dick ist. Einen Augenblick herrscht Schweigen, diese Bemerkung findet jeder unpassend. »Ich mein ja nur«, sagt sie.
Ihre Namensvetterin erlöst die Runde aus ihrer bedrückenden Stille.
»Fährst du morgen noch mal deine Mutter besuchen, Ralf?«»Ja.«»Meine ist auch im Haus Widum in Lengerich. Wir sind zufrieden. Also – sie und ich.«»Verstehe.«»Wann fährst du?«»Weiß noch nicht.«»Kannst du mich mitnehmen? Unser Wagen ist nämlich kaputt, aber wenn ich ihr zu erklären versuche, dass ich deswegen nicht zu ihr kommen kann, versteht sie das nicht.«»In Ordnung«, sagt Ralf.
Ralf sitzt mit seiner Mutter im Tagesraum des Seniorenheims in Lengerich – zehn Kilometer von Ladbergen entfernt. Aber für Mutter ist das Ausland. Schon das Platt, das man hier spricht, unterscheidet sich hörbar vom Ladberger Platt. Wie soll man sich da wohlfühlen?
Darum hat sie sich lange gesträubt, hierher zu ziehen. Aber schließlich war es unumgänglich gewesen.
»Ich hatte ja immer gehofft, dass du mal unseren Hof übernimmst«, sagt sie. »Aber das ist ja alles anders gekommen. Weißt du, was der Onkel Friedhelm gesagt hat: Selbst schuld, wenn du das Kind zuerst ein Jahr früher zur Schule lässt und dann auch noch aufs Gymnasium schickst. Selbst Schuld!«
Ralf hat seit ein paar Jahren einen Lehrstuhl für Chemie in Zürich.
Zuvor war er in New York, Sydney, Tokio und Delhi. Mal in der universitären Forschung und mal als Mitarbeiter an einem Forschungsprojekt in der Industrie.
»Hauptsache weit weg, was?«
Das muss einer von Mutters lichten Momenten sein.
Sie sieht ihn an.
»So kann man das nicht sagen«, meint er.
»Nee?« Sie runzelt die Stirn. »Du bist doch der Ralf, oder?«»Ja, der bin ich.«
Die Tür geht automatisch und rollatorengerecht zur Seite auf, aber der Mann der jetzt hereingefahren wird, sitzt im Rollstuhl. Er blickt starr drein. Aber Mutters Blick hellt sich auf, als sie ihn sieht.
»Das ist der Herr, der so nett ist«, sagt sie. »Er hört mir zu.«»Ah, ja
...«, murmelt Ralf.
Die Altenpflegerin fährt den Rollstuhl an den Tisch.
Der Mann lässt durch nichts erkennen, dass er Mutter überhaupt bemerkt hat. Er interessiert sich mehr für den Kuchen, der an seinem Platz steht, den er aber nicht ohne Hilfe essen kann.
Die Altenpflegerin will ihn etwas näher an den Tisch fahren, aber die Rollen des Stuhls treffen auf einen Widerstand. Der linke Fuß ist vom Tritt gerutscht.
»Oh, tut mir leid«, sagt die Altenpflegerin. Sie ist noch jung. Eine neue. Und wohl auch etwas ungeschickt.
»Das macht nichts«, sagt Mutter. »Links ist alles aus Holz bei ihm!«
Ralf erstarrt, als er die hakenförmige Narbe auf der Stirn des Mannes sieht.
Das ist er!, wird ihm klar und ein eisiger Schauder überläuft seinen Rücken. Wie oft hat er in die Gesichter gestarrt, immer wenn er Menschen begegnete, die im passenden Alter waren, hinkten und eine Narbe am Kopf aufwiesen. Aber in diesem Moment gibt es keinerlei Zweifel.
»Ist er nicht nett?«, hört er Mutter sagen. »Ich weiß nur seinen Namen gerade nicht.«

Alfred Bekker | ZWEISAM IN SONSBECK

|

|

Alfred Bekker
ZWEISAM IN SONSBECK

Die Stimmen.
Sie hören nicht auf.
Ich dachte, ich könnte sie zum Schweigen bringen, aber das war wohl ein Irrtum. Eine gewisse Traurigkeit überkommt mich. Ein Gefühl der Vergeblichkeit.
Zu Hause ist es manchmal ziemlich einsam.
Wenn ich niemanden habe, mit dem ich reden kann, höre ich die Stimmen.
Also muss ich immer dafür sorgen, dass ich nicht allein bin.
Es war an einem heißen Juli-Nachmittag, als die St. Gerebernus-Prozession durch Sonsbeck zog.
Letztes Jahr.
Der Musikverein Harmonie 1911 spielte.
Trotz der komischen Uniform, die nicht gerade feminin wirkt, fiel mir eine Trompeterin auf. Ich bin nicht sehr musikalisch, hatte aber das Gefühl, dass es nicht richtig sein kann, wenn man eine Trompete aus dem Bläsersatz dermaßen schrill heraushört. Dem Gesichtsausdruck des Dirigenten nach hatte ich mit dieser Einschätzung Recht.
Damals sah ich Franziska zum allerersten Mal. Allerdings wusste ich noch nicht, dass sie Franziska hieß.
Ich konnte sie einfach nicht vergessen.
Ihr Gesicht, meine ich.
Ich betrete das Sonsbecker Rathaus in der Herrenstraße 2. Es dauert eine Weile, bis ich mich durchgefragt habe und schließlich im Zimmer des Sachbearbeiters sitze, der dafür zuständig ist, einem Bedürftigen wie mir Hilfe zum Lebensunterhalt zu gewähren.
Der Sachbearbeiter heißt Wolke. So hat er sich mir gegenüber vorgestellt. Seine Kollegin, die während unseres Gesprächs mehrfach hereinschneit und uns mit irgendwelchen ach so dringenden Lappalien unterbricht, nennt ihn HEBBET.
Nicht HERBERT sondern HEBBET.
Vielleicht kommt sie aus dem Hessischen.
Jedenfalls ist sie nicht von hier.
Zugezogen.
Ihre Sprache verrät sie.
Sie ist blond und quirlig.
HEBBET ist genau das Gegenteil.
Dunkelhaarig und ziemlich behäbig. Richtig lahm. So, wie man sich einen Beamten in seiner Amtsstube eben vorstellt.
Wolke lehnt sich in seinem Sessel zurück und sieht mich abschätzig an.
"Sie wollen also Geld von mir haben."
"Nicht von Ihnen persönlich."
"Logisch", knurrt er. "War ein Witz."
"Ach, so."
Er atmet tief durch, beugt sich vor und greift sich anschließend mit schmerzverzerrtem Blick an den Rücken. Irgendetwas zwickt ihn da.
Das sind eben die Folgen des Dauersitzens. Kann man in jedem Apothekenblatt nachlesen.
"Sie haben zurzeit keine Arbeit?", fragt er mich.
"Nein."
"Seit wann?"
"Seit ... Schon jahrelang."
"Wovon haben Sie gelebt?"
"Vom Geld meiner Mutter."
"Ist Ihre Mutter berufstätig?"
"Nein, jetzt nicht mehr. Sie steht nicht mehr auf. Jedenfalls nicht ohne Hilfe."
"Heißt das, sie ist ein Pflegefall?"
"Kann man so sagen."
"Zahlen Sie Miete?"
"Nein. Ich lebe im Haus meiner Mutter. Also, eigentlich ist es mein Haus. Sie hat es mir vor ein paar Jahren überschrieben."
"Außer den Zuwendungen Ihrer Mutter haben Sie keinerlei Einkünfte?"
"Ich habe hin und hin und wieder mal ..." Ich stocke.
"Schwarzarbeit?", erlöst er mich davon, mich selbst belasten zu müssen.
"Ja."
Er seufzt. Sieht genervt aus. Ich bereue schon, überhaupt hier her gekommen zu sein.
"Sie müssen mir Ihre Vermögensverhältnisse offen legen, sonst gibt es kein Geld für Sie", erklärt mir Wolke jetzt unmissverständlich.
"Wenn Sie Ihre Mutter pflegen, dann hätten Sie auch vielleicht Anspruch auf Leistungen der Pflegekasse. Haben Sie Ihre Mutter vom medizinischen Dienst begutachten und in eine Pflegestufe einstufen lassen?"
"Nein."
"Das sollten Sie schleunigst veranlassen", sagt Wolke. "Ihren Schilderungen entnehme ich, dass Ihre Mutter bettlägerig ist."
"Ja."
"Dann sind Sie auf Grund der übernommenen Pflege auch nicht voll erwerbsfähig." Er seufzt, sieht auf die Uhr. "Wissen Sie was, ich muss heute pünktlich weg. Aber ich habe hier ein Formular für Sie.
Füllen Sie das bitte aus und kommen Sie doch danach wieder in mein Büro."
"Wann?", frage ich.
Er zuckt die Achseln. "Die Tage mal."
Ich bekomme das Formular.
Seine quirlige Kollegin schneit noch einmal hinein. "HEBBET, eine Unterschrift!", säuselt sie, legt ihm was auf den Tisch. HEBBET
unterschreibt ohne sich das Blatt durchzulesen.
"Alles klar?", fragt HEBBET Wolke.
"Alles paletti. Hast du übrigens schon gehört, dass da eine junge Frau vermisst wird?"
"Wirklich?"
"Ja, hier aus dem Ort."
"Nö, weiß ich nix von."
"Kam gerade im Radio. Den Namen habe ich vergessen, aber morgen ist sicher ein Foto in der Zeitung."
"Vielleicht kennen wir sie."
"Sandra Stahlke oder Stahnke."
"Nee, das ist 'ne Schauspielerin, da vertust du dich, Katharina."
"HEBBET ..."
"Ja, wirklich!"
"HEBBET, die heißt Susan Stahnke und ist auch keine richtige Schauspielerin sondern ... Wat weiß ich!"
Ich habe langsam das Gefühl, hier überflüssig zu sein. Immerhin weiß ich jetzt, dass die Quirlige Katharina heißt. Sie gefällt mir. Ich hätte sie gerne zu Hause. Nur so zum Reden. Nur zum Reden. Nicht für mehr.
Das Land hier am Niederrhein ist flach. Bäume, Häuser, Alleen, hin und wieder eine Kirche. So sieht es aus hier in Sonsbeck. Idyllisch könnte man dazu sagen. Mein Haus liegt ein Stück die Weseler Straße raus. Man kann es von der Straße aus nur im Winter sehen, wenn die Bäume kein Laub tragen. Mein Wagen, der Wagen, der meinem Vater gehört hat, steht jetzt in der Garage. Ich habe kein Geld für den Sprit mehr. Ich bin ein sparsamer Mensch, aber vielleicht war ich in der Vergangenheit nicht sparsam genug.
Jetzt fahre ich mit dem Fahrrad in die Stadt.
Geht auch.
Muss gehen.
Muss einfach.
Als ich später meine Mutter umbette, damit sie bequem liegt und keine Druckstellen bekommt, sagt sie: "Wir damals, in der schweren Zeit, wir haben ganz andere Sachen ausgehalten. Und du meckerst, wenn du mal in die Pedale treten musst!"
Als ich das Sozialamt verlasse, fällt mir das Plakat der Volkshochschule auf. "Volkshochschulzweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten" , so nennt sich diese Institution mit vollem Namen. In Zimmer 22 des Rathauses residiert der offizielle Ansprechpartner, ein Herr mit einem holländisch klingenden Namen.
Ich sehe mir das Plakat an. Karate für Anfänger, Wirtschaftsenglisch für Fortgeschrittene und Kreatives Schreiben.
MORD FÜR ANFÄNGER UND FORTSCHRITTENE, steht da in großen Buchstaben. Lernen Sie literarisch zu morden.
Klingt interessant, denke ich.
Schreiben befreit, heißt es. Man ordnet dadurch angeblich seine Gedanken.
Die vielen Stimmen im Kopf. Auch andere Dinge. Man ordnet seine Welt. Man erschafft seine Welt neu. Besser vielleicht.
Eine Weile habe ich das geglaubt.
Aber es stimmt nicht.
Gleichgültig, mit welch salbungsvollen Worten unsere Kursleiterin dies auch zu beschwören versucht. Die Stimmen sind immer noch da.
Und manch anderes auch. Aber in so einem Volkshochschulkurs für Kreatives Schreiben lernt man nette Menschen kennen. Frauen überwiegend. Und das ist doch auch etwas.
Es ist eine traurige Sache.
Warum bleiben sie nicht?
Warum erschrecken sie, wenn sie das Haus betreten? Weshalb beklagen sie alle sich über einen bestimmten Geruch, von dem sie nicht sagen können, wodurch er verursacht wird?
Sie wollen nicht bleiben und mit mir reden.
Ich weiß nicht warum.
Ist es zuviel, was ich verlange?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Und doch, es ist immer dasselbe.
Sie wollen nicht bleiben. Ich kann von Glück sagen, wenn sie sich wenigstens mit mir an den gedeckten Tisch setzen.
"Hat jemand etwas von Franziska gehört?", fragt die Kursleiterin irgendwann, nachdem Franziska schon das dritte Mal nicht zum Kurs gekommen ist.
Zunächst herrscht Schweigen.
Schließlich sagt eine junge Frau mit mattglänzendem Haar und einem sehr ernsten Gesicht, bei dem man unwillkürlich auf die Idee kommt, dass eine schwere Jugend sehr schwermütige Gedanken zur Folge hat: "Ich habe bei ihr geklingelt, aber es war wohl niemand da."
"Also wenn ihr jemand zufällig begegnen sollte", so die Kursleiterin, "dann möge er ihr doch bitte schöne Grüße von mir ausrichten und sie fragen, ob sie nun an unserer Lesung teilnehmen will oder nicht. Irgendwann muss ich ja auch planen."
Sie wird nicht teilnehmen, denke ich.
Weder an der Lesung, noch an sonst irgendetwas.
Franziska wird gar nichts mehr tun.
Ich zünde die Kerzen an.
Der Schein der Flammen fällt auf ihre ebenmäßigen Züge und taucht sie in ein diffuses Licht.
Ich konnte sie nicht gehen lassen.
Ich konnte einfach nicht.
Ich spaziere gerne am Dassendaler Weg zwischen dem Römerturm und der St. Gerebernus-Kapelle. Manchmal sagen mir Stimmen, ich soll hier hin gehen. Vielleicht suche ich instinktiv die Nähe eines sakralen Gebäudes. Betreten habe ich die Kapelle nie. Auch keine andere Kirche.
Seit Jahren nicht.
Es wäre mir irgendwie unangemessen vorgekommen. Du hast dort nichts zu suchen!, sagt eine Stimme.
Aber eine andere widerspricht: Genau hier bist du richtig. Im Angesicht des Kreuzes. Wo sonst willst du Buße tun?
Ich schließe die Augen.
Kneife sie zu.
Drücke die Handflächen auf die Ohren.
Es ist dunkel.
So dunkel.
Der Chor der Stimmen verstummt nicht.
Ich spüre eine leichte Berührung. Sie wirkt wie ein elektrischer Schlag.
"Ist Ihnen nicht gut?", dringt eine weibliche Stimme in mein Bewusstsein. Ich erkenne sie wieder, öffne die Augen und sehe die quirlige Katharina aus dem Sozialamt. Ihr Gesicht wirkt besorgt.
"Alles in Ordnung."
"Wirklich?"
"Wirklich."
"Ich habe ein Handy dabei. Soll ich einen Arzt rufen?"
"Nein, danke."
Sie sieht mich zweifelnd an. "Na, Sie müssen es ja wissen."
"Eben!"
Geh weg.
Sofort.
"Ich meine, es ist halt so, dass Kurse meistens im Laufe der Zeit kleiner werden", sagt die Leiterin einmal. "Aber wenn man keine Lust mehr hat, könnte man sich eigentlich wenigstens abmelden, finde ich."
Hast du eine Ahnung!, denke ich.
Die Leiterin macht ein erntes Gesicht.
Drei volle Sekunden Schweigen.
Dann wenden wir uns em Text einer rothaarigen, sehr hageren und sehr unzufrieden wirkenden jungen Frau zu, die aussieht, als hätte sie in ihrem jungen Leben schon viel mitgemacht. "Ich habe das Problem, wie ich historische Fakten in meinen Krimi einbauen soll", sagt sie.
"Ich möchte schließlich nicht aufdringlich oder belehrend klingen, andererseits ... Nun, ich habe einen Kompromiss zwischen spannender Handlung und historischer Genauigkeit versucht."
Wir hören ihr zu.
Nachdem sie zwei Seiten lang über die Gründung der Stadt Sonsbeck im Jahre 8 v. Christus durch den römischen Kaiser Tiberius doziert und Bezüge zur Herrschaft der Grafen von Cleve im zwölften Jahrhundert hergestellt hat, die in Sonsbeck eine Bockwindmühle besaßen, denke ich, dass dieser Kompromiss gründlich daneben gegangen ist. Eigentlich geht es ihr nämlich darum, einen Mord zu beschreiben, der in der Turmwindmühle stattfindet, die zu dem daneben liegenden Hotel gehört.
Als die Rothaarige anschließend noch ellenlange und detailreiche Beschreibungen des fast völlig von Efeu übewuchterten Mauerwerks zum besten gibt, denke ich: Man sollte die Todesstrafe wieder einführen. Für Langweilerinnen.
Etwas fasziniert mich doch an ihr.
Ihr Gesicht.
Sie ist nicht mein Typ, das hatte ich innerhalb der ersten zwei Sekunden entschieden, in denen ich sie sah.
Trotzdem...
Ihr Gesicht - nein, ihr Gesichtsausdruck! - dieses fleisch gewordene Monument aus Qual und Entsagung, muskulös durch das Kauen von Grünkernen und Müsli, gezeichnet durch den Ausdruck permanenter Unzufriedenheit, der sich bereits in Form von charakteristischen Falten verewigt hat, erinnert mich an Mutter.
Sie sah auch so drein.
Wenn sie von der schweren Zeit sprach.
Sie sprach oft davon.
Kein Wunder, dass sie früh Falten bekam.
Das mit den Stimmen fing an, als ich etwa fünf Jahre alt war.
"Dafür brauchen wir keinen Arzt", hatte Mutter damals gesagt.
"Das wächst sich aus, wenn du größer wirst."
Es hat nie wieder richtig aufgehört. Sie sind immer da. Das Einzige, was sie vorübergehend übertönen kann, sind die Stimmen anderer.
Die Stimmen meiner Besucherinnen zum Beispiel.
Mutter hat keine von ihnen gemocht - und das, obwohl ich ihr nur das Beste über sie berichtet habe. Keiner von ihnen ist sie persönlich begegnet.
"Was ich gehört habe, reicht mir für ein Urteil", pflegte sie zu sagen.
Ein Urteil.
Das war es.
Ein Urteil ohne Berufung. Ohne Verteidiger. Nur eine einsame Richterin.
"Reg dich nicht so auf", sagte ich.
"Wieso soll ich mich nicht aufregen, wenn du dich mit den falschen Frauen triffst? Welche Mutter würde sich da nicht aufregen?"
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2018
- ISBN (ePUB)
- 9783738916188
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (Januar)
- Schlagworte
- mörder-stories