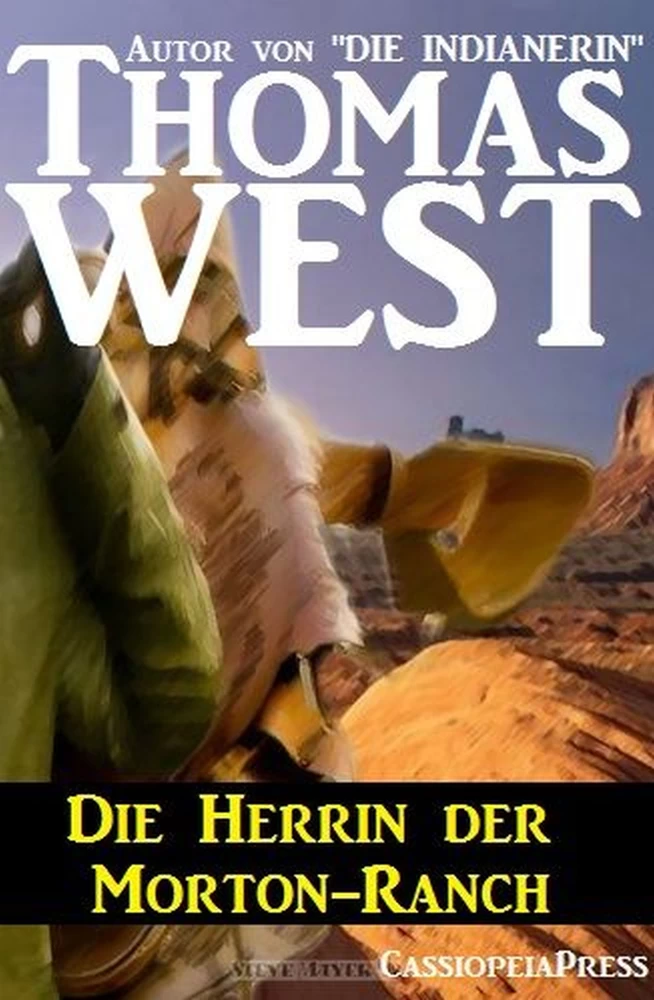Zusammenfassung
Harte Männer und Frauen, die alle um Verstand und manche um ihr Leben bringen.
Ein pralles Sittengemälde aus der Zeit des Wilden Westens - ein echter Thomas West. Hart, schonungslos und ohne Tabus.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
 |  |

Die Herrin der Morton-Ranch
Western von Thomas West

Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© 2012 der Digitalausgabe 2012 by AlfredBekker/CassiopeiaPress
––––––––

WAS EMPFINDET EIN MANN Auge in Auge mit dem Tod?
Randolph O'Rourke hatte sich diese Frage oft gestellt. In den Jahren vor dem Krieg, als er Siedlertrecks durch die Indianergebiete noch Oregon hinaufführte. Dutzende von Gräbern ließen sie am Wegrand zurück.
Und natürlich während der Kriegsjahre dann, in denen er als Kavallerist der Konförderation gegen die Yankees ritt. Vor allem, an dem Tag, als ihn die Nachricht vom Tod seines Bruders und seines Vater erreichte - weiß Gott - vor allem an diesem Tag, hatte er sich diese Frage gestellt, was ein Mann angesichts des Todes empfindet.
Jetzt wusste er es. Jetzt, wo der neue Befehlshaber von Fort Worth - ein Colonel der Yankees - auf der Veranda vor der offenen Tür seines Kommandantur-Büros stand, um der Hinrichtung von neun Partisanen beizuwohnen.
Jetzt, da fünf von Randys Waffengefährten gefesselt und mit verbundenen Augen an der Rückwand der Stallungen standen.
Jetzt, da zehn Blauröcke die Gewehre anlegten, und der Sergeant zehn Schritte neben dem Hinrichtungskommando "Feuer!" brüllte, und der Schusslärm über den Exerzierplatz donnerte. Jetzt wusste Red Randy bestens Bescheid.
Ein Mann angesichts des Todes empfand Glockengedröhn, das seinen Körper von den Fußnägeln bis hinauf in die Haarwurzeln ausfüllte - seinen Herzschlag. Und er empfand einen quälenden Harndrang. Vielmehr nicht.
Die Männer an der Stallwand brachen zusammen. Einer kippte seitlich um, einer stürzte das Gesicht voran in den Staub, einer drehte sich spiralartig um sich selbst, bevor er endlich still am Boden lag, und zwei prallten gegen die Stallwand und rutschen langsam daran herunter.
Noch während die Yankees Randys tote Gefährten durch den Staub davonschleiften, packten die Corporals rechts und links von ihm den langen Kerl an den Armen. Seine Hände waren auf den Rücken gefesselt. Zusammen mit seinen drei noch lebenden Waffenbrüdern zogen sie ihn hinüber zu der Stallwand.
Gleich ist's vorbei, dachte Randy, gleich hab ich's geschafft. Seine einzige Sorge war tatsächlich die, sich nicht in die Hosen zu pinkeln, solange er noch lebte.
Feuchte Flecken an den geteerten Holzstämmen der Stallwand. Auch im Staub davor Blut. Sie stießen Randy und die anderen drei mit den Gesichtern voran gegen die Stallwand. Sie verbanden ihnen die Augen Mit den Tüchern, die sie den schon toten Gefährten abgenommen hatten. Warm und feucht waren die Tücher.
Sicher hatte Randy vor drei Tagen daran gedacht, dass er sterben könnte. Vor drei Tagen an der Grenze ins Indian Territory, als sie den Vierspännertross der Yankees überfielen, die schweren Armee-Planwagen voller Munition und Waffen.
Es war nicht schwer gewesen - sie hatten sich die blauen Uniformen der verdammten Yankees angezogen. Und die schwerbewaffnete Eskorte - eine ganze Kavallerie-Schwadron - hatte sie für eine Nordstaaten-Einheit gehalten.
>Nordstaateneinheit<...! Partisanen der Südstaaten waren sie! Dreiundsiebzig zu allem entschlossene Partisanen! Es ging ruckzuck. Keinen hatten sie am Leben gelassen, nur die Pferde.
Grobe Hände rissen Randy herum und drückten ihn rücklings gegen die Außenwand des Stalls. Dann entfernten sich die Schritte der Corporals. Randy glaubte, der Schädel unter seinem Rotschopf müsste ihm zerspringen, so heftig dröhnte der Glockenschlag seines Herzens in seinem Hirn...
Lancaster war der Verräter gewesen. Ohne Zweifel - Henry Lancaster. Der Bürgermeister von Paradise arbeitete mit den Yankees zusammen! Ausgerechnet der Bürgermeister...! Diesmal war das Überraschungsmoment auf Seiten der Nordstaaten gewesen. Red Randy hatte von der Schießerei gar nichts mitgekriegt. Sie hatten ihn betrunken aus dem Bett geholt. Das war gestern gewesen.
Lancaster würde das Kriegsende nicht erleben. Doch das tröstete Randy nicht.
Er hörte das Geschrei des Sergeants. "Achtung!" Zu Harndrang und Glockendröhnen in seinem Kopf mischte sich ein Bild. Das Bild seiner Mutter, ihr liebes Gesicht, ihre zärtlichen Augen, ihre vom Waschen, Nähen und Stallarbeit schwieligen Hände.
"Gewehr anlegen!"
Randy fühlte sich plötzlich wie ein Sechsjähriger. Seine Tränen sickerten in die schwarze Augenbinde und vermischten sich mit dem Schweiß des schon erschossenen Kampfgefährten. Er biss die Zähne zusammen und wartete auf den Feuerbefehl.
Plötzlich Hufschlag. "Halt!" Eine Frauenstimme. Dunkel, herrisch, lauter als die Männerstimme, die jetzt hätte "Feuer!" schreien müssen. Wie aus einer anderen Welt drang sie in Randys Bewusstsein. Er stand schon auf der Grenze in jenes Land, aus dem es kein Zurück mehr gibt. "Halt, zum Teufel! Ihr erschießt den Falschen!" Randy erkannte die Stimme.
Josephine Morton...
Stimmengewirr vor der dunklen Binde, Getuschel. Der Hufschlag verstummte. Es mussten vier oder fünf Reiter sein, die auf den Exerzierplatz von Fort Worth geritten waren. Randy hörte wenigstens einen aus dem Sattel springen. Er war jetzt hellwach.
"Colonel Webbster!", rief die Frauenstimme. "Ich weiß nicht, ob dieser Mann ein Partisan ist oder nicht! Aber ich weiß, dass er vor drei Tagen keinen Munitionstransport an der texanischen Grenze überfallen haben kann!" Randy sah nichts - die Binde, wie gesagt - aber er wusste, dass sie auf ihn deutete. "Vor drei Tagen nämlich war dieser Mann auf der Morton-Ranch und hat mit mir zusammen meine Fohlen gebrannt."
Das stimmte nur halb. Randy war auf der Morton-Ranch gewesen, ja. Aber das war über eine Woche her. Und da hatte er nicht mit Josephine Morton zusammen ihre Fohlen gebrannt, da lag er mit ihr zusammen in ihrem Bett.
"Das kann ich beschwören, Colonel!"
Randy vergaß zu atmen. Und er vergaß auf den dröhnenden Glockenschlag in seinem Schädel zu achten. Er lauschte Josephines energischer Stimme und den bohrenden Fragen des Yankee-Kommandeurs. Wie viele Meilen ihre Farm von Denton entfernt sei, wollte er wissen, wie lange O'Rourke an diesem Tag mit ihr zusammen die Fohlen mit dem Brandeisen bearbeitet hatte, ob das jemand bezeugen könne, und so weiter, und so weiter.
Josephine Morton beantwortete jede seiner Fragen knapp und nachdrücklich und mit der für sie so typischen rauen Altstimme. Über eine Reitstunde läge ihre Ranch von Denton entfernt und der Ort mindestens zwanzig Meilen von der Grenze zum Indian Territory, und O'Rourke hätte vom frühen Vormittag bis zum Sonnenuntergang bei ihr gearbeitet. Einige Männerstimmen bestätigten das. Dann die Stimmen der Yankees, und schließlich der Befehl des Sergeants "Gewehr ab!"
Randy wusste nicht, wie ihm geschah. Sie nahmen ihm die Binde ab. Da stand sie - dunkle, zornige Augen, brauner Teint, schwarzes, streng zurückgekämmtes und zusammengebundenes Haar und ähnliche Kleider, wie die fünf Männer bei ihr: Staubige Nietenhosen, Lederchaps, Baumwollhemd, speckige Weste und verschwitzter Stetson. Josephine Morton.
Ihre Blicke begegneten sich. Triumph loderte in ihren braunen Augen. Wie ein Engel kam sie ihm vor. "Sperrt ihn ein", sagte Colonel Webbster.
Die Corporals führten ihn über den Exerzierhof zum kleinen Zellentrakt von Fort Worth. Randy glaubte zu träumen. "Gewehr auf!", schrie der Sergeant. "Feuer!" Eine Schusssalve krachte hinter Randy über den Exerzierplatz. Er hörte die Körper seiner Waffengefährten dumpf auf dem Boden aufprallen.
Wieso leb ich noch...? Warum hat mich keine Kugel getroffen...? Ein Karussell rotierte in seinem Schädel. Es drehte sich um das Gesicht von Josephine Morton. Ich kenn sie kaum, warum hat sie das getan...?
Sie stießen ihn in eine der zehn Zellen des Gefängnistraktes. Randy stand am kleinen Zellenfenster und versuchte zu begreifen, was gerade geschehen war. Auf der anderen Seite des Exerzierplatzes sah er den Kommandeur mit Josephine Morton sprechen. Ihre Männer standen abseits bei den Pferden und rauchten. Randy kannte sie nicht.
Er wusste - jeder unter den Partisanen wusste das - dass Josephine Morton die Kavallerie der Yankees mit Pferden belieferte. Es blieb ihr nichts anderes übrig. Die Union hatte den Krieg so gut wie gewonnen. Sie führten sich schon auf wie die Herren von Texas.
Aber Josephine Morton belieferte auch die Partisanen mit Pferden. Heimlich natürlich. Deswegen hatte der rothaarige Randy gemeinsam mit vier Waffenbrüdern die Mortonranch aufgesucht. Vor etwas mehr als eine Woche, wie gesagt.
Das Geschäft nahm einen halben Tag in Anspruch, nicht mehr. Doch die Morton hatte darauf bestanden, ihnen ein Essen vorsetzen zu lassen. Es gab Bier und Whisky dazu. Das Hausmädchen stellte den anderen eine Flasche teuren Bourbons auf den Tisch, und die Morton drängte Randy, sich ihre Zuchthengste anzuschauen. Allein mit ihr.
Tja - im Stall gings schon los. Die Morton, vielleicht vier, fünf Jahre älter als Randolph O'Rourke, wusste genau was sie wollte. Irgendwann landeten sie ihm Bett. Und Randy blieb über Nacht.
Alles in allem also knapp vierundzwanzig Stunden, die sie gemeinsam verbracht hatten. Und jetzt das.
Randy fragte sich ernsthaft, ob am Ende weiter nichts als sein Schwanz daran Schuld war, dass die Yankees ein bis zwei Kugeln gespart hatten, und er nun vielleicht doch älter werden würde als nur dreiunddreißig Jahre.
Er beobachtete, wie Josephine Morton und ihre Männer in die Sättel stiegen. Sie ritten über den Exerzierplatz zum Tor. Einer der Reiter löste sich aus der Gruppe und lenkte sein Pferd dem Zellentrakt entgegen. Vor Randys Zellenfenster zog er grob an den Zügeln, das Pferd stieg hoch und schnaubte.
"Hör zu, Roter", knurrte der Reiter, ein etwa vierzigjähriger Mann mit faltigem, sonnenverbranntem Gesicht und einem dichten, schwarzen Schnauzer. "Wenn du das hier auch noch überlebst, und sie dich nach dem Krieg rauslassen, komm zur Morton-Ranch. Mrs. Morton will, dass du für sie arbeitest..."
Er riss die Zügel herum, preschte über den Exerzierhof den anderen hinterher, und galoppierte durch das Tor von Fort Worth.
Mrs Morton will, dass du für sie arbeitest... Immer wieder zog der Satz durch Randys Kopf. Mrs Morton will, dass du für sie arbeitest... Er kam überhaupt nicht auf die Idee, das nur als Angebot zu verstehen, über das er nachdenken müsste. Mrs Morton will...
*

NOCH IM SELBEN MONAT kapitulierte General Lee, und acht Wochen später, am 2. Juni, 1865, streckte mit General Smith der letzte Armeeführer der Konföderation die Waffen. Und zwei Jahre später erließ Präsident Johnson eine Amnestie. Auch Randolph O'Rourke wurde aus dem Gefängnis in Fort Worth entlassen.
Er machte sich zu Fuß auf den Weg Richtung Denton. Nach anderthalb Tagen erreichte er eine große Ranch am Ufer des Grapevine Lakes. Josephine Mortons Ranch...
*

JOHN CARSON GLAUBTE zunächst in die falsche Stadt geritten zu sein. Ein einziges Mal in seinem Leben war er bisher in Wichita, Kansas, gewesen. Ein, zwei Jahre vor dem Bürgerkrieg. Damals hatte er für die Wells Fargo als Postkutschen-Begleitschutz gearbeitet. Und damals war Wichita ein kleines Nest gewesen. Ein paar lächerliche Holzbaracken um ein kleines Kirchlein und den Saloon herum, weiter nichts.
Und jetzt reihte sich ein Haus ans andere entlang der Mainstreet. Es gab Hotel, Saloons, Spielhallen, Friseure und Stores, und viele Reiter, Kutschen und Fußgänger füllten die breite, staubige Straßenzeile.
John Carson zog die Zügel seines Wallachs an, das Pferd blieb stehen. >Wichita Restroom< war auf einem weißen Schild über dem Vordach des Saloons zu lesen. "Wir sind tatsächlich in Wichita, Grauer." Er stieg von seinem Wallach, band ihn am Bürgersteiggeländer vor dem Saloon fest, klopfte ihm zärtlich den Hals und betrat den >Wichita Restroom<.
Johnny Carson war nicht gerade ein Riese. In seiner Kavallerie-Schwadron hatten ihn die meisten Kameraden um einen halben Kopf überragt. Die Krempe seines weißen Stetsons trug er in der Regel tief ins Gesicht gezogen, und unter seiner gewölbten Stirn leuchteten ein paar hellblaue Augen. Ziemlich vergnügte Augen, wenn nicht gerade Ärger anstand. Ein schwarzer Stoppelbart bedeckte die untere Hälfte seines Gesichts.
Er trug nicht die allerbilligsten Klamotten: Eine gute, schwarze Baumwollhose, eine schwarze Lederweste, darunter ein weißes Rüschenhemd und darüber ein langschößiges hellgraues Jackett. Zwei Colts .45er steckten links und rechts in den Halftern seines Waffengurtes. Johnny Carson war drei Wochen zuvor, Mitte September, vierunddreißig Jahre alt geworden.
Im Saloon - ein großzügiger, quadratischer Raum - bevölkerten ein gutes Dutzend Frauen und vielleicht dreimal so viele Männer Tische und Theke. Lärmende, aufgekratzte Männer, Texaner hauptsächlich. Nach Wochen unter freiem Himmel, nur in Gesellschaft von ihresgleichen und Tausender Longhornrinder, setzten sie nun ihren Hirtenlohn in Whisky und Frauen um. Es war Johnny Carson neu, dass Wichita seit wenigen Monaten als aufstrebende Kuhstadt galt. Er war nicht aus Kansas, er kam von weit her.
Johnny drängte sich zwischen die Texaner an die Theke und bestellte einen Kaffee. Ein paar Minuten später schob ihm der Wirt den Becher mit dem dampfenden Gebräu über den Tresen. "Eine Menge los in eurer Stadt", sagte Johnny. "Als ich das letzte Mal nach Wichita wollte, wäre ich fast dran vorbeigeritten - so klein war es."
"Das haben wir Jesse Chisholm zu verdanken." Der Wirt, ein fülliger Bursche von etwa fünfzig Jahren und mit bärtigem Vollmondgesicht, machte nicht den Eindruck, als hätte er Sorgen. Seine glatten Gesichtszüge, die wulstigen Lippen und die großen, ruhigen Augen ließen Johnny an ein sattes Kind denken. "Seit er die Route durchs Indianerterritorium nach Texas hinunter gefunden hat, können wir uns über Langeweile nicht mehr beklagen..."
"Und über leere Kassen auch nicht, was?", feixte einer der Texaner, ein drahtiger Mann in Johnnys Alter. Seine Haut hatte einen ungesunden Gelbstich. Eine große Lücke klaffte in seinen Schneidezähnen.
Johnny drehte sich eine Zigarette und zündete sie an. "Wo finde ich die Farm der O'Rourkes?", wandte er sich dann an den Wirt. Ein schnurrbärtiger Bursche auf der anderen Seite der Theke horchte auf. Johnny entging es nicht. Es gab überhaupt wenig, das ihm entging.
"Das ist jetzt die Farm der Conellis", sagte das Vollmondgesicht. "Italienische Einwanderer, sie haben das Land nach Kriegsende gekauft."
Johnny ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken. "Mrs. O'Rourke lebt also nicht mehr in Wichita?"
"Leben nicht, aber in der Stadt schon", sagte der Wirt. "Sie liegt auf dem Friedhof. Ihr Mann und ihr ältester Sohn sind in der Schlacht um Petersburg gefallen. Das hat ihr das Herz gebrochen."
"Übel", brummte Johnny. "Aber da muss es noch einen jüngeren Sohn geben..."
"Red Randy?" Der Wirt zuckte mit den Schultern. "Hat sich Quantrills Partisanen angeschlossen, als er vom Tod seines Vaters und seines Bruders erfuhr. Ein gerissener Hund, bei allen Teufeln! Soll den Yankees mächtig zugesetzt haben. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist."
"Er ist tot", mischte sich der junge Texaner mit der Zahnlücke ein. "Unten in Fort Worth von den Blauröcken erschossen. Im letzten Kriegsjahr. Mit acht anderen Partisanen."
"Red Randy?", kam es von der anderen Seite der Theke. Die meisten Cowboys dort hatten ihre Gespräche unterbrochen und zugehört. "Erschossen? Blödsinn! Er sitzt im Kerker von Fort Worth. Schon das dritte Jahr."
Es war der Mann mit dem dichten, schwarzen Schnurrbart, der das sagte. Johnny fiel sein sonnenverbranntes, etwas hohlwangiges Gesicht auf. Und der lauernde Ausdruck in seinen Augen. Er hieß Abner Kearny und stammte aus Denton, Texas. Aber das sollte Johnny erst Wochen später erfahren.
"Red Randy lebt?!" Der Texaner neben Johnny runzelte die Stirn. "Ich schwör dir, sie haben ihn an die Wand gestellt."
"Schon möglich", knurrte der Schnauzbart. "Aber sie haben ihn nicht abgeknallt."
"Woher weißt du das, Texaner?", erkundigte sich Johnny.
"Ich weiß es." Der Mann leerte sein Glas, knallte es auf den Tresen und stieß es ab. Es scheuerte über das Holz Richtung Wirt. "Bring uns eine ganze Flasche von dem Gesöff." Dann wandte er sich wieder der Frau neben sich zu. Nach seinem Geschmack hatte er genug geredet, wie es schien.
Der Wirt angelte eine Whiskyflasche aus dem Barschrank und stellte sie vor den Schnauzbart. Danach kam er zurück zu Johnny, stützte sich auf die Theke und beugte sich zu ihm. "Was willst du von den O'Rourkes?" Er zog ein misstrauisches Gesicht.
"Ich hab eine Nachricht für sie." Jetzt beäugte das Vollmondgesicht den fremden Gast mit unverhohlener Neugierde. "Eine persönliche Nachricht", sagte Johnny. Dabei beließ er es.
Er versenkte drei Löffel Zucker in seinem Kaffee. Nachdenklich rührte er ihn um und rauchte dabei. Die Neuigkeiten, die er eben gehört hatte, gefielen ihm nicht.
Es war ein weiter Weg gewesen von der Westküste Kanadas bis nach Kansas. Und nun sah es ganz danach aus, als wäre er vergeblich in den Sattel gestiegen.
Johnny hielt sich seit Kriegsende in Kanada auf. Aus gutem Grund. Er hatte zu General Lees Truppen gehört, die 1864 von den Yankees in Petersburg eingekesselt waren. Ein Stoßtrupp unter seinem Kommando hatte eines Morgens einen Ausfall aus der belagerten Stadt gewagt und über sechzig Yankees getötet. Darunter einen Brigadegeneral.
Die Yankees waren nachtragend diesbezüglich, und Johnny fühlte sich sicherer in Kanada. Erst die Nachrichten von immer neuen Amnestiegesetzen hatten ihn schließlich dazu bewegt, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. Am Tag, bevor Petersburg fiel, hatte er ein Versprechen abgelegt. Johnny Carson gehörte zu den Männern, die zu ihrem Wort zu stehen pflegten.
Um ihn aus der Reserve zu locken erzählte der Wirt noch dies und das über die Familie O'Rourke. Zum Beispiel, dass James O'Rourke, Randolphs Vater, ein großer Säufer vor dem Herrn gewesen war. Nichts Neues für Johnny.
Und dass Christopher O'Rourke, James älterer Sohn, die Farm übernehmen sollte, weil er, anders als seiner jüngerer Bruder, ein tüchtiger Bursche war. Auch dass nichts Neues für Johnny.
Und dass der Bürgermeister von Wichita das Land der O'Rourkes verkauft hatte und den Erlös auf der Bank deponiert hatte. Dort wartete es die gesetzlich vorgeschriebene Zeit auf einen rechtmäßigen Erben, einen möglichen Überlebenden der irischen Einwandererfamilie. Das allerdings war neu für Johnny.
Er zahlte seinen Kaffee und tippte sich an die Hutkrempe. Während er an der Theke entlang Richtung Ausgang schlenderte, traf sich sein Blick mit dem des Schnauzbärtigen. Der lauernde Ausdruck in den Augen des Mannes gefiel ihm nicht. Er verzichtete drauf ihn noch einmal wegen des Schicksals des zweiten O'Rourke-Sohns anzusprechen. Forth Worth - die Spur reichte ihm.
Aber der Schnauzbart sprach ihn an. "Ne offene Rechnung mit Red Randy? Oder bist du am Ende ein verdammter Yankee-Spitzel?"
Johnny blieb stehen und musterte den Älteren. "Sonst noch Fragen, Sir?"
"Beantworte mir erstmal die beiden, dann sehen wir weiter."
Johnnys Brauen wanderten nach oben, und der vergnügte Ausdruck verschwand aus seinen Augen. Jeder, der ihn auch nur ein bisschen kannte, hätte kein weiteres Wort mehr verloren. Der Schnauzbart aus Texas kannte ihn nicht. Und als Johnny sich wortlos abwandte und die Schwungtür ansteuerte, sagte er: "Ein Yankee! Hab ich nicht einen Riecher für Stinktiere? Seht euch nur seine teuren Klamotten an! Seht euch nur an, wie hoch er seine Rotznase trägt!"
Johnny blieb stehen. Er schürzte die Lippen, als würde er ein verlockendes Angebot erwägen. Dann drehte er sich langsam um. "Mit General Mahone hab ich am Petersburger Krater den Angriff von Burnsides Yankee-Haufen zurückgeschlagen. Nur um das klarzustellen. Ich weiß nicht, was du in dieser Zeit getrieben hast, Texaner. Wenn ich dich so anschau', würd' ich sagen, du hast dich am Arsch gekratzt und dein Hirn mit Whisky getränkt."
Totenstille plötzlich im Saloon. Das Mädchen und die Cowboys rechts und links des Schnauzbartes rutschten von ihren Barhockern und wichen von ihm zurück. Das Gesicht des Texaners nahm die Farbe alten Pferdemistes an. Seine Linke stellte das Whiskyglas auf den Tresen, seine Rechte hob sich und bewegte sich langsam zum Kolben seines Revolvers.
"Und ich denke, das war gut so", setzte Johnny noch einen drauf. "Es gibt einfach Dinge, die sollte man richtigen Männer überlassen."
Der Schnauzbart sprang vom Barhocker und griff nach seinem Revolver. Noch nicht mal zur Hälfte hatte er ihn gezogen, als ein Schuss explodierte. Die Whiskyflasche auf dem Tresen zersprang in tausend Scherben, die Flüssigkeit ergoss sich schwallartig über Theke, Barhocker und Hosen des Schnauzbartes.
Cowboys und Mädchen an den Tischen waren aufgesprungen. Alle Augen im Saloon hingen an den beiden Colts in Johnnys Händen. Auch die des Texaners mit dem Schnurrbart. Widerwillig ließ er den Kolben seiner Waffe los.
Johnny betrachtete die nassen Hosen des Mannes. "Ungefähr so wirst du diese Zeit zugebracht haben. Mit vollen Hosen." Schritt für Schritt zog er sich zum Ausgang zurück. Sein Blick ließ den Schnauzbart keinen Augenblick los. Erst draußen auf dem Bürgersteig steckte er die Colts zurück in die Halfter. Er band den Grauen los, stieg auf und ritt aus der Stadt. Ganz wohl war ihm nicht. Johnny wusste, dass man sich nicht ohne Folgen einen Feind schafft.
*

"ICH WUSSTE, DASS DU kommen wirst." Josephine Morton stand auf der Veranda ihres Hauses. Ihr dunklen Augen leuchteten. Die Arme vor der Brust verschränkt blickte sie der abgerissenen Gestalt entgegen, die über den großen Ranchhof dem Haupthaus entgegenstapfte.
Randy sah ein bisschen aus, wie ein Landstreicher in seinen schäbigen Hosen, seinem zerschlissenen Hemd und dem roten Bartgestrüpp in seinem bleichen Gesicht. Das lange Haar fiel ihm bis auf die Schultern herab.
"Ich hab auf dich gewartet, Randolph O'Rourke." Er stieg die Treppe hinauf und ließ sein Bündel auf die Veranda fallen. "Zwei Jahre lang, ich wusste, dass du kommen wirst."
"Es war höllisch langweilig in Fort Worth", sagte Randy. "Aber ich schätze, im Himmel wärs noch langweiliger gewesen." Er betrachtete ihr Gesicht. Schwarze, schmale Brauenbögen über dunkelbraunen Augen, eine scharfgeschnittene Nase, ein schmaler, großer Mund - Josephine Morton war von einer herben Schönheit. Ihr ganze hochgewachsene Gestalt strahlte Willenskraft und Autorität aus. "Ohne dich hätte ich nirgendwo mehr hingehen können", sagte er leise. "Ich wollte mich wenigstens persönlich bedanken. Warum hast du das getan?"
"Du stinkst, O'Rourke." Sie überhörte seine Frage einfach. "Und du siehst aus wie ein Strauchdieb. Komm." Sie fasste seinen Arm und zog ihn zur Tür. "Nelly!", rief sie. Ein schwarzes Mädchen trat aus dem Haus. "Das ist Mr. Randolph O'Rourke. Er wird hier wohnen. Bereite ein Bad vor und such frische Kleider für den Gentleman heraus." Sie drehte sich nach ihm um, ihre Augen glitten über seine lange Gestalt. "Die größten, die du finden kannst. Bernies Sachen müssten ihm passen."
Eine halbe Stunde später saß Randy in der Küche des Morton-Hauses in einem Waschzuber. Josephine hatte ihm die Haare geschnitten. In einem Handspiegel betrachtete er sein glattrasiertes Gesicht.
Die Sommersprossen über dem Nasenrücken waren verblasst, unter den blaugrünen Augen ein paar Falten mehr, als früher, und die feine Kerbe zwischen Nasenflügel und Mundwinkel schien ihm ausgeprägter zu sein, als vor zweieinhalb Jahren, als er zum letzten Mal in einen Spiegel geschaut hatte. Aber ansonsten noch immer der gleiche, spöttisch dreinschauende Randy O'Rourke.
"Wer ist Bernie?", wollte er wissen.
"Mein Bruder." Josephine Morton lehnte mit verschränkten Armen gegen den Herd. Ungeniert beobachtete sie ihn beim Baden. "Er fiel gleich im zweiten Kriegsjahr."
"Und wie kommst du darauf, dass ich hier wohnen werde?"
"Ich will, dass du für mich arbeitest. Du kommst gerade zum richtigen Zeitpunkt. Die meisten meiner Männer haben mein Rinderherden nach Kansas getrieben..."
"Du züchtest jetzt auch Vieh?"
"Oh ja." Sie stieß sich vom Herd ab und ging am Waschzuber vorbei zur Haustür. "Wir müssen an die Zukunft denken. Und an unsere Schatullen. Die Yankees an der Ostküste brauchen Unmengen von Fleisch."
Randy sah ihr nach. Der grobe Stoff ihrer Nietenhose spannte sich über ihr Gesäß. Er sah den Tanz ihrer Muskulatur und ihren Hüftschwung. Das reichte, um eine heiße Fontäne aus seinem Schwanz durch seinen ganzen Körper schießen zu lassen. Zweieinhalb Jahre ohne Frau - er war fast umgekommen vor Verlangen.
Sie schloss die Haustür ab und zog die Vorhänge vor den Fenstern zum Hof zu. "Ich brauche jeden Mann. Und ich brauche vor allem einen klugen Mann, einen Mann, der mit allen Wassern gewaschen ist. Einen wie dich." Wieder lief sie am Zuber vorbei. Diesmal zu einer der beiden Türen, die zu den angrenzenden Zimmern führten.
"Woher willst du wissen, wie ich bin?"
Nacheinander schloss sie die beiden Türen ab. Randy wusste, was passieren würde. Sein Schwanz pulsierte bretthart im warmen Wasser. "Jeder zwischen Lubbock und Austin wusste eine Geschichte zu erzählen von Red Randy, dem Yankeefresser, dem Partisanen, der den Einheiten der Unionsarmee übel mitgespielt hat."
Langsam schritt sie zum Zuber. "Nicht umsonst haben sie dich so lange festgehalten. Glaub mir, O'Rourke, ich habe Kontakte zu einflussreichen Männern unter den Yankees. Trotzdem gelang es mir nicht, dich vorher rauszuholen." Sie zog ihr Hemd aus der Hose und knöpfte es auf.
"Der Bürgerkrieg hat viele Männer wie mich hervorgebracht." Randys Stimme klang jetzt heiser. Seine Augen klebten an der Haut unter ihrem Hemd. Stück für Stück enthüllte sie sich seinem verlangendem Blick. "Warum ausgerechnet ich? Doch nicht wegen einer Nacht, die wir miteinander verbracht haben?"
Sie streifte das Hemd über ihre Schultern und ließ es auf den Boden fallen. Unter den Trägern ihres Unterhemdes bogen sich ihre Schlüsselbeine wie große, braune Metallspangen. Ihre Brustwarzen drängten sich hart und steif hinter dem dünnen, weißen Stoff.
"Warum nicht deswegen?" Auch ihre Stimme war rau, fast brüchig. Sie zog sich das Unterhemd über den Kopf. Ihre spitzen Brüste waren weiß, Höfe und Warzen dunkelbraun. Randys Mund wurde trocken, er hielt für einen Augenblick den Atem an.
"Man trifft nicht jeden Tag einen Mann, der so gut gebaut ist, wie du, O'Rourke", sagte sie, während sie ihre Hose aufknöpfte. "Man trifft nicht jeden Tag einen Mann, der einen so ausfüllt, dass man zu platzen glaubt..." Sie flüsterte plötzlich, als wollte sie ihre eigenen Worte vor sich selbst verbergen. "...der einen an der Stelle berührt, wo es brennt, der einen satt machen kann.."
Sie stieg aus Hose und Schlüpfer. Nackt und breitbeinig stand sie vor dem Zuber. Ihre Rechte bedeckte den schwarzen, dreieckigen Pelz zwischen ihren Beinen. Ihre Finger krümmten sich in ihre Schamlippen hinein. "... und ich habe einen großen Hunger, O'Rourke, du hast ihn einmal gestillt. Du sollst ihn mir immer stillen..." Sie stieg zu ihm in den Zuber.
"Du bist verrückt", krächzte Randy. "Deswegen hast du mir ein falsches Alibi verschafft?"
"Zwing mich nicht noch deutlicher zu werden, Rotschopf." Auf den Knien rutschte sie zu ihm heran. "Vielleicht habe ich mich in dich verliebt damals? Unsterblich verliebt vielleicht sogar...?
So was soll vorkommen..." Sie packte ihn bei den Haaren, richtete sich auf und drückte ihm ihren Schoß auf den Mund. "Sprich mit mir, Rotschopf...", forderte sie. "Sprich mit meinem Schoß... gib mir deine Zunge... los, gib sie mir..."
Randy fasste ihr Kniekehlen und sog ihren Duft ein. Sie roch nach feuchter Erde und reifen Äpfeln. Langsam glitten seine Hände über die Rückseiten ihrer nassen Schenkel, hinauf bis zu ihren harten Gesäßbacken. Die runden Wölbungen, ihre nasse Haut und ihr Duft füllten sein Hirn aus. Das Blut tobte ihm durch die Adern. Er packte ihre Hüften, seine Lippen saugten sich an dem haarigen Eingang ihres Körpers fest. Sie stöhnte auf.
Mit seiner Zunge öffnete er ihre Spalte, leckte zunächst entlang der heißen Wülste, bis er die kleine, harte Perle am oberen Ende der Schamlippen erwischte. Er zog die Frau näher zu sich heran, seine Lippen umkreisten die lustige Perle, und Josephine stieß einen tiefen Seufzer aus. "Ja...", seufzte sie, "...ja... wie hab ich danach gehungert... ja..."
Ihre Hüfte begann im Rhythmus seiner Zungenbewegungen zu kreisen, ihre Schoß rieb sich an seinem Mund, ihre Perle kreiste um seine Zungenspitze. "So wollt ich's", stöhnte sie, "in hundert Nächten hab ichs mir vorgestellt..." Sie griff hinter sich ins Wasser, bog sich zurück, bis sie seinen Schwanz berührte. Ihre Hand schloss sich um das heiße Glied. "...in hundert Nächten hab ich dich gespürt... und musst es mir doch selbst machen... fester, Rotschopf, fester..."
Energisch umschloss ihre Hand seinen Schwanz, fest wie den Griff einer Peitsche, wenn man sie schwingt. Randy bäumte sich auf und knurrte vor Wolllust. "Ich hab so viele ausprobiert", keuchte sie. "Keiner machts wie du..." Sie ritt auf seinem Gesicht. "Gleich musst du mich stoßen, gleich, gleich..."
Ihr Daumen rieb unter Wasser über die Vorderseite seiner Eichel. Randys Lenden zuckten auf und ab, hin und her. Das Wasser im Zuber schwappte über und plätscherte auf den Küchenboden.
Seine Hände glitten von ihren Hüften zu ihrem Gesäß, kneteten das feste Fleisch und durch, und dann fuhren seine Finger in die Spalte zwischen ihren Backen. Gleichzeit hielt er ihren tanzenden Unterleib fest und stieß seine Zunge tief in sie hinein.
Sie schrie laut, ließ seinen Kopf und seinen Schwanz los und umklammerte die Ränder des Zubers. Wieder und wieder glitt Randys Zunge in sie hinein, als wollte er sie verschlingen bohrte er den Kopf zwischen ihre Schenkel, stieß die Zunge in sie hinein, und Josephine schrie "Ja!" und schrie "Ich komm!"
Immer weiter ließ sie sich zurückfallen, bis das Wasser ihre Brüste bedeckte, und Randy sich im Zuber hinknien musste. Wie die Hälfte einer Melone hielt er ihren Unterleib nun an den Gesäßbacken fest und saugte und stieß und leckte, während Josephine schrie und ihre Schenkel gegen seine Wangen presste. Ihre Ellenbogen lagen auf dem Zuberrand, ihre Finger klammerten sich daran fest, um den Kopf über Wasser halten zu können.
Und schließlich presste sie ihre Schenkel so hart gegen sein Wangen, dass sie ihm die Ohren verschloss und er den langgezogenen Schrei, mit dem sie den Höhepunkt erreichte, wie aus einem anderen Raum kommend hörte.
Die Muskeln ihrer Schenkel wurden weich, ihr Gesäß rutschte an seiner Brust entlang unter Wasser, sie ließ den Zuberrand los und tauchte unter. Sekundenlang schwebte ihr Lächeln unter der Wasseroberfläche. Sie hatte die Augen geschlossen, und wirkte vollkommen entspannt. Dann schlossen sich ihre Hände um seinen Schwanz und sie tauchte auf.
"Du musst bei mir bleiben", flüsterte sie. "Ich will dich haben, immer will ich dich haben... keinen anderen als dich..." Am Schwanz zog sie ihn behutsam zu sich heran.
Randy fasste ihre Fesseln und schob ihre Beine von seinen Schultern. Neben seinen Hüften drückte er sie ins Wasser. Er beugte sich über sie und umfasste ihren Leib unter Wasser. Sein Mund schloss sich um ihre rechte Brust. Wieder begann sie zu stöhnen.
Er packte sie an den Hüftknochen und zog ihren Körper seinem Schwanz entgegen. Er spürte das Kitzeln ihres Haars an seiner Schwanzspitze, er spürte die weit offene Spalte ihrer Scham, und wie von selbst glitt sein Schwanz in sie hinein.
Sie schloss die Augen und knurrte vor Behagen. In Randy aber brachen alle Dämme. Die Hitze ihres Schoßes, die Bewegungen, die sich ihm entgegenstemmten, das unerträgliche und doch so schöne Brennen in seinen Lenden - wie lange hatte er das nicht mehr gespürt!
Er stieß zu, wieder und wieder. Seine Fingerspitzen bohrten sich in ihre Gesäßbacken, und er stieß und stieß und stieß.
Josephines Körper zuckte im Wasser, als würde jeder Stoß ihr Schmerzen bereiten, doch es war weiter nichts als Lust, die sie erneut jede Kontrolle über sich vergessen ließ. Das Wasser schwappte über den Zuberrand, ihre Gesäß zuckte in Randy Händen, und die Hitze ihres Schoßes fachte die Glut in seinem Schwanz, in seinen Lenden zu einem unerträglichen Feuer an - die Flamme schoss durch seinen ganzen Körper, als etwas zwischen seinen Lenden explodierte und die Glut sich sich endlich in sie ergoss. Es war wie eine Erlösung...
*

WILLIAM WAKEFIELD SAß auf seinem Stammplatz, an dem kleinen runden Tisch direkt neben dem Treppenaufgang. Von hier aus konnte man den ganzen Saloon überblicken.
Er schob sein Bierglas und seinen neuen Stetson zur Seite als er Wanda Perritale mit einem Tablett in der Tür zur Küche auftauchen sah. Die junge Frau kam an seinen Tisch und stellte einen Teller mit dampfendem Essen vor ihn hin: Ein großes Steak, Bratkartoffeln und Bohnen. "Lass es dir schmecken, Billy."
"Danke, mein Täubchen." Er blickte Wanda hinterher, wie sie mit schwingenden Hüften an der Theke entlang tänzelte. Er mochte die sechsundzwanzigjährige Tochter von Sam Perritale, dem Wirt des einzigen Saloons in Denton. Er mochte es, wie sie ihre Hüften bewegte, er mochte ihren tänzelnden Gang, ihre hohe Mädchenstimme und ihr blauschwarzes Haar. Erst, als sie wieder in der Küche verschwunden war, griff er nach seinem Besteck und machte sich über sein Mittagessen her.
William Wakefield war ein in die Jahre gekommener, breitschultriger Mann. Graues, strähniges Haar bedeckte seinen großen Schädel. Seine Augen waren von einem trüben Grau. Jetzt, um die Mittagszeit, sah man den Rotschimmer in ihnen nicht mehr. Erst morgen früh wieder, nach einem viel zu langen Abend mit viel zu viel Whisky, würde er ihn während des Rasierens im Spiegel sehen.
Auf William Wakefields blauem Jackett - alle in Denton nannten ihn einfach nur Billy - glänzte ein Stern. Seit achtzehn Jahren hatte Billy Wakefield das Amt des Sheriffs von Denton inne. Länger als achtzehn seiner Vorgänger zusammen.
Billy hatte nicht ihre Fehler wiederholt - oder eigentlich war es nur ein Fehler, den jeder von ihnen begangen hatte: Billy hatte von vornherein aktzeptiert, wer in Denton und Umgebung das Sagen hatte. So entwickelte er sich im Laufe der Jahre zu einem Freund der Familie Morton. Er ging ein und aus auf der Morton-Ranch. Auch nachdem der alte Morton gestorben war. Und nach dem Tod seines einzigen Sohnes erst Recht.
Der >Grapevine Restroom< füllte sich langsam. Mit Landarbeitern, Fischern, Ranchern, die zum Einkaufen in die Stadt gefahren waren und mit einigen Cowboys. Weniger als sonst - die meisten Männer waren mit ihren Viehtrecks Richtung Norden unterwegs und würden frühestens Mitte Oktober zurückkommen. Ein paar ruhige Wochen lagen also noch vor dem Ort. Und vor dem Sheriff. Billy Wakefield schätzte ruhige Zeiten.
"Mahlzeit!", riefen ihm die neu eintretenden Männer zu. "Mahlzeit", krächzte auch Sam Perritale hinter der Theke. Billy nickte dem Wirt zu.
Ein klapperdürrer Mann, und von der Natur auch nicht gerader mit einer imposanten Körpergröße gesegnet - seine Theke reichte ihm fast bis zur Brust. Perritales Augen verloren auch um die Mittagszeit nicht ihren roten Schleier. Sein ganzes Gesicht glühte rot. Und ständig sah man ihn hastig einen Whisky hinunterkippen. Ohne seine Tochter Wanda hätte er den >Grapevine Restroom< längst verkaufen müssen. Und ohne die Herrin der Morton-Ranch sowieso. Jeder in Denton wusste das.
Billy Wakefield spülte ein besonders zähes Stück Fleisch mit einem Schluck Bier hinunter. Sein Blick fiel auf die Schwingtür des Saloons. Ein stoppelbärtiger Bursche von ungefähr dreißig Jahren stieß sie auf. Er trug ein dunkelblaues Hemd und eine speckige, braune Lederweste darüber. Stanley Cooper, einer der Männer, die auf der Morton-Ranch arbeiteten.
Er trat in den Saloon, sah sich um und entdeckte den Sheriff. Mit großen Schritten kam er zu Wakefields Tisch. "Er ist da", sagte er und ließ sich auf einem der Stühle nieder.
"Wer?", brummte der Sheriff mit vollem Mund.
"Red Randy - vor vier Tagen haben sie ihn aus Fort Worth entlassen. Josephine weicht nicht von seiner Seite. Er schläft bei ihr im Haus."
"Bis sie ihn satt hat", knurrte Wakefield. "Das Spiel kennen wir doch." Er versuchte sein Bedauern mit Sarkasmus zu überspielen. Die Mortontochter hatte ihm so manche Nacht versüßt. Viele Männer aus der Umgebung konnten auf solche Stunden zurückblicken. Die Herrin der Morton-Ranch galt als unersättlich. Und als anstrengend. Die meisten waren froh, wenn sie den Fängen der anspruchsvollen Frau wieder entkommen waren.
"Er soll der neue Vorarbeiter werden." Stanley Cooper wandte sich zur Theke um. "Ein Bier, Sam!" Der Wirt nickte.
"Das wird Abe nicht besonders schmecken. Aber mir solls Recht sein. Wenn er nur nicht über die Stränge schlägt. Die Zeiten haben sich geändert. Die neuen Siedler lassen sich nicht mehr alles bieten. Ruckzuck erscheint ein US-Marshall auf der Bildfläche. Hab ein Auge auf Red Randy."
"Du wirst ihn sicher bald kennenlernen. Irgendwann wird er hier im Saloon auftauchen. Er kann ja nicht jeden Abend unter Josephines Decke schlüpfen..."
"Weiß man's?" Wakefield grinste säuerlich. Etwas in ihm beneidete den neuen Mann der Queen of Denton, wie Josephine Morton hinter vorgehaltener Hand genannt wurde.
Stan Cooper saß mit dem Rücken zur Tür, und der Sheriff beschäftigte sich konzentriert mit seinem Steak und den Speckbohnen. Beide bemerkten das Paar nicht sofort, das den >Grapevine Restroom< betrat und sich eher zögernd dem Mittagstisch Wakefields näherte.
Der Mann mochte nur unwesentlich älter als Wakefield selbst - fast weiße, störrische Locken quollen unter seinem schwarzen Biberfellhut hervor. Er trug dunkelgraue Leinenhosen mit ledernen Knieflicken und darüber ein sandfarbenes Cordjackett mit Lammfellkragen.
Ein beachtlicher Bauch wölbte sich zwischen den offenen Knopfleisten des Jacketts, und der Mann schaukelte eher, als dass er ging. Man konnte Richard McCloud mit gutem Gewissen als fett bezeichnen, allerdings nur, wenn er sich außer Hörweite befand. Seine Zornanfälle waren sprichwörtlich in Denton und rund um den Grapevine Lake.
Neben ihm der einzige Mensch, der ihn ungestraft als >Fettsack< bezeichnen durfte: Eine strohblonde Frau von höchstens dreiundzwanzig Jahren mit einer niedlichen Stupsnase in ihrem weichen, mädchenhaften Gesicht. Jessie McCloud, seine Tochter.
Ihr Blondhaar war zu Zöpfen geflochten, die sie sich im Nacken zu einem Knoten zusammengebunden hatte. Ein herrlicher Nacken übrigens, weiß und schlank und von den gleichen niedlichen Sommersprossen überzogen, die auch ihre Nase sprenkelten.
Sie trug ein rotes Samthütchen mit einem Gebinde künstlicher Rosen - weiße Rosen - und ein dunkelrotes Samtkleid, vom Rüschenkragen abwärts bis zum Saum mit Perlmuttknöpfen durchgeknöpft, und darüber eine antrazithfarbene Jacke aus Bärenleder.
Jessi nickte einen Gruß zur Theke hinüber, wo Wanda Perritale sich eben an einer Whiskyflasche zu schaffen machte. Die beiden Frauen kannte sich gut. Was sie unterschied, zeigte sich vielleicht am deutlichsten, wenn die Männer von Denton und Farmen und Ranchen um den See über sie sprachen.
Über Wanda hatte so mancher eine delikate Geschichte zu erzählen. Selbst wenn man die Prahlereien der Männer von ihren Geschichten abzog, blieb unterm Strich immer noch genug übrig, das Wanda Perritales Ruf als leicht zu habendes Mädchen rechtfertigte.
Wenn die Männer über Jessie McCloud redeten, sprachen sie in der Regel nur ihren Namen aus und seufzten dabei.
"Ich muss Sie sprechen, Sheriff!" Richard McCloud zog zwei Stühle unter dem Tisch heraus, einen für sich, einen für seine Tochter. "Ich hab die Schnauze voll von diesen Schikanen..." Er lehnte seine Winchester hinter sich an die Wand, setzte sich und beugte sich weite über den Tisch.
"Hosenscheißer wie dieser da - ", er deutete auf Stanley Cooper. "Tagediebe von der Morton-Ranch ziehen Drahtzäune am Seeufer, treiben das verfluchte Morton-Vieh über meine Kartoffeläcker und Maisfelder..." Die Zornader an seiner Schläfe war geschwollen und sein schwerer Unterkiefer trotzig nach vorn geschoben. "Meine Schafe und meine Rinder können nicht zur Tränke, ein Drittel der Ernte ist im Eimer!" Die Leute im Saloon blickten auf, so laut wurde McCloud.
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2017
- ISBN (ePUB)
- 9783738915266
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Dezember)
- Schlagworte
- herrin morton-ranch