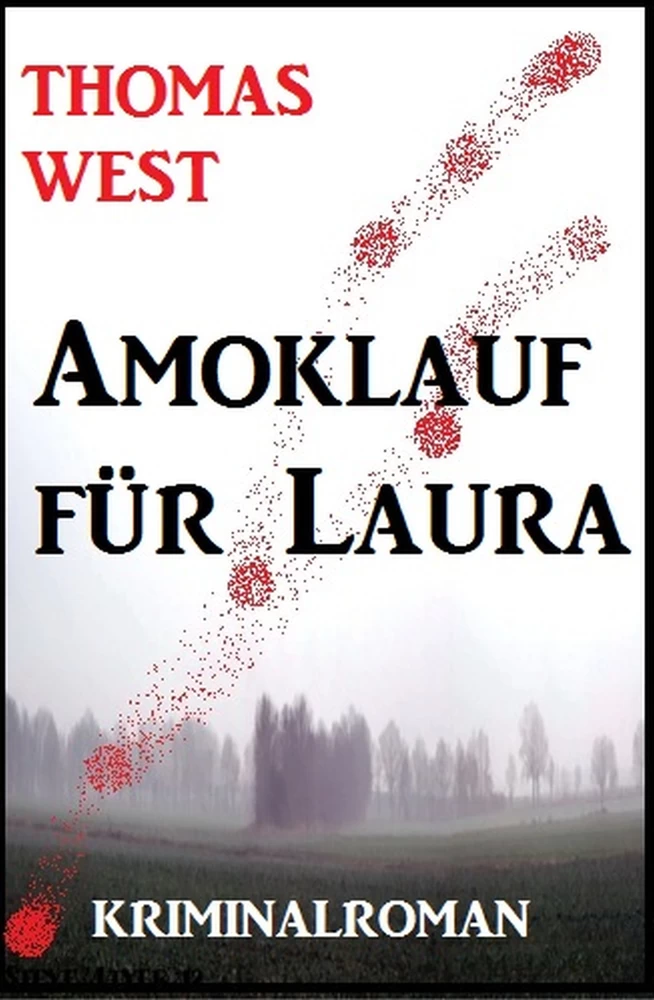Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Amoklauf für Laura

|

|


Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 117 Taschenbuchseiten.
George Everett ist einer der brillantesten und erfolgreichsten Anwälte Manhattans - was seine Tochter Laura nicht davor bewahrte, trotz der elterlichen Fürsorge und guten Ausbildung, in den Drogensumpf abzurutschen. Seither wütet in Everett ein abgrundtiefer Hass auf die Klavierlehrerin Camilla Cane und ihre Drogenpartys, und auf den bekannten Bauunternehmer Benson Rainshadow, der in Drogengeschäfte verwickelt ist, dem das Gericht bisher nur noch nichts nachweisen konnte, aber am meisten hasst er Mike Winter, der Laura abhängig gemacht hat. Und obwohl das FBI seit Monaten alles daransetzt, an die Drahtzieher der Drogenmafia von Lower Manhattan heranzukommen, gelingt ihnen kein Zugriff. Da wird Laura mit einer Überdosis tot aufgefunden – und alle, die mit Laura und den Drogen zu tun hatten, werden einer nach dem anderen ermordet ...
Copyright

|

|

1

|

|


Das Säulenportal des abendlichen New York County Court House erschien auf der Mattscheibe. >Bauunternehmer Benson Rainshadow freigesprochen< verkündete der Schriftzug unter dem Bild.
Der Mann vor dem TV-Gerät schloss die Augen und ließ seinen Kopf nach hinten gegen die Lehne seines schweren Ledersessels fallen. Geräuschvoll sog er die Luft durch die Nase ein. Als hätte ihn ein plötzlicher Schmerz überfallen.
Der Reporter von CBS wurde eingeblendet. Mit dem Mikro in der Hand stand er zwischen den korinthischen Säulen des Eingangsportals. "Das Bezirksgericht Manhattan konnte dem bekannten Bauunternehmer Benson Rainshadow nicht nachweisen, in Drogengeschäfte einer kriminellen Organisation verwickelt zu sein ..."
Der Mann stand aus seinem schweren Sessel auf. Mit müden Schritten ging er ins Nebenzimmer. Dort stand zwischen zwei Bücherschränken eine schmale Glasvitrine. Ein Waffenschrank. Der Mann zog die Glastür auf und nahm ein Jagdgewehr heraus.
"Rainshadows Anwälte haben eine Verleumdungsklage angekündigt ...", tönte es aus dem Fernsehzimmer. Der Mann betrachtete das Gewehr. "... sie sehen in der Rufmordkampagne gegen ihren Klienten den kriminellen Versuch, den Bauunternehmer aus dem hart umkämpften Baugeschäft in New York City zu drängen ..."
Ins Holz des dunkelbraunen Gewehrkolbens war ein Name eingraviert: George Everett. Der Mann legte das Jagdgewehr an und drehte sich um. Über dem barocken Tischchen auf der anderen Seite des Raums hing ein runder Spiegel. Oberkörper und Kopf des Mannes rückten ins Fadenkreuz des Zielfernrohrs. George Everetts Spiegelbild.
Er ließ das Fadenkreuz über die schwarze Anzugweste, das weiße Hemd und den silbergrauen Schlips wandern. Eine Augenblick stand es über seiner Herzgegend still. Dann wanderte es über den Krawattenknoten hinauf in sein kantiges, blasses Gesicht. Zwischen den blonden Brauen über den zusammengekniffenen Augen stand es abermals still.
Nebenan, aus dem TV-Gerät, verkündete eine helle Frauenstimme das Wetter des nächsten Tages. Schneeregen, und Temperaturen nahe des Gefrierpunktes. Schritte näherten sich.
"George!" Eine erschrockene Frauenstimme. George Everett nahm das Gewehr von der Schulter. Im Türrahmen die zierliche Gestalt seiner Frau. "Was machst du da, George?!" Jane Everetts große braune Augen hingen erstaunt an dem Gewehr. Sie trug einen dunkelroten Morgenmantel. Ein paar Strähnen ihres schulterlangen, schwarzen Haares hingen aus dem Handtuch heraus, das sie sich um den Kopf gewickelt hatte.
"Nichts", sagte Everett. "Gar nichts." Er drehte sich um und hängte das Jagdgewehr zurück in die Vitrine. "Die Jungs vom Golfclub haben vorgeschlagen am nächsten Wochenende in den Catskill Park zu fahren und Rotwild zu jagen."
"Bei dem Wetter ...?" Zwischen den schmalen, schwarzen Bögen von Jane Everetts Augenbrauen erschien eine Falte.
George drehte sich um und sah sie an. Er liebte ihre großen Augen. Die gleichen dunklen Augen, die ihre gemeinsame Tochter hatte. Er wollte nicht, dass Angst in diesen Augen flackern musste. "Warum nicht?" Ein gequältes Lächeln huschte über sein kantiges Gesicht. "Der Winterwald, das Kaminfeuer nach der Jagd, ein heißer Grog - hat seine Reize." Er nahm Jane in die Arme und wollte sie küssen.
Sie hielt ihm das schnurlose Telefon entgegen. "Richter Hastings will dich sprechen, Darling."
George nahm ihr den Apparat aus der Hand, presste ihn ans Ohr und steckte die Linke in die Hosentasche. "Everett?" Er ging langsam zum Fenster, während er dem Richter zuhörte.
Es ging um einen Mordfall. Der Angeklagte war ein stadtbekannter Basketballspieler, ein Lokalmatador. Er hatte einen jungen Burschen umgebracht. Die Presse machte eine Menge Wirbel um den Fall. Hastings bat George Everett die Verteidigung des Mannes zu übernehmen. George sagte zu.
Er reichte seiner Frau das Telefon. "Ich soll Louis Borgward verteidigen."
Jane schien gar nicht zuzuhören. Sie nickte langsam und blickte ihn an, als hätte sie sein Gesicht gerade zum ersten Mal gesehen.
George Everett hatte sich verändert in den letzten drei Monaten. Seit Laura, ihre gemeinsame Tochter, ausgezogen war. Dunkle Ringe lagen unter seinen Augen. Die Falten, die sich von seinen Nasenflügeln zu den Mundwinkeln herabzogen, waren tiefer geworden. Er sprach nur noch das Nötigste.
"Laura hat angerufen", sagte sie leise.
"So?" Er wandte sich ab und steckte beide Hände in die Hosentaschen. "Und wie geht's ihr?" Seine Stimme klang zynisch.
"Sie braucht Geld."
Er stieß ein bitteres Lachen aus. "Geld ... finanziert ihr der Musiker das Heroin nicht mehr?"
"Bitte, George ..." Jane lief ihm hinterher und stellte sich von ihn. "Sie braucht Geld für ihr Musikstudium."
"Natürlich." Wieder der zynische Unterton in seiner Stimme. George Everett neigte dazu, Trauer und Verzweiflung durch Zynismus zu kaschieren. "Und du glaubst das." Bitterkeit lag in seinem Blick. "Sie soll zurück nach Hause kommen und ihr Jurastudium wieder aufnehmen, dann bekommt sie Geld."
"Bitte, George ...!" Jane legte ihre Hände auf seine Schultern. "Ich bin genauso ratlos wie du! Aber wir müssen alles tun, um Laura zu zeigen, dass sie noch ein zu Hause hat - sonst rutscht sie immer tiefer in diesen Sumpf ..."
Das liebliche Gesicht seiner Tochter erschien auf Everetts innerer Bühne. Sie hatten nur dieses eine Kind. Und sie hatten ihm alles gegeben, was ein amerikanisches Paar auf der Sonnenseite des Lebens einem Kind geben kann: Eine behütete Kindheit in der saubersten Gegend von Queens, Liebe und Zuwendung, und die beste Schulbildung. Laura hatte eine Bilderbuchzukunft vor sich gehabt. Und dann plötzlich diese zwielichtigen Gestalten ... immer öfter waren sie ins Haus gekommen ...
"Das ist es ja, Jane." George machte sich von seiner Frau los. "Ich habe Leute vor Gericht verteidigt, die an der Nadel hingen. Leute wie diesen weichlichen Musiker. Glaub mir, Jane - solche Leute suchen erst Hilfe, wenn sie so tief im Sumpf stecken, dass sie keine Luft mehr kriegen ..."
Janes Augen füllten sich mit Tränen. Sie wandte sich ab und verließ das Zimmer.
Später hockte Everett mit einem Glas Cognac in seinem Fernsehsessel. Eine Comedy-Serie flimmerte über die Mattscheibe. Das Gelächter aus dem Off schnitt ihm ins Herz. Seine Gedanken schweiften ab. Er dachte an Benson Rainshadow, den Bauunternehmer mit der richterlich gereinigten Weste. Er dachte an die Leute, die seine Tochter in den Sumpf gezogen hatten - an den labilen Musiker vor allem, und an Lauras Klavierlehrerin. Und er dachte an die Gewehre in seinem Waffenschrank ...
2

|

|


Es war schon dunkel. Schneeregen und ein starker Westwind jagte die Passanten mit hochgeschlagenen Kragen und Regenschirmen über den Bürgersteig. Die vorbeirollenden Fahrzeuge spritzten ihnen Wasserfontänen vor die Füße und an die Hosenbeine. Ein Wetter zum Davonlaufen.
Der Wagen kam von der Williamsburg Bridge und hielt auf der Delancey Street, Ecke Clinton Street. Ein alter Chevrolet, schwarz und mit New Yorker Kennzeichen. Die rechte Hintertür öffnete sich. Ein Mann stieg aus. Ein Afroamerikaner in einem dunklen Trenchcoat. Er schlug die Tür zu und sah dem anrollenden Wagen hinterher, bis der sich wieder in den Verkehr auf Delancey Street eingefädelt hatte.
Zwei Telefonzellen standen an der Straßenecke. Der Mann betrat eine von ihnen. Eine schwarze Wollmütze, wie sie zurzeit in Hip-Hop-Kreisen beliebt ist, saß auf seinem kahlen Schädel. In jedem Ohrläppchen hing ein kleiner, goldener Ring. Der Mann nahm den Hörer ab und drückte eine Handynummer in die Tastatur des Kartenautomaten.
"Linus hier", sagte er, "kannst du reden? ... Macht nichts, sie sind jetzt unterwegs, mehr wollt ich nicht sagen ..." Er sah sich nach allen Seiten um. Die Rushhour löste sich langsam auf. Trotzdem rollten die Autos Stoßstange an Stoßstange über die Delancey Street. "Gut", sagte er in die Sprechmuschel. "Die Sache läuft ... und es gibt keinen Weg zurück mehr ..."
Sein Gesprächspartner schien ganz seiner Meinung zu sein. Der Mann namens Linus nickte und hängte dann den Hörer ein. Er verließ die Telefonzelle und winkte einem Cabby ...
3

|

|


Schneeregen klatschte an das große Fenster. Passanten mit hochgeklappten Jacken- und Mantelkrägen und eingezogenen Schultern wälzten sich auf der abendlichen Delancey Street vorbei. Manche klammerten sich mit beiden Händen an den Griffen ihrer Regenschirme fest. Ein starker Ostwind heulte durch die Straßen, zerrte an den Schirmen und ließ Mäntel und Schals flattern.
Die meisten Tische des Bistros warteten noch auf die Nachtschwärmer. An der Theke hingen sieben, acht Gestalten, tranken Bier, schlürfen Cola oder, wie ich, Tee mit Rum. Latinos, Afroamerikaner und Asiaten - nur einen Weißen außer mir hatte ich ausgemacht.
Er bestellte ein Bier nach dem anderen und rauchte Kette. Ein frustrierter Familienvater, schätzte ich. In den Kneipen der Lower East Side traf man sie häufig, diese traurigen Männer. Ohne einen ungesund hohen Alkoholpegel im Blut waren sie am Ende einer Woche einfach nicht in der Lage, die beiden freien Tage mit Weib und Kind anzutreten.
Ich lehnte gegen einen Stehtisch vor dem Fenster und blickte hinaus. Die Bar gegenüber interessierte mich. >Nighthole< hieß sie. Ein schlichter Name. Und ein ehrlicher. Er stand in Neonlettern über ihrem Eingang. Aber nur noch die zweite Hälfte der Buchstaben war erleuchtet, das >hole<.
In dem roten Backsteingebäude neben der Bar hatte man in uralten Zeiten Textilien produziert. Während meiner ersten Jahre beim FBI war das Gebäude von einer Hippie-Kommune besetzt gewesen. Auch schon wieder ein paar Jährchen her. Zwischendurch hatte eine Gruppe Latinos mit einer Sambaschule ihr Glück in den Gemäuern versucht, wenn ich mich recht erinnere. Und seit Anfang der achtziger Jahre gab es dort eine ziemlich große Armenküche der Heilsarmee. Nicht nur wir Menschen verändern uns.
Zwischen den beiden Gebäuden führte eine Durchfahrt zu einem Parkplatz hinter der Häuserzeile. Diese Durchfahrt interessierte mich fast noch mehr als die Bar. Ich registrierte jedes Auto, das von der Delancey Street in sie hinein abbog.
Seit fast einer Stunde stand ich schon in dem Bistro gegenüber des >Nighthole<. Mein Rumtee war längst kalt. Die Rosen neben dem Teeglas wirkten nicht mehr ganz frisch. Ich schwitzte unter der Pelzkappe, die ich mir über den Kopf gestülpt hatte. Meine Haut unter dem falschen Schnurrbart juckte.
Ich trug einen abgewetzten Lodenmantel und schwarze Cordhosen. Klamotten, wie man sie gegenüber bei der Heilsarmee kriegen konnte, wenn man auf der Straße lebte und nicht einmal mehr sozialhilfeberechtigt war.
Ich sah aus wie ein Flüchtling aus dem Balkan, der im Begriff war, den jämmerlichen Rest seiner Existenz im Big Apple in den Sand zu setzen. Frozzel, unser Maskenbildner hatte mal wieder gute Arbeit geleistet.
"Er kommt." Clive Caravaggios Stimme aus dem Kopfhörer unter der Ohrklappe meiner Pelzmütze. Clive hockte ein paar Häuser weiter auf der Straße, spielte Mundharmonika und sammelte Kleingeld in einem alten Hut. "Kennzeichen, Typ und Farbe wie beschrieben."
Wir wussten nur, welchen Wagentyp wir erwarteten. Den Mann, der den Wagen steuern würde, kannte auch unser Undercover-Agent noch nicht.
Ich griff nach meiner Teetasse und spähte zur Einfahrt hinüber. Das Scheinwerferpaar eines schwarzen Fahrzeugs schob sich heran und blinkte nach rechts. Mehr als zwei Schatten konnte ich hinter der Windschutzscheibe nicht erkennen.
Der Wagen bog in die Durchfahrt. Ein Chevrolet aus den frühen Neunzigern, das New Yorker Kennzeichen stimmte mit den Informationen unseres verdeckten Ermittlers überein. Und wenn alles so laufen würde, wie unser Mann es angekündigt hatte, dann verschwanden mit dem schwarzen Chevrolet gerade zehn Kilo Heroin auf dem Parkplatz der alten Textilfabrik.
Ich rieb mir mit dem Handrücken über die Nase, um die billige Digitaluhr in die Nähe meiner Lippen zu bringen. Sie war mit einem Mikro verwanzt. "An Milo und Jennifer", flüsterte ich, "sie sind zu zweit."
Mein Partner und Kollegin Jennifer Johnson hockten in einem grauen Mercury auf dem Parkplatz vor dem Hinterausgang der Bar. Natürlich spielten sie dort nicht Karten. Anders als Clive und mich hatte Frozzel sie nicht großartig stylen müssen. Sie mimten das Liebespaar.
Ich legte eine Münze neben das Teeglas, schnappte meine Rosen und verließ das Bistro. Die Kälte schlug mir ins Gesicht wie ein nasses Tuch.
"Drei Männer steigen aus dem Chevrolet." Diesmal Milos Stimme im Knopf meiner rechten Ohrenklappe. "Sie gehen zum Hintereingang." Ich barg meine armen Rosen unter dem Lodenmantel. Wir wussten nicht, wie viele Männer an dem Deal beteiligt sein würden. Wir wussten nur, dass er stattfinden sollte und dass der Stoff sich in dem Chevrolet befand. "Ein Schwarzer und zwei Weiße. Der Schwarze trägt einen braunen Ledermantel, die Weißen Felljacken. Jetzt betreten sie die Bar." Wieder Milos Stimme.
Ein Ambulanzwagen rollte vorbei - ich grüßte die beiden Sanitäter hinter der Windschutzscheibe nicht. Dabei kannte ich sie bestens. Und sie mich. Es waren Jay Kronburg und Leslie Morell.
Ich überquerte die Straße und schlenderte dem Eingang des >Nighthole< entgegen. Mit ein bisschen Glück würden wir heute die Früchte von drei Monaten Arbeit ernten. Solange war es her, dass wir unseren Undercover-Mann in den Dunstkreis der Drogenmafia von Lower Manhattan platzieren konnten. Ich stieg die Vortreppe zur Bar hinauf und öffnete die Tür.
Hier war das Nachtleben der Lower East Side schon weiter fortgeschritten als drüben in dem drögen Bistro. Schätzungsweise dreißig, vierzig Leute drängten sich um Tische und Theke. Die tief gehängten Lampen über den runden Tischen erhellten den Schankraum nur mäßig. Rauchschwaden hingen über den Köpfen der Männer und Frauen wie der herbstliche Morgendunst über dem Hudson. Ich ging auf den nächstbesten Tisch zu und bot meine mickrigen Rosen an.
Ich arbeitete mich von Tisch zu Tisch. Aus den Augenwinkeln suchte ich die Theke nach unserem Mann ab. Die meisten Leute hier konnten mit Rosen nichts anfangen. Die meisten winkten ab oder schüttelten den Kopf. Aber nicht nur das - verächtliche Blicke musterten mich, ein paar Nettigkeiten wurden mir an den Kopf geworfen - "Verpiss dich!", "Steck dir das Kraut in den Arsch!" und Schlimmeres.
Endlich entdeckte ich unseren Mann. Schwarze Lederjacke mit Pelzkragen, schwarzes Haar, dunkelbraune Wildlederhose. Auf dem Barhocker links neben ihm eine Frau. Schmales Gesicht, hochstehende Wangenknochen, blonder Zopf. Sie trug einen schwarzen, engen Pullover und einen grauen Minirock. Ihre schlanken Beine steckten in schwarzen Netzstrumpfhosen. Es leuchtete mir unmittelbar ein, dass unser Agent sich mit ihr angefreundet hatte.
Aus seinen Berichten kannten wir ihren Namen und ein paar persönliche Daten: Camilla Cane, vierunddreißig Jahre alt, eingeborene Manhattie, Musiklehrerin. In ihrem Apartment in SoHo veranstaltete sie wöchentliche Feten, auf denen man sich nicht nur mit Alkohol berauschte. Natürlich mit Gästen, die es nicht nötig hatten, für einen Schuss oder einen Streifen einer Rentnerin die Handtasche zu klauen oder eine Apotheke zu überfallen.
Unser Mann hielt Camilla Cane für eine wackere Drogenkonsumentin. Immerhin hatte sie ihm die Connection zu einer ganzen Reihe von Dealern ermöglicht. Über die kam er an die Zwischenhändler. Und über den Deal, der für diesen Abend geplant war, hofften wir einen der ganz fetten Fische des Drogenhandels an Land zu ziehen.
Auf den Barhocker rechts neben ihn setzte sich eben ein Mann in einem langen, braunen Ledermantel. Ein Afroamerikaner. Einer der beiden Männer aus dem Chevrolet.
Hinter der Theke arbeitete ein kakaobrauner Bursche. Zehnmillionen Rastalocken hingen ihm wie quastige Schafswolle von seinem Schädel ab. Seine Augen flogen ständig zwischen Zapfhähnen, Flaschen und Gläsern und den Leuten in seiner Kneipe hin und her. Einer dieser hellwachen Burschen, deren Lauerblicken nichts entging.
Langsam arbeitete ich mich zur Theke vor. Lauerauge stellte dem Schwarzen im Ledermantel ungefragt einen Whisky hin. Ich sah, wie der Ledermanteltyp seinen Autoschlüssel direkt neben den unseres Undercover-Manns legte.
"Wir wär's, Mister?" Ich bohrte meinen Rosenstrauß zwischen die Blonde und unseren Agenten. "Schöne Blumen für eine schöne Frau - die Lady könnte sich dankbar erweisen." Ich sprach mit dem holprigen Akzent eines Menschen, der gerade einen Kurs >Amerikanisch für Fortgeschrittene< absolviert hatte.
"Quanta costa, Kumpel?"
"Einen Dollar fünfzig Cents für drei dieser Prachtrosen." Damit wusste unser Mann, dass sie zu dritt gekommen waren.
"Okay", sagte er, und ich wusste, dass der Deal wie geplant stattfinden würde. Der Schwarze neben ihm stierte gelangweilt in sein Whiskyglas.
Die Blonde sah mich nicht einmal an. Aber ich sie. Eine schöne Frau. Ich beneidete unseren Maulwurf. Er kramte zwei Münzen aus seiner Tasche und drehte sich zu mir. "Hier, Kumpel. Versauf' es nicht gleich." Ich blickte in zwei dunkle, hellwache Augen und ein schmales, bronzefarbenes Gesicht. Das Gesicht eines Halbbluts. Das Gesicht meines Kollegen Medina ...
4

|

|


Wie oft hatte er in diese grünen Augen gesehen in den letzten drei Monaten. Zu oft, um jetzt ganz cool auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Medina nahm die Frau in den Arm und küsste sie. Erst ihre Lippen, dann ihren Hals. Ihre Haut fühlte sich an wie warmer Samt. "Kommst du zu mir, wenn du die Sache erledigt hast?"
Sie glaubte, er würde ins Auto steigen und mit dem Stoff zum Grand Central Terminal fahren. Sie glaubte, er würde den Stoff dort seinem Partner übergeben. Sie glaubte, er würde Jackie Cellar heißen.
"Ich komm' zu dir, Baby", log er. Er würde nie mehr zu ihr kommen. Noch einmal küsste er sie. Das Herz war ihm verdammt schwer. Aber gut - das waren so die ganz menschlichen Schwierigkeiten, die ein Undercover-Einsatz nun mal mit sich bringen konnte.
Orry machte sich von Camilla los. Aus den Augenwinkeln sah er Jesse mit seinem Rosenstrauß die Theke abklappern. Bei jedem Paar blieb er stehen und bot seine Blumen an. Stand ihm nicht mal schlecht, der Schnurrbart.
Der Vorhang zum Gang Richtung Hinterausgang lüftete sich. Milo Tucker und Jennifer Johnson schoben sich durch das Gedränge in die Bar. Kichernd und Arm in Arm. Gleich würde hier der Teufel los sein. Sobald Orry das Zeichen gab.
Scheinbar ohne genau hinzusehen, griff er nach dem Autoschlüssel rechts neben sich auf der Theke. Nicht einmal, dass dort zwei Schlüsselbünde lagen, schien er wahrzunehmen. Und der Schwarze in dem braunen Ledermantel guckte zufällig gerade weg, als Orry seinen Autoschlüssel von der Theke angeln wollte - und daneben griff.
Wie vereinbart schnappte er sich den Schlüssel zum schwarzen Chevrolet. Noch einmal drehte er sich nach Camilla um. Sie reckte den Daumen hoch und warf ihm eine Kusshand hinterher.
Orry drängte sich durch die Menge der Gäste zum Vorhang. Rechts und links davon standen zwei dünne Kerle in hellen Felljacken. Der eine war kahlköpfig und trug einen dicken Silberring im Nasenflügel. Der andere hatte eine von Pomade steife Bürste auf dem Kopf. Als Medina sich näherte, guckten sie so auffällig weg, dass er Bescheid wusste.
Er würde zum Chevrolet gehen, den Stoff prüfen, und wenn alles koscher war, seine Kollegen hier drin über Handy informieren. Und die würden blitzschnell zugreifen.
Der Vorhang fiel hinter ihm zurück, Orry lief durch den Gang an den Toiletten vorbei und drückte die Tür zum Parkplatz auf. Nasse Kälte schlug ihm entgegen. Es war kein kleiner Parkplatz, den sie hier hinter der alten Textilfabrik gebaut hatten. Gut hundertzwanzig Wagen standen um diese Zeit auf ihm. Und bis Mitternacht würden es noch einmal so viele werden.
Das Erdgeschoss der Heilsarmeeküche war erleuchtet. Orry sah zwei Männer aus dem roten Backsteingebäude kommen und zwischen die Wagen auf dem Parkplatz laufen. Er ließ seine Augen über die Parkreihen wandern.
Auf Anhieb konnte er den schwarzen Chevrolet nirgends entdecken. Sein Mittelsmann hatte ihm vorgestern den Wagen beschrieben. Auch das Kennzeichen kannte er. Seit seinem Rapport bei Clive und dem Chef heute Morgen sogar den Wagenhalter, dem man das Kennzeichen gestohlen hatte. Orry schlenderte auf den Parkplatz.
Etwa zehn Wagen trennten ihn noch von den beiden Männern, die aus der Heilsarmeeküche gekommen waren, als er den Chevrolet entdeckte. Die beiden Burschen öffneten eben die Vordertüren des Wagens und stiegen ein. "Hey, ihr Wichser!", brüllte Orry. Er hatte sich ziemlich tief in den Slang der Szene hineingearbeitet. "Weg von meinem Wagen!" Er spurtete los.
Es waren ziemlich junge Burschen. Für eine Sekunde sah Medina ihre Gesichter. Kurz bevor die zufallenden Türen die Innenbeleuchtung löschten. "Raus aus meinem Wagen ...!" Im Laufen zog er seine SIG Sauer.
Drei Kühlerhauben trennten ihn noch von dem schwarzen Wagen und dem weißen Stoff - die Druckwelle der Explosion schleuderte ihn über zwei Kühlerhauben zurück. Er hörte die Detonation, rutschte über Autoblech und prallte auf den Asphalt.
Wie durch einen Schleier hörte er Fenster und Türen aufgehen, Menschen um Hilfe und nach der Feuerwehr schreien, und keine zwei Minuten später das Geheul der sich nähernden Sirene ...
5

|

|


Ich hatte keinen Schimmer, was der laute Knall von draußen zu bedeuten hatte. Ich wusste nur, dass etwas absolut nicht nach Plan lief.
Der Donnerschlag aus dem Hinterhof von Bar und Armenküche ließ die Gespräche im >Nighthole< für Sekunden verstummen. Dann sprangen Männer auf und stürmten durch den Vorhang Richtung Hinterausgang. Ich hielt meine Billiguhr vor die Lippen. "Trevellian an Clive - auf den Parkplatz! Trevellian an Leslie und Jay - schaut nach Orry, verdammt! Irgendwas ist faul!"
Auch die blonde Frau drängte sich zum Hinterausgang. Der Schwarze neben Orrys leerem Barhocker zündete sich in aller Seelenruhe eine Zigarette an. Dann leerte er sein Glas, warf eine Münze auf den Tresen und rutschte vom Barhocker. Als ginge ihn die ganze Aufregung nichts an, schaukelte er dem Ausgang zur Delancey Street entgegen. Die beiden Gestalten in den Felljacken liefen hinter ihm her.
Vier Männer am Tisch neben der Tür sprangen auf. "FBI! Hände an die Wand! Beine breit! Ein Furz und es knallt!" Schon klickten die Handschellen. Die Kerle in den Felljacken machten prompt kehrt und rannten zum Gang, der zum Hinterausgang führte. Dort standen bereits Milo, Jennifer und ich. Die Männer machten nicht mal den Versuch, sich zu wehren.
Kaum hatten sich die Armbänder um ihre Handgelenke geschlossen, arbeitete ich mich mit Fäusten und Ellenbögen durch die Menge, die inzwischen in dem schmalen Gang geströmt war. "FBI!", brüllte ich. "Lassen Sie mich durch!"
Aus Meer von Autodächern draußen auf dem Parkplatz schlugen Flammen. Eine schwarze Qualmwolke schraubte sich in den Nachthimmel. "Bitte nicht", stöhnte ich. "Bitte nicht Orry ..." Ich rannte durch den Schneeregen zum Brandherd. Ein Feuerwehrwagen donnerte mit heulender Sirene durch die Einfahrt, an den Fenstern hingen Menschen, Gaffer sammelten sich in der Nähe des Feuers.
Es war der schwarze Chevrolet. Ich konnte so oft auf das Kennzeichen blicken, wie ich wollte. Es war und blieb dieses verdammte Drogenauto! Aus dem glaslosen Rahmen der Windschutzscheibe quoll Rauch. Dazwischen züngelten Flammen. Regen und Schneeflocken verdampften zischend auf dem glühenden Autodach. Ich sah zwei Gestalten hinter dem Steuer und auf dem Beifahrersitz sich krümmen ...
Ich hatte keine Erklärung dafür, warum ich zwei Menschen in dem Wagen verbrennen sah. Aber ich zweifelte nicht daran, das einer von beiden ein Special-Agent war ... Für Sekunden glaubte ich, Orry sterben zu sehen, und meine Eingeweide schienen sich in Beton zu verwandeln.
Bis ich seine Stimme neben mir hörte. "Diese Feuerbestattung hatten sie für mich gebucht, schätz' ich mal ..." Sie klang nicht besonders frisch, aber es war seine Stimme. Und sein verschrammtes, blutendes Gesicht sah nicht aus, als wäre er gerade aus der Dusche gestiegen - aber es war Orrys Gesicht ...
6

|

|


George Everett parkte seinen silbergrauen Porsche 911 Carrera im Hof des Criminal Courts Buildings. Es war ein früher Montagvormittag. Die Temperaturen waren über das Wochenende wieder um ein paar Grad gestiegen. Schneematsch und Pfützen breiteten sich im Hof aus.
George stieg die flachen Stufen zum zwei Stockwerke hohen Eingang hinauf. Zwischen zwei frei stehenden Granitsäulen spannte sich eine Glasfront. Unter ihr führten zwei Türen ins Gebäude. Schon rein äußerlich hatte das grauschwarze Criminal Court Building für George Everett schon immer etwas Bedrohliches gehabt. Man sah dem Haus förmlich an, dass sich in ihm das Manhattaner Untersuchungsgefängnis für Männer befand. Und dass man hinter seinen Mauern zu nachtschlafender Zeit Gerichtsverhandlungen abhielt.
George durchschritt das Gebäude und überquerte die sogenannte >Seufzerbrücke<, die über die Centre Street hinüber zur Haftanstalt führt. Normalerweise hätte er eine Pflichtverteidigung einem jungen Anwalt seiner Kanzlei aufgedrückt. Aber aus irgendeinem Grund hatte ihn der Fall Borgward von Anfang an interessiert. Und seit er sich über das Wochenende mit den Akten beschäftigt hatte, war George regelrecht heiß darauf, den Basketballer zu verteidigen.
Im Untersuchungsgefängnis führte man ihn in einen der kahlen, unfreundlichen Räume, die für die Gespräche zwischen Häftlingen und ihren Anwälten vorgesehen sind. Louis Borgward wartete bereits auf ihn.
Er sah schlecht aus. Schwarze Schatten lagen unter seinen geröteten Augen. Die Lider zuckten, und die Gesichtshaut wirkte trocken und rissig. Der Mann war blass. Wie ein zusammengesunkenes Häuflein Elend hockte er an dem schäbigen Tisch und starrte die Brandflecken auf der Holzplatte an.
George Everett kannte das. So sahen Leute aus, die ein tagelanges Verhörmarathon hinter sich hatten. Er legte seine Mappe auf den Tisch und drückte Borgward die Hand. Sein Händedruck war nicht schlaff, aber auch alles andere als kräftig.
George wandte sich zu den beiden Vollzugsbeamten. Ein Blick seiner grauen Augen genügte. Die Uniformierten verließen den Raum.
Der blonde, drahtige Anwalt galt als arrogant unter den Mitarbeitern des Untersuchungsgefängnisses. Und nicht nur dort. Selbst seine jüngeren Mitarbeiter fürchteten seinen scharfen, kritischen Verstand. Und er nahm ihre Arbeit genau unter die Lupe. Die Staatsanwälte fürchteten seine brillanten Plädoyers und viele Richter seine unberechenbaren Strategien während der Verhandlungen. George Everetts Name wurde nicht umsonst genannt, wenn man über die erfolgreichsten Anwälte Manhattans sprach.
Er öffnete seine Mappe und zog einen zusammengehefteten Stapel Papiere heraus. "Ich hab' mich heute Nacht mit ihrem Geständnis beschäftigt. Wir widerrufen es, sie haben es unter Druck abgelegt."
Der Basketballstar machte große Augen. "Aber ich habe das Schwein ..."
"Gut, dass Sie noch nicht unterschrieben haben."
"... ich habe das Schwein tatsächlich getötet, Mr. Everett!"
"Das würde Ihnen auch jedes Gericht nachweisen, Borgward." George steckte die Hände in die Hosentaschen und lehnte sich gegen die Wand. "Sie haben ihn getötet. Aber es gibt da feine Unterschiede, wissen Sie? Eine Tötung ist noch kein Mord. Und aus diesem Geständnis strickt ihnen die Staatsanwaltschaft eine Anklage wegen vorsätzlichem Mord."
Er sprach kühl und sachlich. Ein Autohändler, der einem Kunden die Vor- und Nachteile eines Modells erläuterte, hätte sich nicht wesentlich anders angehört. Mit großen ängstlichen Augen hing Borgward an den Lippen seines Anwalts.
"Vermutlich wird niemand es wagen, das Todesurteil gegen sie zu beantragen. Allein schon, weil die öffentliche Meinung auf ihrer Seite ist." Er zog einen Stuhl heran und setzte sich dem Häftling gegenüber. "Jeder Vater in Amerika versteht, was Sie getan haben, Borgward. Aber ich nehme an, sie haben ein Interesse daran, selbst ein Lebenslänglich oder fünfzehn Jahre zu vermeiden." Borgward schluckte. "Erzählen Sie, Mr. Borgward", forderte Everett ihn auf. "Erzählen sie alles über sich und ihre Frau."
Der Basketballer verbarg sein Gesicht in den Händen. "Dieses Schwein", stöhnte er. "Seit der Vergewaltigung ist Anne nicht mehr die, die sie einmal war ..." Mit stockender Stimme erzählte er von seiner Frau. Die Vierzigjährige war in einer Tiefgarage von einem jungen Burschen überfallen und vergewaltigt worden. Bei der Gegenüberstellung hatte sie den Mann wiedererkannt. Ein Luftwaffenunteroffizier. Doch die Verteidigung hatte drei Zeugen aufgeboten, die dem Mann ein Alibi verschafften. Er war freigesprochen worden. Borgward hatte ihm in einem Sportzentrum aufgelauert und ihn niedergeschossen.
Schweigend hörte George dem gebrochenen Mann zu. Hin und wieder machte er sich Notizen. Normalerweise bewahrte er eine kühle Distanz den Geschichten seiner Klienten gegenüber. Aber die Geschichte Borgwards ging ihm mächtig unter die Haut. Als er hörte, dass seine Frau ihren Beruf als Journalistin aufgeben und wochenlang in einer Psychiatrie behandelt werden musste, packte ihn die kalte Wut.
George Everett war ein kluger Mann - er wusste genau, was mit ihm los war.
Als er später in seinem Porsche über die nassen Straßen zu seiner Kanzlei nach Chelsea fuhr, dachte er an seine Tochter Laura. Niemand hatte sie vergewaltigt. Und trotzdem musste er mit ansehen, wie sie langsam aber sicher vor die Hunde ging. Und wie seine Familie daran zerbrach.
Verhasste Gesichter tauchten auf seiner inneren Bühne auf - das ausdruckslose Gesicht des Bauunternehmers Rainshadow - George hatte ihn ein paar Mal vor dem Sitzungssaal im Bezirksgericht gesehen.
Und das gefährlich schöne Gesicht von Lauras Klavierlehrerin. Er war ihr nur einmal persönlich gegenüber gestanden. Als er Laura vor vielen Wochen nach SoHo zum Klavierunterricht gefahren hatte. Dass diese Frau - Camilla Cane hieß sie - mit Drogen zu tun hatte, wusste er durch die Nachforschungen seines Privatdetektiven.
Und natürlich das schmale, nichtssagende Gesicht dieses verfluchten Musikers. Dreimal hatte Laura ihn mit nach Queens gebracht. Ein paar Tage, nachdem George ihm das Haus verboten hatte, war sie ausgezogen. Ihn hasste der Anwalt am meisten.
Zerstörung eines Menschen und seiner Familie durch eine Vergewaltigung, und Zerstörung eines Menschen und seiner Familie durch Drogen und die Leuten, die damit Geschäfte machten - George fragte sich, wo der Unterschied lag. Er fand ihn nicht besonders groß ...
7

|

|


Ein Feuerwerk aus farbigen Blitzen zuckte durch das hohe Gewölbe. Auf der Tanzfläche eine bebende Masse aus sich krümmenden Körpern, hochgeworfenen Händen, flatternden Haaren und Hemden. Bunte Nebelschwaden hingen über den Köpfen der Tanzenden. Aus den zahllosen an der heruntergehängten Decke versteckten Lautsprechern dröhnten, pfiffen und hallten Technorhythmen. Der künstliche Farbnebel stieg durch das Gitterraster der Decke und sammelte sich unter dem Kuppelbogen.
Bermuda blieb im Bogenportal des alten Wasserwerks stehen und versuchte sich einen Überblick zu verschaffen. Etwa zweihundert Menschen hielten sich in dem Nachtclub auf. Die meisten in seinem Alter oder jünger - also zwischen siebzehn und siebenundzwanzig. Es gab aber auch eine Reihe von Leuten, die deutlich über dreißig waren. Mike zum Beispiel, der Jazzpianist aus SoHo.
Wie meistens saß er an dem Tisch neben der Palme, die sich an der rechten Schmalseite der Theke der Gewölbekuppel des alten Wasserwerks entgegenstreckte. Als suchte sie einen Fluchtweg aus Lärm, Nebel und Lichtgewitter.
An Mikes Seite die Kleine mit den Rehaugen. Laura hieß sie. Die beiden klebten aneinander wie siamesische Zwillinge. Seit Monaten schon.
Bermuda verzog die wulstigen Lippen zu einem spöttischen Grinsen. Nichts für ihn, so eine Braut, die einem Tag und Nacht nicht von der Seite weichen wollte.
Wie immer hatte sich der kleine, etwas stämmige Latino mit dem voluminösen Lockenkopf ein Bild von der Lage im Wasserwerk gemacht. Ein erfreuliches Bild. Wenn er recht sah, war er der einzige Dealer an diesem Abend. Der Markt gehörte ihm. Fantastisch.
Zielstrebig steuerte Bermuda die Palme an. Mike Winter gehörte seit Jahren zu seinen besten Kunden. Nicht weil er übermäßig viel Stoff brauchte, sondern weil er laufend Bermudas Kundenkreis erweiterte. Bandmitglieder, Groupies, Bräute. Zuletzt die Kleine mit den Rehaugen. Winter wusste einfach, dass man sich an Bermuda halten musste, wenn man nicht übers Ohr gehauen werden wollte.
Bermuda trug einen schwarzen Lammfellmantel, einen schwarzen Schlapphut, schwarzes Hemd, schwarze Hosen. In dem Punkt war er konservativ. Der Mann mit dem >H< hatte schwarze Klamotten zu tragen. So war das schon zu Jimmy Hendrix Zeiten gewesen, und so hielt es Bermuda, seitdem er Stoff unter die Leute brachte. Auch wenn er Jimmy Hendrix nur aus den Erzählungen seiner Mutter und von einschlägigen Tonträgern kannte.
Ungefragt ließ er sich an dem Tisch des Paares nieder. "Hi, wie geht's so?" Er grinste das Mädchen an. Laura. Ihren Nachnamen kannte er nicht. Sie war niedlich, ohne Zweifel. Schön sogar, wenn man auf verträumte Lolitatypen stand. Gertenschlank, kleine Brüste unter dem engen, bauchfreien Top, und dann diese Rehaugen - wenn man sie zum ersten Mal sah, überfiel einen das Bedürfnis, sie in den Arm zu nehmen, um sie vor der bösen Welt zu beschützen.
Bermuda hatte noch keine drei Worte mit ihr gewechselt, obwohl er sie fast jeden zweiten Abend hier im Wasserwerk sah. Er kannte sie nur kichernd, tanzend oder schweigend an Mikes Hals und Lippen hängend. Angeblich war sie zweiundzwanzig Jahre alt und hatte mal Jura studiert. Bermuda schätzte sie auf höchstens siebzehn oder achtzehn.
"Wie soll's gehen." Mike Winter griff wie zufällig in die Außentasche seiner Lederjacke und holte eine Streichholzschachtel heraus. "Gut, Mann." Er war ein feingliedriger, fast zerbrechlich wirkender Mann Anfang dreißig. Sein volles, blondes Haar hing ihm offen und lang über die schmalen Schultern herab. "Pralinen dabei?"
"Glaubst du ich geh nackt aus dem Haus?" Bermuda holte eine Schachtel Kamel aus seinem schwarzen Lammfellmantel, zog die letzte Zigarette heraus und ließ die Packung achtlos auf den Tisch fallen. Er griff sich Winters Streichholzschachtel, entnahm das einzige Zündholz und warf einen prüfenden Blick auf die zusammengeknüllte Banknote in der kleinen Schachtel. Danach zündete er seine Camel an und versenkte die Streichholzschachtel in seiner Manteltasche.
Fast im gleichen Augenblick fuhr die kleine Hand des Mädchens über den Tisch und fasste nach der Camel-Packung. Sie steckte sie in den Lederbeutel, der hinter ihr über der Stuhllehne hing. Danach stand sei wortlos auf, warf sich den Beutel über die Schulter, und tänzelte an der Tanzfläche vorbei Richtung Toiletten.