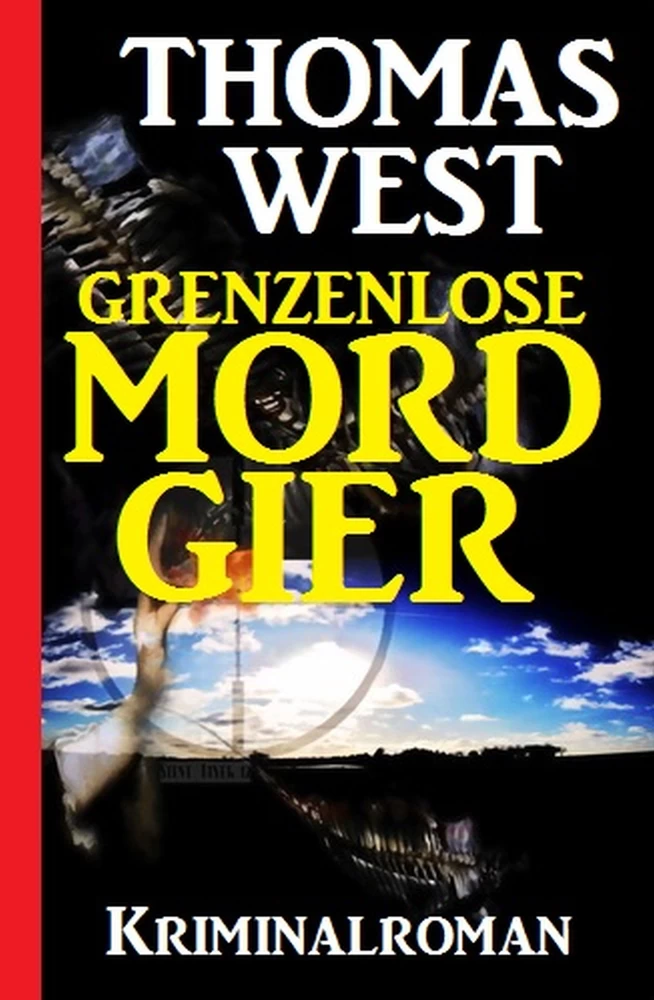Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Grenzenlose Mordgier
Published by BEKKERpublishing, 2017.
Grenzenlose Mordgier

|

|


Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 124 Taschenbuchseiten.
Vier farbige Jugendliche im Alter zwischen sechzehn und einundzwanzig werden innerhalb von drei Wochen auf ähnliche Weise ermordet. Das FBI – District New York – geht von einem Serienkiller aus. Die Special Agents Jesse Trevellian und Milo Tucker leiten die Ermittlungen der Soko, die fieberhaft nach Hinweisen sucht, und werden von der Psychologin Dr. Diana Westmount unterstützt, die ein Täterprofil erstellt. Unklar bleibt das Motiv für diese grausigen Morde an den schwarzen jungen Männern. Als ein weiteres Opfer gefunden wird, stellt sich heraus, das dessen Todeszeit mit der einer anderen Leiche an einem anderen Tatort übereinstimmt ...
Copyright

|

|


Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker.
© by Author
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
1

|

|


Mit glänzenden Augen und offenem Mund starrte Terry Anderson auf den Bildschirm. "Geil", grunzte er heiser. Ein Hardcoreporno flimmerte über die Mattscheibe. "He, Typ!" Mit der flachen Hand schlug er dem Mann rechts neben sich auf den Brustkorb. "Man traut dir solche Sauereien gar nicht zu!" Er lachte wiehernd und griff in die Gummibärentüte auf dem Schoß seines Nachbarn. "Wo hast du den geilen Schweinestreifen her?"
Der andere zuckte mit den Schultern. "Beziehungen. Kein Problem für mich", sagte er. Gleichzeitig tastete seine rechte Hand nach der Unterkante seines zerschlissenen Sessels. Während er mit einem fast scheuen Lächeln nach dem schwarzen Hals des jungen Terry schielte, zog er Stück für Stück eine Krawatte aus dem Federkern des an der Unterseite aufgeschlitzten Sitzes.
"Oh, Mann, oh, Mann!" Terry schnalzte vor Entzücken mit der Zunge und schnappte sich die Fernsteuerung von der Weinkiste, die ihnen als Tisch diente. "Die Szene muss ich mir noch einmal 'reinziehen!"
Er spulte die Videokassette zurück. "Wenn man dich zum ersten Mal sieht, möchte man schwören, dass du einer von den Typen bist, die Briefmarken sammeln und sonntags im Central Park ihr Modellboot über den Lake tuckern lassen!" Er grinste breit und boxte seinen Nachbarn freundschaftlich gegen die Schulter.
Der verzog sein schwarzes Kindergesicht zu einem verlegenen Grinsen. "Ich mach mal'n bisschen Musik." Er stopfte die Krawatte in seine rechte Hosentasche und stand auf. Die Musikanlage stand auf zwei Obstkisten neben der grauen Metalltür des kahlen Kellerraumes. Er bückte sich und schob eine silberne Scheibe in das CD-Fach. Sekunden später lärmte Elektrik Funk Music aus den Boxen. "Was zu trinken?", rief er laut, um die Musik zu übertönen.
"Klar, Mann."
"Whiskey?"
"Bloß nicht", Terry ließ seinen Auge keinen Augenblick von dem Sexfilm. "Wenn mein Alter das riecht, schiebt er 'nen Aufstand."
Der Mann mit dem Kindergesicht bückte sich zu der Flaschenbatterie neben der Musikanlage und angelte eine große Flasche Cola heraus. Langsam ging er zurück zu Terry.
>Play that funky music till I die ...<, griente es aus den Boxen.
"Hey, wenn ich das Sidney erzähle", rief Terry, ohne sich umzusehen. "Der wird solange nerven, bis ich ihn mal mitnehme in dein cooles Kellerloch." Er nahm die Flasche, die der andere ihm über die Schulter schob. "Ich darf ihn doch mal mitbringen, oder?"
"Bring ihn ruhig mit", die Stimme des Mannes hinter ihm war eine Spur heiserer geworden. Aber das merkte Terry nicht. Und weil seine gierigen Augen jede Bewegung der nackten Leiber auf dem Fernsehschirm aufsogen, hatte er keine Zeit, sich nach seinem Gastgeber umzusehen. Sonst wäre ihm aufgefallen, dass dessen Unterlippe bebte und seine Augen sich unnatürlich geweitet hatten.
"Weißt du - Sidney ist mein bester Freund ..."
Der Mann mit dem Kindergesicht griff in seine rechte Hosentasche und zog die Krawatte heraus. Sie war aus dunkelblauem Wildleder. Aber Farbe und Stoff waren kaum noch zu erkennen, und sie sah so abgewetzt und speckig aus, als hätte er sie in dem Abfallkübel eines der indischen Restaurants an der südlichen East Sixth Street gefunden. Er wickelte ihre beiden Enden je einmal um seine Handgelenke und hob sie langsam und mit zitternden Händen über den Rastalockenkopf des jungen Burschen.
"Du musst nämlich wissen: Sidney ist ein ganz scharfer Hund - er hat schon mal versucht in die Peep-Show unten an der zehnten Straße gegenüber vom Tompkins Square Park ..."
Ein würgendes Stöhnen schnitt den Satz jäh ab. Blitzschnell hatte der Mann hinter ihm die gestraffte Krawatte um seinen Hals geschlungen und zog mit aller Kraft zu. Und er konnte in solchen Augenblicken, auf die er tagelang zufieberte, eine fast dämonische Kraft entwickeln.
Terry ließ die Colaflasche fallen, versuchte nach dem schmalen Stoffstreifen an seinem Hals zu greifen und wand sich strampelnd in seinem Sessel.
Der Mann mit dem Kindergesicht warf sich über die Sessellehne auf ihn, die Brille rutschte ihm von seiner Stupsnase, fiel auf die ausgefaserte Bastmatte vor den beiden alten Sesseln, und er umklammerte Terrys wild zuckenden Körper mit seinen kurzen Beinen.
So heftig zog er an den beiden Enden der Krawatte, dass seine Arme bebten. Schweiß trat auf seine Stirn, und er keuchte und ächzte, als müsste er eine Waschmaschine in den sechsten Stock schleppen.
Terrys Gegenwehr erlahmte, und schließlich erschlaffte sein Körper. Gemeinsam rutschten sie vom Sessel auf die Bastmatte. Die Fernsteuerung polterte auf den Boden. Terrys Mörder blieb schwer atmend auf seinem Opfer liegen, minutenlang.
Irgendwann richtete er sich auf und tastete nach seiner Hornbrille. Die Fernbedienung lag vor Terrys Sessel. Er bückte sich nach ihr und schaltete Fernsehgerät und Videorekorder aus. Aus dem kleinen, blau gestrichenen Schränkchen, auf dem die Videoanlage stand, holte er ein gutes Dutzend langer, weißer Kerzen. Er verteilte sie im Kellerraum und zündete sie nacheinander an.
Am CD-Player drückte er den Wiederholungsknopf und stellte die Musik leiser. >Play that funky music till I die ...<
Vor seinem Sessel ging er in die Hocke, griff unter die Sitzfläche und zog ein abgegriffenes Pfandfindermesser aus dem Federkern des Sessels. Er legte es auf die Weinkiste neben eine der Kerzen.
Nicht weit von der Musikanlage entfernt, in einer der Ecken des fensterlosen Kellerraumes, stand eine riesige, ausrangierte Kühltruhe aus den siebziger Jahren. Der Mann öffnete sie und holte eine fleckige Kunststoffplane heraus. Er schob die beiden Sessel beiseite und breitete sie aus.
Dann rollte er Terrys Leiche auf die Plane und begann sie zu entkleiden.
2

|

|


Um mich herum das vertraute Klicken der Gurte - wie immer vor dem Landeanflug. Gespannt sah ich aus dem Fenster. Wir tauchten in die Wolkendecke ein. Sekundenlang weiter nichts als wabernde, graue Schleier. Und dann, von jetzt auf nun, zeriss der Wasserstoffvorhang: Unter mir glänzte der >Big Apple< in der Morgensonne. Umarmt vom tiefen Blau des Atlantiks streckte er uns seine Türme entgegen. Queens mit dem Kennedy Airport lag noch außerhalb unseres Blickfeldes.
Deutlich konnte ich jetzt die Statue of Liberty unter mir ausmachen. Und dann gleich den Zwillingsturm des World Trade Centers. Die Konturen der Stadt wurden deutlicher, und die Brooklyn Bridge schob sich in mein Blickfeld. Ich versuchte einige der vertrauten Steinriesen zu identifizieren: Das Woolworth Building, das United States Courthouse und natürlich den Chase Manhattan Bank Tower.
Die Wehmut über das Ende meines Urlaubes verflog. Keine Spur mehr davon. Das Gefühl, wieder zu Hause zu sein, erfüllte mich mit einem aufregenden Prickeln.
Die drei Wochen an der kalifornischen Küste waren prächtig gewesen: Surfen, sich im Sand räkeln und die Sonne auf den Pelz brennen lassen, und die süße Lady aus Columbus/Ohio, die sich schon am dritten Tag angeboten hatte, mich mit Sonnencreme einzureiben - all das war gut gewesen, wirklich. Aber zurückzukehren war fast genau so gut. Oder noch besser? Zurückzukehren und wieder zu wissen: Es gibt einen Platz, wo man hingehört.
Die Manhattan Bridge lag jetzt tief unter uns. Ich konnte sogar Fahrzeuge ausmachen. Am letzten Arbeitstag vor meinem Urlaub hatten Milo und ich einen syrischen Drogenhändler über die Brücke gejagt. Die Kollegen von der City Police hatten die 478 gesperrt. Der Mann war schließlich im Stau eingeklemmt gewesen, und wir hatten ihn greifen können.
Morgen schon würde ich mich in diesem bizarren Betongebirge dort unten wieder mit der unangenehmeren Sorte Mensch herumschlagen müssen. Und komischerweise freute ich mich fast darauf.
Und ich freute mich auch darauf, die vertrauten Gesichter wieder zu sehen - den Chef, Orry, Clive, und vor allem Milo. Ich lehnte mich zurück in meinen Sitz und schloss die Augen. "Ich würde sagen, der Urlaub hat dir gut getan, Trevellian", murmelte ich.
Als ich die Augen wieder öffnete, schaute ich in das braun gebrannte Gesicht einer jungen dunkelhaarigen Frau. Sie saß zwei Sitze rechts vor mir in der mittleren Sitzreihe des TWA Jets und schaute sich nach mir um. Offenbar hatte sie mich schon eine Zeit lang beobachtet. Unsere Blicke trafen sich für einen Moment, und sie wandte sich schnell wieder ab.
Die Frau war mir vorhin schon aufgefallen, als ich von der Bordtoilette zurückgekommen war. Die herbe Schönheit ihres schmalen Gesichtes hatte mich elektrisiert. Ich betrachtete den schlanken Nacken unter ihrem kurzen, schwarzen Haar, doch sie tat mir nicht den Gefallen, sich noch einmal umzudrehen. "Dann eben nicht", dachte ich und nahm mir vor, nachher, beim Aussteigen, in ihrer Nähe zu bleiben.
Die >New York Times<, die ich mir am Flughafen in Los Angeles gekauft hatte, war zwischen die beiden Sitze gerutscht. Mein Nachbar, ein grauhaariger Japaner, bemerkte mein suchendes Tasten und deutete mit einer Kopfbewegung auf den Boden. Ich bückte mich nach der Zeitung und schlug sie auf. Es war die Ausgabe von gestern, die Sonntagsausgabe.
Gleich auf der zweiten Seite fand ich die Bestätigung dafür, dass es richtig gewesen war, schon als Vierzehnjähriger meinen ersten Berufswunsch aufzugeben: Ich wollte als Junge Präsident der Vereinigten Staaten werden.
In drei Spalten verbreitete sich die Zeitung über den Sexhunger unseres derzeitigen Staatschefs. Schon wieder hatte sich eine junge Dame gemeldet, die mit ihm die Matratze und aufregendere Unterlagen geteilt haben wollte. Über Monate, wie sie behauptete. Und schon wieder stand ein Heer von anständigen Kongress- und Senatsmitgliedern mit erhobenen Zeigefinger auf und verlangte restlose Aufklärung der Vorwürfe.
Diese Leute, die immer die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ans Licht zerren wollten, hatten meiner Meinung nach eine Strafanzeige wegen staatsfeindlicher Umtriebe verdient. Oder wegen gefährlicher Langweilerei. Irgendwann würde der arme Mr. Präsident sich nicht einmal mehr in Ruhe einen runterholen können, ohne dass sich ein Untersuchungsausschuss damit beschäftigte.
"An deiner Stelle würde ich mit Rücktritt drohen", dachte ich und schlug die Innenseiten mit den Nachrichten aus der City auf. Sie lasen sich teilweise wie eine Vorschau auf mein Arbeitsprogramm für die kommenden Tage: Ein Bericht über den wachsenden Kokainmarkt in New York City, Überfälle auf asiatische Speiserestaurants, die mir verdächtig nach Racketeering rochen, und drei Mordfälle.
Den Bericht darüber sah ich mir genauer an. Drei schwarze Jungens waren getötet worden. Innerhalb der letzten zwei Wochen. Die Leichen waren unbekleidet und mit Spuren von Misshandlungen gefunden worden. Eine im Harlem River, eine im Pelham Bay Park und die dritte erst Ende letzter Woche in einem Wald in New Jersey, kurz hinter der Grenze zwischen New York State und New Jersey. Das würde wohl in den Zuständigkeitsbereich unseres District Office fallen. Vorausgesetzt, die Morde gingen auf das Konto desselben Täters.
Der Jet setzte zur Landung an. Seufzend faltete ich die Zeitung zusammen. Arbeitslos würde ich jedenfalls nicht werden.
Zwanzig Minuten später schob ich mich mit etwa zweihundert anderen Fluggästen durch das Terminal. Ich hielt mich immer zwei, drei Schritte hinter der Lady in Black.
Sie trug ihr schwarzes Jackett über dem Arm. Ihr ärmelloses, schwarzes Leinenkleid hing locker auf zarten Schultern und gestattete den Blick auf einen sommersprossigen Rücken, über den sich ein schmaler weißer Hautstreifen zog, den ihr Bikini vor Kaliforniens Sonne geschützt hatte. Ihre Schulterblätter tanzten unter der braun gebrannten Haut auf und ab, und wenn es tatsächlich so etwas wie eine Seele gibt, dann flatterte meine in diesem Augenblick zwitschernd unter meinem Zwerchfell herum.
Im Aufzug endlich schaffte ich es, neben ihr zu stehen. "Jetzt hat uns der >Big Apple< wieder", sagte ich und setzte mein charmantestes Lächeln auf.
Sie nickte nur stumm, aber so schnell pflegte ich nicht aufzugeben. "Ich war im Urlaub in Kalifornien", plauderte ich drauf los. "War schön, aber wieder zu Hause zu sein, ist auch nicht schlecht. Was meinen Sie?"
Sie lächelte immer noch nicht, aber sie konnte mich schlecht ignorieren. "Schwer zu sagen - ich bin in L.A. und New York zugleich zu Hause."
Ihre Stimme klang kühl, und zu mehr Small Talk war sie nicht zu bewegen. Die Aufzugstüren schoben sich auseinander. Immer noch Seite an Seite gehend steuerten wir die Telefonzellen an.
"Der August ist endlich vorbei, ich hoffe man kann in der City wieder durchatmen, ohne einen Schweißausbruch zu bekommen", versuchte ich es noch einmal. Der gute Milo hätte sich kopfschüttelnd abgewandt.
"Ja, hoffen wir's", sie nickte mir zu, was wohl eine Art Abschiedsgruß sein sollte, und trat unter eine der leeren Plexiglashauben, um zu telefonieren.
"Schade", dachte ich und ging weiter zur Gepäckausgabe. "Wirklich schade."
Trotzdem es erst kurz nach neun war und die Blechlawine in der Stadt wohl gerade den ersten der drei Tageshöhepunkte erreichte, entschied ich mich für ein Taxi, um nach Manhattan zu fahren. "Richtig zu Hause ankommen - dazu gehört mindestens eine Stunde Stau", dachte ich. Und heute hatte ich noch Zeit.
Später, von meinem anfahrenden Taxi aus, sah ich die Frau in Schwarz noch einmal. Mit einem Gepäckwagen verließ sie die Ankunftshalle. Es sollten nur etwas mehr als vierundzwanzig Stunden vergehen, bis ich ihr wiederbegegnen würde.
3

|

|


Das Taxi bog in die nächtliche Bagley Ave ein und stoppte vor einer Bar. "Hier?", fragte der Fahrer. Der dunkelhäutige Mann neben ihm nickte. "Dreißig Dollar", der ebenfalls farbige Fahrer zog seine Geldtasche aus dem Hosenbund.
Eine steile Falte erschien zwischen den Brauen seines Fahrgastes. "Dreißig Dollar?" Er drehte sich um und musterte seine beiden Begleiter im Fond des Cabbies. "Habt ihr das gehört, Jungs? Der Komiker hat gesagt >dreißig Dollar<!"
Die beiden schwarzen Gesichter auf dem Rücksitz verzogen sich zu einem spöttischen Grinsen. "Wahrscheinlich hat er sich versprochen, Jerome", sagte der Größere der beiden, "frag' ihn doch noch einmal, aber bleib höflich."
"Also gut", Jerome wandte sich wieder dem Taxifahrer zu. "Mein Cousin ist ein vernünftiger Nigger, musst du wissen, Bruder, einer der vernünftigsten, die ich kenne." Ein breites Grinsen entblößte seine perlenweißen Zähne. "Er neigt dazu, die Dinge mit dem Kopf und mit dem Mund zu klären, die ich gerne mit den Fäusten regele. Stimmt's Clearence?"
"Klar, Jerome, stimmt genau!" Ein trockenes Lachen kam aus dem Fond des Fahrzeugs.
"Tja, Bruder, und manchmal höre ich auf ihn." Er legte dem Fahrer die Hand auf die Schulter. "Sag uns doch noch einmal laut und deutlich, wie viele Bucks du für die kleine Spritztour vom Flughafen hierher haben willst, ja?"
Der Taxifahrer rutschte nervös auf seinem Sitz hin und her und verdrehte die Augen. "Oh Mann, ihr Arschgeigen! Fragt jeden verdammten Taxifahrer hier in Detroit!" Er deutete durch die Windschutzscheibe auf einen gelben Wagen, der eben zwanzig Meter vor ihnen hielt. "Dreißig Dollar für die Fahrt vom Metropolitan Airport in die Downtown - das ist verdammter Standard in dieser verdammten Stadt!" Er schlug ärgerlich auf das Lenkrad. "Wenn ihr weiße Stinkärsche wärt, würde ich euch um die Uhrzeit sogar fünfunddreißig abknöpfen!" Er stieß ein paar unverständliche Flüche aus und blickte trotzig aus dem Seitenfenster.
"Und wenn du ein weißer Stinkarsch wärst, dann würd' ich dir jetzt deine verdammten ..."
Eine Hand mit einem Zwanziger und zwei Fünfdollarnoten wurde aus dem Fond des Wagens gestreckt. "Hier, Bruder." Der Taxifahrer drehte sich um. Seine Augen wanderten misstrauisch zwischen den Dollars und Jeromes grinsendem Gesicht hin und her. Dann nahm er die Geldscheine, und die Hand fuhr ihm freundschaftlich über sein Kraushaar. "Nichts für ungut, mein Cousin steht immer kurz vor dem Siedepunkt. Hat's nicht so gemeint."
"Der Typ ist Boxchamp in New York City!", meldete sich nun auch der Bursche neben Clearence mit meckernder Stimme zu Wort.
Die drei Männer stiegen aus, und der Taxifahrer fuhr mit quietschenden Reifen an. "Jetzt geht ihm aber die Muffe!", lachte Jerome.
Sie drehten sich zu der Bar hinter ihnen um. "Ist das die Kneipe?", fragte Clearence. Jerome nickte und ging auf den Eingang zu.
Die drei jungen Männer hatten sich am Nachmittag auf dem La Guardia Airport eingecheckt. Jerome Valery und sein jüngerer Bruder Geoffrey hatten ihre Autowerkstatt in Stuyvesant Town zugemacht, und Clearence sein Bike in den Keller gestellt. Er betrieb einen Expresskurierdienst in Manhattan und radelte den ganzen Tag mit einer Kiste voller Briefen und Päckchen durch die Straßenschluchten.
Alle zwei, drei Monate unternahmen die drei solche spontanen Trips. Immer dann, wenn irgendein alter Freund Jeromes aus irgendeiner Metropole anrief und >battletime< meldete. >Battletime< - so nannte Jerome das, wenn es in einer Stadt zu Reibereien zwischen schwarz und weiß kam. Von Bandenkriegen bis zu ausgewachsenen Rassenunruhen - >battletime<. Und ihre Art des Tourismus nannte er >battletrip<.
Jerome war mit sechsundzwanzig der älteste der drei. Clearence und Geoffrey waren zwei Jahre jünger. Durch seine vier Jahre bei der Army hatte Jerome eine Menge Kontakte zu vielen schwarzen Brüdern in allen möglichen Großstädten des Landes.
Der Mann, der gestern in seiner Autowerkstatt angerufen hatte, stand groß und schlaksig an der Theke. Er erkannte Jerome sofort. Mickey ließ er sich nennen, und war der Kopf einer Jugendgang. Sie beherrschte einen beachtlichen Teil von Paradise Valley, dem schwarzen Viertel der Autostadt.
"GM hat dreihundert Jungs entlassen, alles Schwarze", mehr hatte Mickey gestern am Telefon nicht erklären müssen. Jerome wusste sofort, dass so etwas in einem Pulverfass wie Detroit der berüchtigte Funke werden konnte. Und Jerome fand nichts aufregender, als explodierende Pulverfässer. Vorausgesetzt natürlich, er befand sich im Zentrum der Explosion.
"Gimme five, Bruder!" Mit ausgestrecktem Arm kam Mickey ihnen entgegen. Handflächen, Knöchel und Fäuste knallten gegeneinander, und Jerome stellte seinen Bruder und seinen Cousin vor. "Wir machen Stunk heute Nacht", raunte der große Bursche, und bestellte vier Bier.
Darüber, dass General Motors auch hundert weiße Arbeiter entlassen hatte, hatte Mickey gestern am Telefon kein Wort verloren. Es hätte Jerome auch nicht interessiert, genauso wenig wie Geoffrey und Clearence das interessiert hätte.
Auch die Tatsache, dass dreihundert von vierhundert entlassenen Arbeitern so ziemlich genau dem Prozentsatz der farbigen Bevölkerung Detroits entsprachen, hätte sie nicht von ihrem >battletrip< abgehalten. Davon abgesehen, dass allenfalls Clearence ab und zu solche eher komplizierten Überlegungen anstellte.
Die drei Jungens aus New York City interessierten sich ausschließlich für das Chaos, in das solche und ähnliche Anlässe von Zeit zu Zeit führten. Prügeleien mit weißen Gangs, bei denen man jemandem ein Messer zwischen die Rippen schieben konnte, ohne groß aufzufallen. Und wenn eine Straßenschlacht dabei heraussprang - umso besser. Die eine oder andere Plünderung hatten die drei schon angezettelt. Und mit ein bisschen Glück konnte man in dem Durcheinander dann auch eine Frau in die dunkle Ecke irgendeines Hinterhofes zerren.
Mickey kam gleich zur praktischen Seite der bevorstehenden Aktion. "Ein paar Blocks weiter gibt's einen abgefuckten Schuppen, den >City Club<. Ein paar von den weißen Vorarbeitern verkehren dort mit ihren Bräuten. Und die weiße Gang, die uns letzte Woche eine Straße in Paradise Valley abgenommen hat."
Viel mehr wurde nicht geredet. Nach und nach trafen weitere Mitglieder der Gang ein. Nach dem dritten Bier, gegen Mitternacht, folgten sie Mickey aus der Bar. In einer Seitenstraße öffnete er den Kofferraum eines alten Kombis. Jeder, der nicht ausgerüstet war, angelte sich sein Werkzeug aus einem Pappkarton: Schlagringe, Messer, Totschläger, Spraydosen mit Reizgas. Die drei New Yorker griffen nicht zu. Sie waren bestens ausgerüstet.
Die etwa drei Dutzend Männer, alle zwischen achtzehn und dreißig Jahre alt, gingen in Dreier- und Vierergruppen die Bagley Ave hinunter, und verschwanden in Abständen von fünf Minuten in dem schmalen Treppengang, der in den Tanzclub hinabführte.
Unten hämmerte wilde Musik aus den Boxen, und die Stroboskop-Beleuchtung schleuderte ihre Blitze über die Masse der zuckenden Körper auf der Tanzfläche. Drei-, vierhundert Leute befanden sich in dem stickigen Kellerloch, schätze Jerome. Über die Hälfte Schwarze.
Geoffrey zog die bewährte Nummer ab. "Hey, Süße, gönn mir einen Tanz oder ich sterb", er musste schreien, um sich dem weißen Mädchen trotz der Musik verständlich zu machen, und er lachte sie dabei so unschuldig an wie er konnte. Und wenn jemand in Stuyvesant Town unschuldig lachen konnte, dann Geoffrey.
"Verschwinde, siehst doch, dass sie mit mir tanzt", der Partner des Mädchens, ein blonder Hüne, setzte eine grimmige Miene auf.
"Hast du was gegen Nigger?", brüllte Geoffrey.
Wie immer ließ Jerome seinem jüngeren Bruder ein bisschen Zeit, um den anderen zu provozieren. Dann kam sein Auftritt. Er drängte sich zwischen Geoffrey und den Hünen und versetzte dem Mann einen Stoß gegen den Brustkorb. "Du pöbelst meinen Bruder nicht noch einmal an, Saftarsch!"
Fünf Minuten später tobte die übelste Schlägerei. Glas und Holz splitterte, Menschen schrien nach der Polizei, und Männer gingen verletzt zu Boden. Die weißen Gäste waren völlig überrumpelt und hatten nicht die Spur einer Chance.
Viele drängten sich auf die Straße, wo die Prügelei weiterging. Die Polizei griff ein. Aber inzwischen hatte sich eine aufgepeitschte Gruppe von knapp zweihundert Schwarzen gebildet, die marodierend durch Downtown zog. Schaufenster gingen zu Bruch, es fielen Schüsse und ein paar Autos wurden umgekippt und abgefackelt.
Erst gegen Morgen gelang es der Polizei die Gruppe aufzureiben. Die Bilanz der gewalttätigen Nacht: Drei Tote, achtunddreißig zum Teil schwer Verletzte, zwei Vergewaltigungen, und ein halbes Dutzend geplünderte Läden.
Um diese Zeit saßen Jerome, Clearence und Geoffrey längst in einem gestohlenen Mitsubishi Kombi und fuhren auf der Interstate 80 am Eriesee entlang Richtung Cleveland. Von dort aus würden es noch fast siebenhundert Meilen bis nach New York sein.
"Mickey meint, wir sollen nächste Woche noch mal kommen. Bis dahin hat er seine Jungs wieder auf Vordermann gebracht", sagte Clearence. Er steuerte den Wagen.
"Okay - nächste Woche noch ein >battletrip< nach Detroit", Jerome stierte finster in die Morgendämmerung hinaus, "aber dann werde ich mehr als nur einen umlegen." Jemand hatte eine Flasche in seinem Gesicht zertrümmert. Die Nase war geschwollen. Die Schnittwunden hatte Clearence mit ein paar Pflastern zugeklebt.
"Abgemacht", Geoffrey lümmelte allein auf der hinteren Sitzbank. Aus einem gestohlenen, tragbaren CD-Player tönte Rapmusik. "Nächste Woche geht's noch mal nach Detroit!" Er sprach mit seiner typischen, hohen Meckerstimme. "Ich bin schon ganz heiß drauf. Vielleicht wird's doch noch mal so geil wie damals in L.A."
Geoffrey würde nie mehr nach Detroit fahren. Die wenigen Tage, die er noch zu leben hatte, würde er überhaupt nur ein einziges Mal noch aus seinem Viertel herauskommen. Und das, um zu sterben. Er stellte die Musik noch lauter und sang lautstark mit.
4

|

|


"Jetzt weiß ich endlich, was mir gefehlt hat in den letzten drei Wochen", sagte ich, während mir Mandy meine Tasse mit ihrem Kaffee füllte. Ich sog den Duft der dampfenden, schwarzen Brühe schnuppernd durch die Nase ein. "Wenn mich nicht alles täuscht, bin ich wieder zu Hause."
Mandy schenkte mir ein mütterliches Lächeln. "Freut mich, wenn ich Ihnen den ersten Arbeitstag ein bisschen leichter machen kann."
"Sie werden es nicht glauben, Mandy - Kaliforniens Sonne hat mir gut getan, aber ich freu' mich wieder hier zu sein."
"Hört, hört - der G-Man lag drei Wochen am Strand", höhnte Milo neben mir, "und jetzt will er uns weismachen, dass Kaliforniens Sonne ihn davon abgehalten hat, uns wenigstens mal eine Karte zu schreiben."
Ich grinste und dachte an die süße Lady aus Columbo/Ohio. "Eine einzige Karte mit einem einzigen kurzen Satz", fuhr Milo fort, ">es geht mir gut<, oder >geschieht euch recht, dass ihr im Big Apple schwitzen müsst< - aber er kam nicht dazu, die Sonne, die Sonne ...", er hielt Mandy die Tasse hin und mimte den Neidhammel. "Wie hieß sie denn, die kalifornische Sonne, die so viel Zeit beanspruchte?"
"Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen, Special Agent", sagte ich und spielte den Ahnungslosen. "Erzählen Sie mir lieber, womit Sie die Zeit totgeschlagen haben während meines Erholungsurlaubes."
"Das will ich Ihnen gerne sagen, Mr. Trevellian - zunächst einmal war ich ein paar Tage lang damit beschäftigt, Verhörprotokolle, Beweisaufnahmen und Berichte zu schreiben. Über einen Fall, den wir gemeinsam gelöst haben, bevor Sie ihren Erholungsurlaub antraten", er hob den Zeigefinger seiner rechten Hand. "Ich wiederhole: Gemeinsam gelöst haben! Aber einsam und mutterseelenallein musste ich die schwere und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, die Papiere für Washington und den Staatsanwalt zu schreiben. Der wollte ja schließlich den syrischen Gentlemen anklagen, den wir auf der Manhattan Bridge geschnappt hatten, gemeinsam geschnappt hatten, wohlgemerkt ..."
Mandy amüsierte sich köstlich, und ich stellte erleichtert fest, dass der gute Milo sich während meiner Abwesenheit genauso wenig verändert hatte wie der >Big Apple<. Seine wortreichen und ironischen Ergüsse, waren seine Art zu zeigen, wie froh er war, in der kommenden Zeit wieder mit mir zusammen losziehen zu können.
Der Chef trat ein. Er begrüßte mich mit ein paar kurzen Sätzen, und setzte sich zu uns in die Konferenzecke seines Büros. "Ich komme gerade von der City Police, deswegen meine Verspätung." Ich schielte nach der Uhr. Es war erst kurz vor acht, aber für Jonathan McKee schienen offizielle Arbeitszeiten keine Bedeutung zu haben. Oft war er schon vor sieben im Büro. Trotzdem sprach er von >Verspätung<. Er gehörte zu den Männern, denen es unangenehm war, wenn andere auf ihn warten mussten.
Er warf ein paar Unterlagen auf den Tisch. "Die Kollegen haben einen Mordfall an uns abgegeben. Vier schwarze Jugendliche - die Morde sind alle in dem vergangenen drei Wochen verübt worden." Er sah schon wieder auf seine Armbanduhr. "Ich habe am Wochenende eine Spezialistin für Serienmorde aus Los Angeles angefordert - unsere Leute dort haben sie mir wärmstens empfohlen. Sie wollte eigentlich um acht Uhr hier sein. Hoffentlich muss ich nicht alles zweimal erzählen."
"Und warum übernehmen wir den Fall?", wollte Milo wissen. Die angekündigte Spezialistin schien ihn nicht weiter zu interessieren.
"Eine der Leichen wurde im Staatsgebiet von New Jersey gefunden - und damit haben wir ein grenzübergreifendes Verbrechen."
Ich erinnerte mich an die Sonntagsausgabe der >New York Times<, die ich gestern Morgen im Flugzeug gelesen hatte. "Die Presse berichtet nur von drei Leichen."
"Dann haben Sie am Sonntag zuletzt Zeitung gelesen, Jesse", der Chef legte mir ein Blatt Papier vor die Nase. Eine Tatortanalyse, >Mordfall Terry Anderson< stand fett gedruckt und unterstrichen über dem Text. "Am Samstagabend wurde die vierte Leiche entdeckt. Neben dem Roosevelt Drive, am Rande des East River Parks."
Milo hatte inzwischen die Tatortfotos aus der Mappe gezogen. Ich beugte mich zu ihm hinüber. Der Tote war nackt und lag verkrümmt auf dem Bauch. Die untere Hälfte seines Rückens und vor allem das Gesäß waren von grässlichen Wunden übersät.
Ich wandte mich ab. Ein paar Bilder schossen mir durch den Kopf: Weißer Sand, haushohe Wogen und ein nackter, braun gebrannter Rücken, den ich fast drei Wochen lang mit Sonnenmilch - Lichtschutzfaktor 24 - eingecremt hatte.
"Der Junge war siebzehn Jahre alt. Letzte Highschoolklasse. Seine Eltern haben ein Schuhgeschäft in Stuyvesant."
"Und wie alt waren die anderen?", erkundigte ich mich.
"Der erste Junge sechzehn, der zweite einundzwanzig", der Chef suchte uns die Berichte der Pathologie heraus. "Tod durch einen Stich ins Herz, Tod durch zwei Schüsse in den Kopf", nacheinander blätterte er die Bericht auf den Tisch. "Und Tod durch Erdrosseln."
Milo und ich überflogen die Berichte. "Der Tote im Wald von New Jersey wurde erschossen. Das sieht doch ganz nach mindestens zwei verschiedenen Tätern aus?" Milo war skeptisch. Vielleicht suchte er auch nach Gründen, den Fall wieder zurück zur City Police zu schieben.
Einen Serienmörder zu fangen, war eine heikle Sache. Noch dazu, wenn die Opfer dunkle Hautfarbe hatten. Die Presse würde uns in den nächsten Wochen fast genauso intensiv beschäftigen, wie die Ermittlungen.
"Auf die Frage warte ich schon die ganze Zeit, Milo", unser Chef hob ein Foto hoch, auf dem eine helle, in Zellophan eingeschweißte Faser zu erkennen war. "Das hier ..."
In dem Moment öffnete Mandy die Tür und schaute herein. "Dr. Westmount ist da, Sir."
"Ah, endlich!" Jonathan McKee erhob sich und ging mit ausgebreiteten Armen auf die Tür zu.
Niemand hatte mich vorgewarnt. Und deswegen muss ich wohl ziemlich dumm geguckt haben als eine zierliche, schwarzhaarige Lady plötzlich im Türrahmen stand. Braun gebrannt und in einem engen, schwarzen Lederkostüm. Der herbe Schönheit aus dem TWA-Jet ...
5

|

|


Die Spielhalle war spärlich besucht um diese Zeit: Ein paar Schüler, ein paar Arbeitslose und die beiden Rentner, die fast jeden Tag um diese Tageszeit zum Billardspielen hierherkamen.
Der Mann hinter der Theke lehnte mit dem Rücken gegen den Tresen und starrte auf den Fernsehapparat in einem der oberen Regalfächer.
Die Mittagsnachrichten eines lokalen Fernsehsenders flimmerten über die Mattscheibe. Ein Kommentator berichtete von einem Friedhof aus. Aufmerksam betrachtete der Mann die mehr als hundertköpfige Menschenansammlung vor Zypressen und Ziersträuchern. Er griff hinter sich, wo eine aufgerissene Packung Gummibären auf dem Tresen lag, und stopfte sich eine Handvoll der bunten Süßigkeiten in den Mund. Ein Sarg wurde versenkt. Er kaute schmatzend und tastete wieder nach der Tüte.
"He, Babyface", eine Stimme ließ den Mann zusammenzucken, "schieb mal noch ein paar Quarters rüber." Der Angesprochene drehte sich um und blickte in das Gesicht eines etwa achtzehnjährigen Burschen, dessen Orange gefärbtes Haar stachelartig von seinem bis über die Ohren kahl rasierten Schädel abstand. Während der Punk ihm die Fünfdollarnote reichte, wanderte sein Blick zu dem Bildschirm hinauf. "Ist doch 'ne Sauerei, Ben, oder?" Mit einer Kopfbewegung deutete er auf den Fernseher. "Der Typ war jünger als ich."
Den Blick auf dem Bildschirm versenkte Ben die Fünfdollarnote in der Kasse und angelte eine Handvoll Vierteldollarmünzen heraus. Der Reverend irgendeiner Kirche hatte sich vor dem offenen Grab aufgestellt und hielt eine Rede.
"Schon der vierte", sagte der Punk, "in der Zeitung schreiben sie, dass es ein und derselbe Kerl gewesen ist." Er ließ sich zwanzig Quarters vorzählen. "Hoffentlich erwischen sie ihn schnell. Ich würde mich freiwillig melden, um ihm die Eier abzureißen."
Der Mann hinter dem Tresen sagte nichts. Er sah dem Punk nach, der zu seinen Kumpels an die Wand mit den Videospielen zurückging und nahm sich seine Hornbrille von der schweißglänzenden, schwarzen Nase. Mit einem Taschentuch putzte er sorgfältig die Gläser.
Sein stämmiger, fettleibiger Körper war nicht größer als 165 Zentimeter. Es war kaum möglich, sein Alter annähernd korrekt zu schätzen. Sein schwarzes Kindergesicht wirkte wie das eines Sechzehnjährigen. Da er aber selbst im größten Verkehrschaos nicht mit der U-Bahn, sondern mit einem roten Ford Mustang, Baujahr 1981, zu der Spielhalle seines Onkels in der Lower East Side fuhr, musste er mindestens achtzehn sein.
Nur die beiden Veteranen am Billardtisch kannten sein wirkliches Alter. Sie waren in jüngeren Jahren begeisterte Fans seines Vaters gewesen, der nicht nur hier in South Manhattan, sondern im ganzen Staat New York ein bekannter Box-Champion gewesen war. Und sie wussten, dass Cane Lesley exakt an dem Tag die Landesmeisterschaft im Mittelgewicht gewonnen hatte, als er Vater wurde. Und das war vierundzwanzig Jahre her, zweieinhalb Jahre bevor >Blizzard< Random ihm den Titel wieder abgenommen und ihn für immer k.o. geschlagen hatte.
Ben Lesley setzte die Brille wieder auf und schaute auf den Bildschirm. Immer noch der Bericht über die Beerdigung. Er griff wieder in die Tüte mit den Gummibären. "Ohne dich gäb es diese Bilder nicht", der Gedanke kroch ihm wohltuend aus irgendeinem Winkel seines Hirns ins Gesicht und verzog es zu einem geradezu vergnügten Lächeln.
Er sah die vielen Menschen um das Grab stehen - vor allem die vielen Jungen und Mädchen aus der Highschool - und dachte: "Wenn's dich nicht gäbe, Benjamin Lesley, ständen die jetzt nicht da. Du hast mindestens zweihundert Leute in Bewegung gebracht."
Ein etwa siebzehnjähriger Junge trat aus der Menge - groß, dunkelhäutig, kräftig gebaut und mit Rastalocken. Er hielt einen Basketball vor dem Bauch.
Das Lächeln verschwand von Bens Gesicht, und er stellte den Fernseher lauter. >Sidney Lewis, der Kapitän der Basketballmannschaft der Armstrong-Highschool, wird jetzt im Namen der ganzen Mannschaft ein paar Abschiedsworte für seinen Freund und Mannschaftskameraden sprechen<, tönte die Stimme des Kommentators aus dem Apparat.
"Du wirst uns fehlen, Terry...", sagte der Junge. Tränen liefen ihm über das Gesicht. Bens Augen weiteten sich und seine wulstige Unterlippe bebte. "Du warst in Ordnung, Terry. Wir können nicht begreifen, warum ausgerechnet dir so etwas passieren muss ...", er stockte und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Ben tastete nach der Fernbedienung unter der Theke. "Gott wird deinen Mörder strafen!", krächzte der Junge auf dem Bildschirm. Dann ging er in die Hocke und ließ den Ball in das Grab fallen.
Die Kamera fing eine von Weinkrämpfen geschüttelte Frau ein - Terrys Mutter. Ben schluckte trocken, hob die Fernbedienung und schaltete auf einen Musiksender um.
"Hey, Babyface!", protestierte es hinter ihm. Er fuhr herum und sah sich seiner versammelten Kundschaft gegenüber. Sie mussten in den letzten beiden Minuten an den Tresen gekommen sein, um den Bericht über die Beerdigung des Mordopfers zu verfolgen. "Warum zappst du das weg?!" Der mit den orangen Haaren schrie am lautesten. Seinen Augen waren feucht.
"Ich ... ich dachte, ihr hört vielleicht lieber Musik ..."
"Quatsch, Mann! Schalt' um!" Es blieb Ben nichts weiter übrig, als wieder den Nachrichtensender einzuschalten. Der Bericht war gerade zu Ende. Er atmete auf.
Seine Gäste zerstreuten sich wieder und kehrten zurück zu Billardtischen, Videogeräten und Spielautomaten. "Ich verfluche den Tag, an dem New York den elektrischen Stuhl eingemottet hat", brummte einer der beiden alten Männer.
6

|

|


"Dr. Diana Westmount", unser Chef wies auf uns, "Mr. Jesse Trevellian und Mr. Milo Tucker. Die Gentlemen sind Special Agents des FBI-Districts New York."
In ihren großen, braunen Augen meinte ich ein kurzes Flackern zu sehen. Sonst deutete nichts daraufhin, dass sie mich wiedererkannte. Doch ich war sicher, dass sie es tat. Einen Menschen, dessen Gesicht man noch am Tag zuvor im Flugzeug betrachtet hatte, vergaß man nicht innerhalb von vierundzwanzig Stunden.
Höflich, wie man beim FBI nun mal war, standen wir auf und drückten der Lady die Hand. Milo strahlte wie ein Honigkuchenpferd. "Hallo, Mrs. Westmount - freut mich sehr, Sie kennenzulernen", sagte er. Ich sagte gar nichts.
"Mrs. Westmount ist Psychiaterin. Sie arbeitet auf Honorarbasis häufig für die City Police in Los Angeles und für unser District Office dort und hat seit einiger Zeit eine freie Praxis hier in New York."
Er sah sie fragend an und sie nickte. "Ihr Spezialgebiet ist die Erstellung von Täterprofilen." Wieder wandte er sich der Frau zu. "Bei Serienmorden an der Westküste arbeiten Sie eng mit unseren Spezialisten in Quantico zusammen, nicht wahr, Mrs. Westmount?"
In Quantico, unserem Ausbildungszentrum in Virginia, saß eine Spezialeinheit, die überall in den Staaten konsultiert wurde, wenn es um Serienmorde ging. Wir in New York hatten auch schon mit diesen Cracks zusammengearbeitet.
"Ich bin dankbar für Ihre Mitarbeit, Mrs. Westmount. Wir sind an einer möglichst raschen Aufklärung des Falles interessiert", die Miene unseres Chefs wurde ziemlich ernst. "Sie wissen ja, Gentlemen, wie empfindlich die Öffentlichkeit auf solche Morde reagiert."
Wieder wandte er sich der Frau zu. "Ich war gerade dabei, den Stand der Ermittlungen zusammenzufassen, Mrs. Westmount", sagte der Chef und fing noch einmal von vorn an.
Die Frau hörte schweigend zu. Sie wirkte auf mich distanziert - nicht direkt kühl, aber doch so, als hätte sie eine starke Festungsmauer um sich errichtet. Das Flattern unter meinem Zwerchfell machte sich wieder bemerkbar.
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2017
- ISBN (ePUB)
- 9783738913644
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Oktober)
- Schlagworte
- grenzenlose mordgier