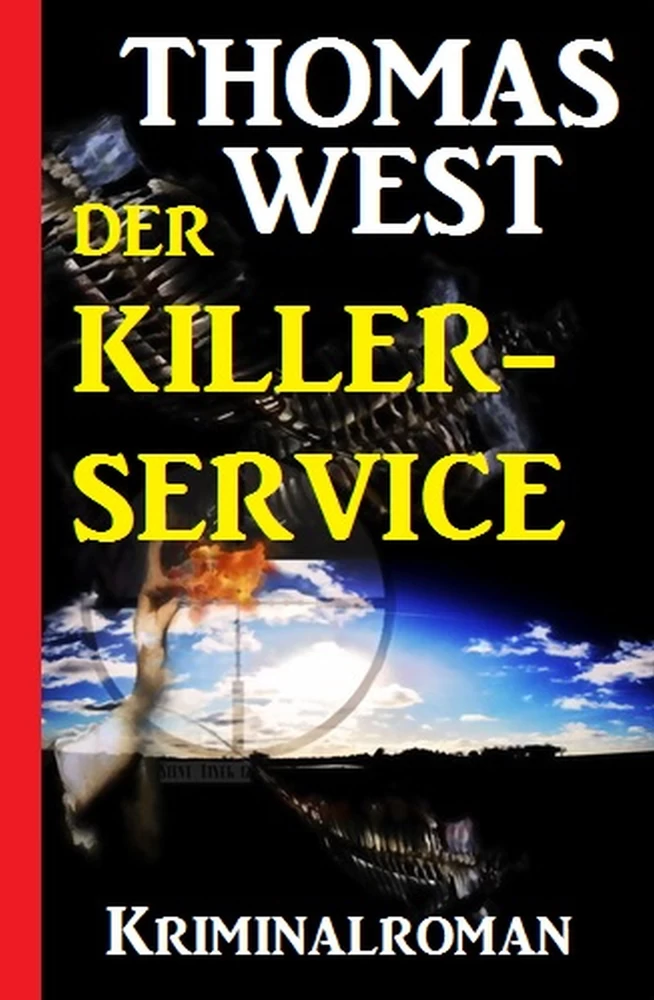Zusammenfassung
Dr. Bob Eriksons Fallschirm öffnet sich nicht. Ein Unfall oder Mord?
Der Schriftsteller Merchand stirbt an einer Überdosis Insulin.
Was haben all diese Fälle gemeinsam? Jesse Trevellian und Milo Tucker ermitteln unter Zeitdruck...
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Der Killer-Service
Published by BEKKERpublishing, 2017.
Copyright Page
This is a work of fiction. Similarities to real people, places, or events are entirely coincidental.
DER KILLER-SERVICE
First edition. May 20, 2017.
Copyright © 2017 Thomas West.
ISBN: 978-1386773351
Written by Thomas West.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Der Killer-Service

|

|


Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 126 Taschenbuchseiten.
Die reiche Theresa Vanhouven wird entführt, bevor sie ihren Flug nach Amsterdam antreten kann. Warum zeigen sich die Entführer unmaskiert?
Dr. Bob Eriksons Fallschirm öffnet sich nicht. Ein Unfall oder Mord?
Der Schriftsteller Merchand stirbt an einer Überdosis Insulin.
Was haben all diese Fälle gemeinsam? Jesse Trevellian und Milo Tucker ermitteln unter Zeitdruck...
Copyright

|

|


Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker.
© by Author
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
1

|

|


Theresa Vanhouven nahm eine Zigarette aus dem silbernen Etui und steckte sie in die Elfenbeinspitze, ein Geschenk ihres Großvaters, das er ihr drei Jahre vor seinem Tod von einer Elefantenjagd in Tansania mitgebracht hatte. Durch das Fenster sah sie ihren Chauffeur, der von der Einfahrt her, wo der Benz stand, zum Hausportal eilte. Statt den Kiesweg zu nehmen, hastete er über den Rasen.
Theresa sah auf ihre goldene Armbanduhr: 9 Uhr 20. Wenn sie ihren Flug um 11 Uhr 50 bekommen wollte, mussten sie in spätestens 15 Minuten losfahren. Schon die kurze Strecke vom Central Park zur Queensboro Bridge stellte um diese Zeit die Geduld eines jeden Auto fahrenden New Yorkers auf eine harte Probe. Und dann musste ja immerhin noch ganz Queens durchquert werden, um zum Kennedy Airport zu gelangen. Dass der Kennedy Airport für sie in diesem Moment schon so unerreichbar war wie der Jupiter oder eine Hauptrolle in einem Spielberg Film, das konnte Theresa noch nicht ahnen...
Sie seufzte, schob den schweren, nachtblauen Brokatvorhang beiseite und öffnete das Fenster. »Sind die Koffer schon im Wagen, Wash?«
Der auffallend kleine, farbige Chauffeur blieb neben dem Springbrunnen stehen und gestikulierte nervös. »Die Zündkabel sind kaputt, Madam. Wahrscheinlich durchgebissen von einem Marder!«
Theresa verdrehte die Augen, schloss das Fenster und wandte sich um. Ihr Mann stand zwischen den beiden halb offenen Türflügeln zum Salon. »Soll ich dir ein Taxi rufen, Theresa, oder willst du deinen Flug verschieben?«
Einen Augenblick spielte Theresa tatsächlich mit dem Gedanken, erst den Nachtflug nach Amsterdam zu nehmen. Doch es war ihr Lebensmotto, einen Vorsatz, und sei er noch so lächerlich, erst dann zu verschieben, wenn auch wirklich alle Umstände dagegen sprachen. Ihr Großvater hatte sie so erzogen. Alles ist möglich nur aufgeben nicht, pflegte er zu sagen.
»Ist gut, William«, seufzte sie unwillig und ließ sich von ihm Feuer geben. »Ruf mir ein Taxi.« Und so nahm das Verhängnis seinen Lauf.
»Und wenn du das nächste Mal mit dem Bürgermeister Golf spielst, frage ihn, wann er endlich etwas gegen die Marder im Central Park zu unternehmen gedenkt«, rief sie ihm nach.
Während er von der Bibliothek aus telefonierte, trat sie erneut ans Fenster, warf einen sehnsüchtigen Blick auf den Zufahrtsweg, der von der Straße auf das Grundstück der Vanhouvens führte. Aber es war nicht zu hoffen, das Hausmädchen würde jetzt schon vom Einkaufen zurückkehren. Sie hatte den Van genommen und war erst vor 20 Minuten weggefahren.
Und den Chrysler hatten die Zwillinge. Sie waren schon am frühen Morgen damit nach Boston aufgebrochen. Sie hatten eine Semesterfeier.
Sie seufzte noch mal und murmelte dann: »Viele Wege führen nach Rom.« Auch so ein Leitsatz ihres Großvaters.
Theresa nahm ihre Pelzjacke unter den Arm, durchquerte mit dem für sie typischen schnellen Schritt das Kaminzimmer und öffnete eine Tür. Dahinter lag ihr Heiligtum das Puppenzimmer.
Sie trat ein, und während sie sich die Jacke überstreifte, ließ sie ihre Augen über die zahllosen Puppen wandern, die das Zimmer bevölkerten. Puppen aus Porzellan, aus Holz, aus Stoff, aus Kunststoff, aus Glas.
Sie lagen in Wiegen, saßen auf Sesseln, auf Kinderstühlen, Schaukelpferden und Sofas und standen in Glasvitrinen und Regalen. Puppen aus aller Herren Länder und aus mindestens vier Jahrhunderten.
»So, meine Kleinen, es ist mal wieder so weit - ich fliege für ein paar Tage nach Europa - schön brav bleiben.« Sie sprach, als hätte sie die Sonntagsschulgruppe vor sich, der sie fast jeden zweiten Sonntag biblische Geschichten erzählte.
Mitten im Zimmer, auf dem alten Ohrensessel ihres Großvaters, saß eine besonders große Puppe in einem langen, weißen Seidenkleid.
Theresa nahm sie auf und strich ihr über das goldblonde Haar. »Keine Angst, Prinzessin in einer Woche bin ich wieder hier.« Ein zärtlicher Ausdruck legte sich auf ihre Züge.
Sie setzte die Puppe wieder in den Sessel und ging zur Tür zurück.
»Ich bring euch neue Geschwister mit. Denkt an mich!«
Natürlich war es ein Spleen. Aber ein Spleen, der ihr das Leben gerettet hatte.
Damals, vor fast 20 Jahren, als ihre kleine Tochter gestorben war. Damals hatte sie angefangen, Puppen zu sammeln.
»Das Taxi ist da!«, rief William.
»Ging ja flott.« Theresa ging in die Eingangshalle und schaute in den überdimensionalen Spiegel neben der offen stehenden Tür nach draußen. Sie zupfte sich eine Fluse von der Pelzjacke und betastete kurz mit beiden Händen den strohblonden Haarturm auf ihrem schmalen Kopf.
Niemand sah ihr ihre 48 Jahre an.
»Ich komme!«, rief sie dann und schritt durch die hohe Eingangstür nach draußen, wo William schon stand und auf sie gewartet hatte, um sie zu verabschieden.
»Pass gut auf dich auf, Darling.« Er zog sie an sich und küsste sie auf die Stirn.
»Ach, William - ich fliege doch nicht in die Mongolei!« Sie sah Wash, den Chauffeur, und einen jungen rothaarigen Mann ihr Gepäck in den Kofferraum des gelben Taxis laden. Der junge Mann trug ein leichtes schwarzes Jackett über ausgewaschenen Jeans.
»Ich habe Nancy einen Speiseplan für eine Woche geschrieben.« Sie löste sich aus seiner Umarmung. »Achte drauf, dass David den Salat isst.« Sie lief die paar Stufen zur kiesbestreuten Zufahrt hinunter. »Und Henry hat mir versprochen, dass er mit seinem Bruder am Sonntag in die Kirche geht.«
William nickte und winkte ihr nach. »Es wird alles so laufen, als wärst du da«, rief er. »Grüß den Bischof von mir!« Außer in ihren privaten Angelegenheiten reiste Theresa auch als Delegierte ihrer Kirche in die Niederlande. »Und viel Erfolg bei deinen Geschäften!« Sie wollte auch noch einen Kunsthändler in Amsterdam treffen, der ihr wertvolle Puppen aus Kasachstan angeboten hatte.
»Danke!« Sie überzeugte sich davon, dass Koffer und Taschen zu ihrer Zufriedenheit verstaut waren. »Worauf warten wir noch, junger Mann? Brechen wir auf.«
Der Taxifahrer hielt ihr die Tür auf. Sie bemerkte das kleine Kreuz am Goldkettchen im Ausschnitt seines ein paar Knöpfe offenen Hemdes. Auch die vollen Lippen fielen ihr auf.
Ein sinnlicher Mensch, dachte sie und ließ sich auf die Rückbank fallen.
»Warten Sie!« William tauchte plötzlich neben dem Cabby auf. »Bringen Sie bitte das Gepäck meiner Frau in die Flughalle.« Er drückte dem Mann eine 20-Dollar-Note in die Hand.
»Wird gemacht, Sir.«
Der Fahrer stieg ein und fuhr los.
Theresa drehte sich nur kurz um und winkte. »Geben Sie Gas, junger Mann! Auf keinen Fall will ich meinen Flug verpassen.«
Er nickte.
Sie schaute nach vom. Im Rückspiegel bemerkte sie ein unruhiges Flackern in seinen Augen.
Abgesehen von Puppen interessierte Theresa nichts so sehr wie Menschen.
»Haben Sie irische Vorfahren?«
Er nickte.
Sie ahnte nicht, dass sie den Taxifahrer noch sehr gut kennen lernen würde. Besser, als ihr lieb sein konnte.
Der Stau in der Upper East Side überraschte sie nicht.
»Ich nehme eine Abkürzung«, sagte der Fahrer und bog in eine Seitenstraße ein. Kurz darauf wieder und dann noch einmal.
Theresa verlor die Orientierung. »Wo sind wir hier?« Sie sah ein großes Schaufenster mit der Aufschrift >Antiquitäten<.
Plötzlich riss der Rotschopf das Steuer herum, stach in eine gewölbeartige Hofeinfahrt. Kurz vor dem Hof bremste er so scharf ab, dass Theresa gegen die Lehne des Beifahrersitzes geschleudert wurde.
Ihre Tür wurde aufgerissen, und Theresa sah die massige Gestalt eines kahlköpfigen Mannes.
Er warf sich auf sie, drückte sie auf die Sitzbank, versenkte seinen eisernen Griff in ihren Haarturm und riss ihren Kopf in den Nacken.
Theresa schlug um sich, Theresa versuchte zu strampeln,Theresa schrie, und Theresa spuckte in die brauenlosen, eisgrauen Augen über ihrem Gesicht.
Doch ihr Gegner war ihr an Gewicht, Kraft und Brutalität weit überlegen. Sie spürte noch das feuchte, stinkende Tuch auf Nase und Mund dann versank das Innere des Cabbies, ihre Wut und die eisgrauen Augen über ihr in einem wabernden schwarzen Nebel.
2

|

|


In unserer Branche schlüpft man in alle möglichen Rollen. Die des friedlichen Joggers, der an einem Spätsommernachmittag durch den Central Park läuft, zählt zu den angenehmeren.
Ich stellte meinen Fuß auf den Brunnenrand der Bethesda Fountain und schnürte meine Laufschuhe. Zum zehnten Mal an diesem Nachmittag.
Aus den Augenwinkeln beobachtete ich Jay Kronburg. Er spielte heute den Freizeitpapi und saß vor einem Kinderwagen am rechten Rand der Terrasse auf einer Bank. Von hier aus konnte man den kleineren Teil des Sees überblicken.
Clive Caravaggio und Leslie Brendell waren auf der anderen, größeren Seite des Sees mit Modellbooten beschäftigt.
Ich drehte mich zum Wasser um. In einem der Ruderboote saß ein knutschendes Pärchen. Milo hatte natürlich wieder das große Los gezogen. Die Beamtin, mit der er sich dort beschäftigte, war noch nicht lange bei uns im New Yorker District. Eine Anfängerin praktisch. Und verteufelt hübsch.
»Ich glaub, ich hab sie.« Jays Stimme quäkte im Knopf in meinem rechten Ohr.
Ich drehte mich um und machte ein paar Dehnübungen. Jay duckte sich hinter das Gebüsch und spähte durch seinen Feldstecher.
»Der Mann mit dem Strohhut und die beiden Freaks - seht ihr sie?«
Unsere Leute, die unsichtbar entlang der Uferböschung auf der Lauer lagen, bestätigten. Auch ich sah die beiden Ruderboote. »Sie fahren direkt aufeinander zu«, gab ich durch.
»Auf geht’s, Jesse«, hörte ich wieder Jays Stimme. »Dein Auftritt.«
Ich rannte los. Bis zur Bow Bridge, an der nach unseren Informationen der letzte Teil des Deals abgewickelt werden sollte, würde ich ziemlich genau sechs Minuten brauchen. Das hatten wir vorher abgecheckt.
Ich nahm den Weg durch das Wäldchen. Die vielen Menschen, die an diesem Nachmittag den Park bevölkerten, taten genau dasselbe wie wir: Modellboote auf dem See herumtuckern lassen, knutschen, Kinder hüten und joggen. Oder angeln, wie Medina in einem Boot auf dem größeren Seeabschnitt.
Dass wir in Wirklichkeit im Begriff waren, eine professionelle Geldfälscherbande in die Falle zu locken, konnte keiner ahnen, der einen von uns beobachtete.
Ich wich einem Rollstuhlfahrer aus, und die Gruppe von Bikern, die mir entgegenkam, musste meinetwegen abbremsen.
»Saftarsch!«, knurrte mir einer der Radfahrer hinterher.
Um nicht aufzufallen, warf ich ihm eine ähnliche Freundlichkeit an den Kopf.
»Auf der Brücke hat sich ein Angler aufgepflanzt.« Das war Medinas Stimme. »Er wirft jetzt seine Leine aus.«
Ich bestätigte.
Ein Hacker hatte uns den Tipp gegeben. Einer von diesen überkandidelten Computerfreaks, die sich so großartig Vorkommen, weil sie in den Datenschatztruhen fremder Leute wühlen können. Dass er uns gegenüber anonym bleiben wollte, war deshalb klar. Aber sein Tipp hätte nicht heißer sein können.
Wir hatten einen Undercover-Agenten in die Firma einschleusen können, die er uns genannt hatte. Nach sechs Wochen Maulwurfsarbeit hatten wir die Fakten, die wir brauchten, auf dem Tisch: Drei Informatiker der Firma trafen sich nach Feierabend in einem Keller, wo sie an einer lukrativen Software arbeiteten ein Programm, mit dem man eine fast fehlerfreie Druckvorlage für Hundertdollarnoten herstellen konnte.
»Der Kerl mit dem Strohhut hat was ins Wasser gelegt«, gab Jay durch. »Jetzt sind die Boote auf gleicher Höhe. Die anderen Burschen fischen das Objekt aus dem See sieht aus wie ein Styroporwürfel.«
Jeder von uns wusste, was dieser Würfel enthielt: Die Diskette mit der Druckvorlage.
»Übergabe fotografiert«, meldete einer unserer Leute aus der Uferböschung.
»Okay«, sagte Jay, »Milo und Kate - ihr schnappt euch den Strohhut. Alle anderen konzentrieren sich auf die beiden Freaks.«
Die Diskette war also in den Händen der Geldfälscher. Eine halbe Million hatten sie dafür bezahlt. Sicher nicht, um Papierservietten damit zu bedrucken.
»Ich seh' sie jetzt, sie kommen direkt auf die Brücke zu.« Medinas Stimme.
Ich verließ den Wald und trabte ein Stück am Ufer entlang. Das Boot mit den beiden jungen Männern verschwand etwa 100 Meter vor mir hinter einer Trauerweide, die ihr Geäst weit über den See streckte.
Der Uferweg führte in ein weiteres, kleineres Waldstück. Jetzt trennten mich noch höchstens zwei Minuten von der Brücke.
»Verdammt!«, fluchte mir Medina ins Ohr. »Ich hab’s doch geahnt! Die Burschen haben das Päckchen an der Angelleine befestigt. Der Kerl auf der Brücke holt die Angel ein!« Ich spurtete los.
Der Wald lichtete sich. Ein Inlineskater wich mir erschrocken aus. Die Brücke lag vor mir.
Der Angler löste gerade den Styroporwürfel von seiner Leine, als er mich entdeckte.
Er riss das Päckchen ab, rannte davon. Mitten durch eine Gruppe von jungen Frauen mit kleinen Kindern.
Die Kids schrien los, ein Buggy mit einem Knirps stürzte um.
Der Kerl bog in ein Wiesenstück ab, sprintete über die Picknick Decke einer Großfamilie, hielt auf den Wald zu.
Kurz vor dem Waldrand hatte ich ihn. Ich hechtete mich auf ihn, rammte ihn zu Boden und hebelte ihm den Arm gegen das Schulterblatt. »FBI«, schrie ich, »Ende der Show!«
Vom See her hörte ich Schüsse. Die Burschen im Boot leisteten Widerstand. Irgendjemand rief laut. Leute entfernten sich fluchtartig vom Seeufer und suchten Deckung im Wald.
Nach fünf Minuten war alles vorbei. Die Kollegen nahmen mir meinen Fang ab und führten ihn in Handschellen ab.
Ich sah mich um. An der Brücke standen die Mütter und versuchten ihre schreienden Kinder zu trösten. Auf der Brücke tauchte Leslie auf. Mit einem Modellboot unter dem Arm.
Ich ging ihm entgegen und musste grinsen. Leslie war nicht zum Lachen zumute. »Medina hat einen der beiden erwischt«, sagte er.
»Kopfschuss. Der andere hat aufgegeben.«
»Und Milo?«
Leslie nickte nur.
Wir wandten uns den weinenden Kindern zu. Ich nahm Leslie das Modellboot und die Fernsteuerung ab und drückte ihm dafür das Päckchen mit der Diskette in die Hand.
»Kommt, ich zeig euch was Schönes.«
Die Kinder und ihre Mamis folgten mir tatsächlich zum Seeufer. Dort setzte ich das Modell ins Wasser und ließ es auslaufen. Die Kids strahlten. Nach fünf Minuten konnten sie's selbst.
Ich richtete mich auf und sah noch ein Weilchen zu, wie sie mit dem Boot die schnatternden Enten über den See scheuchten.
Grinsend schlenderte ich zur Brücke zurück. Dort lehnten Milo und Kate Bergenson über dem Geländer. Sie mussten mich schon eine ganze Weile beobachtet haben.
»He, Jesse, ich wusste gar nicht, dass du seit neuestem Enten jagst nach Feierabend«, grinste Milo.
Und Kate hob drohend den Zeigefinger. »Ich werde dem Tierschutzverein einen Wink geben, Mr. Trevellian.«
»Tun Sie das, Ma’am, vielleicht bekomme ich eine kleine Anerkennung dafür, dass ich den gelangweilten Enten ein wenig Zerstreuung verschaffe.« Ich wandte mich überrascht an Milo. »Das war ein Scherz mit dem Feierabend ich kenn dich doch, Partner. Sicher hat unser Chef angerufen und den nächsten Job in Aussicht gestellt.«
»Jesse, im Ernst«, beteuerte Milo, »angerufen hat er aber er will erst morgen unseren Bericht.« Er klopfte mir auf die Schulter. »Kommt, ich lad euch zu einem Drink ein.«
Kate ging uns ein Stück voraus. »Und?«, flüsterte ich. »Hast du ihre Privatnummer?«
Milo winkte grinsend ab. »Seit gestern schon. Sie taut langsam auf.«
»Glückwunsch«, sagte ich und drehte mich noch einmal nach dem See um.
Er lag so friedlich vor dem Laubwald, als wäre nichts geschehen.
Der idyllische Anblick passte zu meinem Gemütszustand. Zufrieden war ich - mit mir und der Welt. Und mit meinem Job. Sehr zufrieden.
Ich ahnte nicht, dass ich schon vier Tage später wieder hier zu tun haben würde. Genau an der gleichen Stelle. Aber weit entfernt davon, mit irgendetwas oder irgendjemandem zufrieden zu sein.
3

|

|


»Verflucht! Das Miststück hat einen Lebenswillen wie eine alte Katze.« Howard Newby wandte seinen kahlen Quadratschädel dem Badezimmer zu und fuhr sich vorsichtig über die Wange. Bei dem kurzen Handgemenge mit der Frau hatte er sich einen blutenden Kratzer eingehandelt. »Bullshit!«
»Jetzt heult nicht!«, fauchte Marilyn. »Wir müssen uns beeilen! Los, zieht sie aus!«
Der Rothaarige beugte sich über Theresa Vanhouvens reglosen Körper, der in der Mitte des kleinen Raums lag. Zusammen mit dem Kahlkopf begann er, ihr die Kleider vom Leib zu reißen.
»Macht bloß nichts kaputt!«, zischte Marilyn. Sie knöpfte ihre Bluse auf, warf sie auf die verschlissene Couch neben dem Fernseher und stieg aus ihrem Rock.
Der Rothaarige warf einen verstohlenen Blick auf den makellosen Körper der knapp 50jährigen Frau.
»Glotz nicht so, Barry!«, fuhr sie ihn an. »Her mit den Klamotten!«
Sie schlüpfte in die Kleider der Bewusstlosen und stülpte eine Perücke über ihr blauschwarzes Haar.
»Wie kann man nur so rumlaufen.« Vor dem Spiegel stopfte sie sorgfältig ihre schwarzen Strähnen unter die strohblonde, hoch aufgetürmte Kunstfrisur. »Binde sie gut fest, wenn sie so wild ist, sonst beißt sie dir noch irgendwohin, wenn sie aufwacht!«
Das galt dem Kahlkopf. Sie schlug ihm flüchtig auf die Schulter und tippte eine Nummer ins Telefon. Eine rauchige Frauenstimme meldete sich.
»Wir haben sie«, sagte Marilyn.
»Gut gemacht, Kinder. Mach dir ein paar schöne Tage in Amsterdam.«
Marilyn legte auf. »Die Chefin ist zufrieden. Los, Barry, wir müssen.«
Der Rothaarige folgte ihr in die Hofeinfahrt. Sie sprangen ins Taxi. Barry stieß rückwärts auf die Straße hinaus.
Um 11 Uhr 16 betraten sie die Flughalle des Kennedy Airports. Barry stellte die Koffer ab und eilte zum Schalter. »Amsterdam. Ist der Flug schon abgefertigt?«
Der Mann am Schalter verneinte.
»Uff!«, stöhnte Barry. »Hab meine Berufsehre verwettet, dass ich die Lady pünktlich zu ihrem Flug bringe.« Er deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Marilyn, die ihnen den Rücken zuwandte. »War wieder das reinste Löcherbohren in Manhattan.«
Dann schnappte er sich das Gepäck und trug es durch die Kontrolle. »Gehört der Lady da.« Wieder der ausgestreckte Arm, wieder ein Blick diesmal der des Angestellten an der Gepäckannahme auf Marilyns Rücken. »Mrs. Vanhouven.« Barry senkte seine Stimme. »Zu fein, um die U-Bahn oder ein Shuttle zu nehmen, und zu geizig, um mit dem Helikopter zu fliegen.«
Zehn Minuten später saß Marilyn in der Maschine. Nach dem Start zündete sie sich eine Zigarette an. Unter sich sah sie den Big Apple in der tiefblauen Umarmung des Atlantiks Zurückbleiben.
Ein zufriedenes Lächeln huschte über ihr hübsches Gesicht. Sie musste an die Zeit auf dem College denken, damals in Texas, noch keine zehn Jahre her. »Ich werde mal nach New York gehen und ganz groß rauskommen!«, hatte sie ihren Freundinnen verkündet. Auch dem Direktor hatte sie das gesagt. An dem Tag, als er sie rausschmiss, weil sie die Finger nicht von den Jungs und den Drogen lassen konnte.
Marilyn lachte in sich hinein. Sogar zwei der jungen Lehrer hatte sie verführt in ihrem letzten Jahr auf dem College.
Den Traum von New York nahm sie mit, als sie bei Nacht und Nebel von zu Hause ausriss damals - sie war gerade 17 geworden. Aber es war ein langer Weg nach Babylon, verdammt lang und verdammt schmutzig, Gott weiß.
Nach ein paar jämmerlichen Jahren in L. A., wo sie sich als Pornodarstellerin durchgeschlagen hatte, war sie in Atlanta gelandet. Der Chef eines Begleitservice hatte sie dort hingelockt. Doch das Leben als Edelnutte war dermaßen widerlich gewesen, dass sie sich nur mit Kokain über Wasser halten konnte. Eines Tages hatte sie einen von diesen geilen Ölscheichs ins Spielkasino begleitet. Und dort hatte die Chefin sie entdeckt. Und sie mit nach New York City genommen. Okay, groß rausgekommen war sie nicht. Aber sie verdiente mehr Geld, als sie sich je hätte träumen lassen. Es ging ihr gut, seit sie für die Chefin arbeitete. Unverschämt gut.
In Amsterdam steuerte sie die nächste Telefonzelle an und meldete dem Kontaktmann ihre Ankunft. Damit war ihr Auftrag erledigt.
Sie stieg in einem teuren Hotel ab, tourte durch einige Nachtbars, rauchte ein paar Joints und schleppte einen der großmäuligen Möchtegernkünstler, wie man sie in einschlägigen Cafés der Stadt fand, in ihr Hotelzimmer ab. Er war nicht gut, aber besser, als es sich selbst zu machen.
Am nächsten Abend flog sie zurück nach New York.
4

|

|


»Okay, Bob wir haben die Position erreicht!« Der Pilot drehte sich um und reckte den Daumen nach oben. »Hals und Beinbruch!«
Bob winkte und schob sich die Schutzbrille nach unten über die Augen. Der Flugbegleiter riss die Tür der kleinen Maschine auf. »Guten Flug, Dr. Erikson!«
Bob klammerte sich mit seinen in dicken Lederhandschuhen steckenden Händen am Türrahmen fest. Nur einen Augenblick sah er auf den grünen Flickenteppich etwa 3.000 Fuß unter sich. Dann stieß er sich ab.
Er breitete die Arme aus und streckte die Beine leicht gegrätscht von sich. Und schon stabilisierte er sich in der X-Lage und rauschte bäuchlings in die Tiefe. Die Luft zerrte an seinem Overall, und er gab sich ganz dem Anblick hin, der sich ihm bot.
Unter ihm breitete sich die von zahlreichen Seen durchbrochene Waldlandschaft des Nordzipfels von New Jersey aus. Im Osten, über dem Atlantik, dämmerten die ersten Grauschleier der Nacht herauf.
Etwas weiter nördlich wölbte sich die Dunstglocke, unter der der Big Apple vor sich hin stank. Im Westen stand der Glutball der Sonne über dem Horizont.
Bob liebte es, um diese Stunde zu springen, wenn der Tag zu Ende ging und die Sonne ihr mildes Abendlicht auf Wälder, Städte und Straßennetze streute. Und für wenige Augenblicke die Illusion gestattete, die Welt dort unten sei ein hübscher, friedlicher Ort, an dem man ohne Angst vor Kriminellen, Fanatikern, Militärs, verrückten Politikern und Finanzbehörden leben konnte.
Ein rauschhaftes Hochgefühl überkam ihn. In solchen Momenten vergaß Bob, dass knapp zwei Autostunden entfernt, unter dieser hässlichen Dunstglocke, in einem Haus, das sein Haus war, eine Frau, die seine Frau war, es gerade mit einem ihrer Lover trieb, und irgendwo in der Upper East Side dieser verdammten Stadt Manager, deren Chef er war, sich in diesem Augenblick überlegten, wie sie ihm morgen wieder ans Bein pinkeln konnten.
Er schlug einen Rückwärtssalto. Und noch einen. Und noch einen. Versuchte einige Spiralen zu drehen und schrie dabei vor Begeisterung laut und anhaltend. Dann ging er zurück in die Freifallhaltung.
Die dunkle Wand über dem Meer hatte sich näher geschoben, und die Sonne schien den Horizont jetzt zu berühren.
Er genoss noch einige Sekunden lang dieses unbezahlbare Gefühl von Freiheit und versuchte dann den Wagen auszumachen, den sein Sohn am Rand der Lichtung dort unten geparkt hatte. Als er den winzigen Farbtupfer entdeckte - seinen Sohn selbst konnte er noch nicht erkennen - zog er die Leine. Er bereitete sich auf den typischen Ruck vor, mit dem er in die Brust und Schultergurte stürzen würde, wenn sich der Schirm öffnete.
Doch nichts dergleichen geschah.
Erstaunt schaute Bob nach oben. Der Schirm hatte sich nicht geöffnet!
Das war ihm in über 20 Jahren Fallschirmspringen erst zweimal passiert. Einmal in Panama, als er mit der Army dort stationiert war, und das zweite Mal vor acht Jahren, an seinem 45. Geburtstag.
Trotzdem tat Bob instinktiv das, was ihm der Colonel eingeschärft hatte, bei dem er das Fallschirmspringen gelernt hatte: Er riss an der Leine für den Notschirm.
Schlagartig verwandelte sich die durchtrainierte Blutpumpe in seiner Brust in einen Eisklumpen - auch der Notschirm öffnete sich nicht!
Die Kälte schoss ihm bis in die Zehenspitzen und auch in die Wurzeln der wenigen Haare, die ihm noch geblieben waren.
Er zerrte an den Leinen, er brüllte vor Panik, er schlug mit beiden Händen auf den Verpackungssack auf seinem Rücken - es tat sich absolut nichts. Nichts.
Bob riss die Augen auf und sah die Baumwipfel auf sich zurasen. Sein Gezappel hatte ihn ein wenig abdriften lassen. Die Lichtung, auf der er landen wollte, lag plötzlich viel zu weit rechts.
Noch höchstens zehn Sekunden, schoss es ihm durch den Kopf, und als würde mit einem Mal eine lang verschlossene Tür in seinem Schädel aufspringen, ergossen sich hunderte von Bildern in seine Hirnwindungen: Bob bei der Feier anlässlich seiner Berufung in die Geschäftsführung, Bob mit einem Säugling im Arm, Bob mit seiner Braut Muriel im Portal der lutherischen Kirche, Bob mit Doktorhut, Bob mit seiner Basketballmannschaft im College, Bob auf seinem ersten Fahrrad, Bob im Laufstall, Bob... Das letzte Bild überflutete sein Hirn mit wohliger Wärme, die sich fast zärtlich in seinem ganzen Körper ausbreitete - ein Gesicht. Es war das schönste Gesicht, das er je gesehen hatte, das Gesicht einer Frau - seiner Mutter...
Er spürte keinen Schmerz, als er mit der Geschwindigkeit einer Granate in das starke Geäst einer Eiche einschlug.
Die Äste zertrümmerten seine Wirbelsäule und seine Rippen in Dutzende von Knochenfragmente...
5

|

|


Milo wirkte, als hätte er zehn Stunden am Stück durchgeschlafen. Dass das nicht der Fall sein konnte, lag auf der Hand: Bevor er an diesem Dienstagmorgen zu mir ins Auto stieg, winkte er zu seinem Fenster hoch, von dem aus eine junge Dame zurückwinkte Kate, der neue Stern am Himmel unseres FBI Distriktes.
»Hat sie frei heute?«, fragte ich vorsichtig.
Er bestätigte und schwärmte mir dann so wortreich von der Lady vor, dass ich erst wieder zu Wort kam, als wir die Tiefgarage am Federal Plaza erreichten. Offenbar war er total verliebt. Seine Euphorie schien mir fast ein bisschen übertrieben.
Aber ich beruhigte mich, indem ich mir in Erinnerung rief, dass ich die Welt und gewisse Frauen darauf ähnlich lobenswert zu finden pflegte, wenn Amor mich von Zeit zu Zeit erwischte. Beruhigend daran war vor allem die Erfahrung, dass sich solch exotische Zustände nach ein paar Tagen oder Wochen wieder legten. .
Als wir dann allerdings vor dem Büro unseres Chefs Mandy begegneten, trat Milo vor lauter rosa Laune in ein gewaltiges Fettnäpfchen. »Guten Morgen, Mandy!«, tönte er strahlend. Und dann: »Ein neues Kleid! Steht Ihnen wahnsinnig gut!«
Mandy trug das dunkelgrüne Midikleid mit dem angedeuteten Schlitz auf der linken Seite und dem eigenartigen Glanz, der ihm etwas Kunststoff artiges verlieh. Sie hatte es vor zwei Jahren zum ersten Mal an, als unser Chef sein - ich weiß nicht wievieltes - Dienstjubiläum feierte.
Ich hatte das Kleid deswegen nie vergessen, weil es mich schon damals an eine Tante erinnerte, die sich gerne in ähnlich grünen Stoff hüllte und die immer fromme Lieder mit mir singen wollte, wenn sie zu Besuch kam. Ich hatte von einer Kollegin erfahren, dass irgendein verflossener Lover, den Mandy nicht vergessen konnte, ihr dieses Kleid geschenkt hatte. Anders war auch wirklich nicht zu erklären, dass sie sich nicht von dem grünen Ding trennen wollte.
Jedenfalls errötete sie leicht, deutete ein Nicken an, und verschwand im Vorzimmer.
Milo sah mich fragend an. Die Chance, ihn auf den Teppich zu bringen, schien mir günstig, und ich erzählte ihm, was ich über das Kleid wusste. Danach war mein Partner wesentlich ruhiger.
Die anderen liefen nach und nach ein, und wir versammelten uns im Büro von Mr. McKee.
Der Chef hörte sich unseren Bericht mit unverhohlener Befriedigung an. »Gute Arbeit, Gentlemen, gratuliere!«
Mandy kam mit einer Kanne Kaffee herein. Ich registrierte erleichtert, dass sie Milos Tasse genauso voll einschenkte wie unsere. Er bedankte sich mit ausgesuchter Höflichkeit und warf mir einen verstohlenen Blick zu. Glücklicherweise hatte ich das Grinsen unterdrückt, das sich auf mein Gesicht drängen wollte.
Unser Chef verteilte indessen neue Aufgaben: Jay und Leslie bekamen den Auftrag, den abgeschlossenen Fall aufzuarbeiten Verhöre, Verhörprotokolle, die Berichte für die Presse, die Dokumentation für die Staatsanwaltschaft und so weiter und so fort. Jays Pokerface zeigte keine Rührung. Leslie lächelte säuerlich.
So glücklich ich darüber war, dass wir die Geldfälscher und ihre Geschäftspartner geschnappt hatten, so inbrünstig gratulierte ich mir jetzt, nicht die Leitung des Einsatzes gehabt zu haben. Der anschließende Papierkram war einfach ätzend.
»Und dann habe ich hier eine Routinesache hereinbekommen«, sagte Mr. McKee, »ein New Yorker, der in seinem Wochenendhaus auf Long Island von einer Klapperschlange gebissen wurde. Er starb Anfang letzter Woche.« Er schob ein paar zusammengeheftete Blätter Medina und Clive zu. »Vielleicht etwas für sie. Zur Entspannung«, fügte er mit einem Schmunzeln hinzu.
»Bundesbeamter?«, fragte Clive.
Der Chef nickte. »Daniel Kent. Verwaltungschef bei der Finanzbehörde. Die Detektive der Versicherungsgesellschaft, bei der er seine Lebensversicherung abgeschlossen hatte, wollen Spuren im Garten des Grundstücks entdeckt haben und konstruieren ein Mordkomplott daraus. Die Juristen der Gesellschaft haben einen Strafantrag gestellt, und weil er Bundesbeamter war, wäre das dann unser Fall. Schauen Sie mal, was da dran ist.«
Während Clive und Medina die Papiere überflogen, wandte sich Mr. McKee an Milo und mich. In dem Augenblick klingelte sein Telefon.
Er nahm ab. Aus den wenigen Sätzen, die er sagte, entnahmen wir, dass er mit der City Police telefonierte. Während er seinem Gesprächspartner zuhörte, machte er sich Notizen.
»Gut«, sagte er schließlich, »schicken Sie mir die bisherigen Ermittlungsergebnisse über E-Mail in unsere Zentrale.«
Er legte auf und sah Milo und mich an.
»Eine Entführung. Die betroffene Familie wohnt auf der East Side. Vanhouven.« Nachdenklich rieb er sich das Kinn. »Der Mann macht Geschäfte mit Kaffee und Tee. Ich glaub, ich hab neulich mal in der Zeitung von ihm gelesen. Muss mit dem Bürgermeister bekannt sein. Am besten, Sie holen sich die Informationen von der City Police aus dem Computer und fahren dann gleich mal vorbei.«
»In Ordnung, Sir.« Milo nahm den Notizzettel entgegen. Die anderen sahen uns so an, als würden sie gern mit uns tauschen.
6

|

|


Es war dunkel.Theresa versuchte sich aufzurichten. Sie stieß mit dem Kopf gegen etwas Hartes, Kantiges - die Rippe einer Heizung.
Ihre Oberarme schmerzten. Ihre Finger kribbelten, und ihr allmählich aufklärendes Bewusstsein registrierte, dass ihre Hände knapp über ihrem Kopf aneinandergebunden waren.
Sie versuchte sie herabzuziehen, um sich aufstützen und vom schmerzenden Rücken auf die Seite drehen zu können. Aber die Hände gehorchten nicht.
Gefesselt, lallte eine ungeheuer müde Stimme in ihrem Kopf.
Theresa glaubte ihr nicht und zerrte jetzt kräftiger an dem Widerstand, der ihre Hände festhielt.
Ein metallisches Knirschen erklang von einer Stelle, die ziemlich weit über ihr liegen musste.
Sie gab auf und versuchte ihren Körper ohne Zuhilfenahme der Hände auf die Seite zu drehen. Sie brauchte solange dafür, wie sonst für den Weg vom Puppenzimmer zur Hofeinfahrt. Jedenfalls kam es ihr so vor.
Als Nächstes registrierte sie, dass sie lediglich ihren Unterrock über BH, Slip und Strumpfhose trug.
Der stechende Schmerz in ihren Handgelenken vertrieb die letzten Dunstschleier aus ihrem Bewusstsein. Bilder tauchten vor ihrem inneren Auge auf: Eisgraue Augen, der bräunliche Himmel eines PKW, ein Mann mit Glatze, der rothaarige Taxifahrer, stinkende Feuchtigkeit über ihrem Gesicht...
Die einzelnen Teile fügten sich träge zu einem Bild zusammen, das einen Sinn ergeben hätte, wenn Theresa sich nicht geweigert hätte, dieses Bild für die Wirklichkeit zu halten.
Wie eine Katze, die von einem Collie gejagt wird, flüchtete Theresas Verstand für einige Minuten lang in alle möglichen Schlupfwinkel, um diesem Bild zu entkommen.
Es ist ein Film, lieber Gott, es ist ein Film, den ich mal gesehen habe... oder ein böser Traum genau: Ein böser Traum! Gleich werde ich aufwachen. Jesus, lass mich endlich aufwachen... okay, okay, so was passiert auch außerhalb von Träumen und Filmen... Leuten, die man in Talkshows sieht, denen passiert so etwas. Leuten, von denen man in der Zeitung liest... aber doch nicht mir, lieber Gott, doch nicht mir...
Als sie endlich vor dem Bild kapitulierte, brach sie in Tränen aus. Sie weinte leise vor sich hin, immer wieder laut aufschluchzend.
Ich bin entführt worden, o Gott, warum hast du das nicht verhindert? Bin ich wirklich entführt worden...?
Sie wusste hinterher nicht mehr, wie lange sie so gelegen hatte weinend und zitternd. Theresa hatte jedes Zeitgefühl verloren. Durch den chaotischen Wirrwarr ihrer Gedanken hindurch drang sie irgendwann zu der Erinnerung an ihren Großvater vor. Alles ist möglich, nur aufgeben nicht, meinte sie plötzlich seine Stimme zu hören.
Eine Welle von Zuversicht prickelte durch ihren fiebrigen Körper. »Aufgeben ist unmöglich«, murmelte sie.
Es war nicht diese unverhoffte Zuversicht, die ihr Mut machte, zu schreien. Noch hatte sie viel zu viel Angst. Es war das schlichte, aber dringende Bedürfnis, zur Toilette zu müssen. »Hilfe! Hört mich jemand? Hilfe!«
Licht flammte auf .Theresa schloss geblendet die Augen.
Als sie sie wieder blinzelnd öffnete, stand ein Mann in einer Tür: Rothaarig, jungenhafte Gesichtszüge, weißes T-Shirt, Goldkettchen mit Kreuz.
Der Taxifahrer.
In seinen Augen flackerte die Schutzlosigkeit eines gehetzten Wildes. Nicht mit dem Kopf, aber mit dem Bauch durchschaute Theresa ihn in einem einzigen Augenblick.
»Ich... ich muss mal...«
Der Mann wich ihrem Blick aus, griff in die Hosentasche und war mit einem Schritt bei ihr. Er zog einen kleinen Schlüssel heraus, und Theresa registrierte, dass sie mit Handschellen an eine Heizung gefesselt war.
Die Heizung befand sich an einer gekachelten Wand, und die Wand lag gegenüber einer Badewanne, die aus dem letzten Jahrhundert stammen musste - sie hatte verschnörkelte, gusseiserne Beine, und unter ihr sah Theresa außer dem Rest einer Seife und zwei leeren Shampooflaschen so viele Staubflocken wie in ihrem ganzen 48jährigen Leben noch nicht.
Der Rothaarige sah schweigend zu, wie sie sich ächzend aufrichtete und ihre Glieder streckte. Er deutete hinter sie, und als sie sich umdrehte, sah sie eine Kloschüssel, bei deren Anblick Ekel in ihr aufstieg.
Unschlüssig stand sie vor der Schüssel. Sie wandte sich zu dem jungen Mann um. Er machte keine Anstalten, das Bad zu verlassen. Ihre Blicke begegneten sich sekundenlang.
Theresa sah die feinen Falten um seine Augen und auf seiner Stirn. Das jungenhafte Gesicht erschien ihr plötzlich uralt.
Er ist mindestens 30, dachte sie.
»Gehen Sie vor die Tür. Bitte.«
Er zögerte einen Moment, bevor er das Bad dann doch verließ. Die Tür ließ er angelehnt.
Während sich Theresa erleichterte, starrte sie auf die Tür. Die alte Farbe hing an unzähligen Stellen wie Fetzen eines Grauschleiers ab. Den Steinzeitbadeofen daneben verunzierten genauso viele Rostflecke wie Emaillereste. Ähnlich die Badewanne, nur dass sich ein schwärzlicher Fettfilm unter ihrem Rand entlang zog.
Theresa dachte an das große, mit Marmor ausgelegte Bad im Erdgeschoss ihrer Villa. Die Hässlichkeit hier tat ihr körperlich weh.
»Endlich fertig?« Es klopfte an der Tür. Theresa sah sich vergeblich nach Toilettenpapier um.
Hastig zog sie den Slip hoch, drückte die Spüle und drehte den Wasserhahn des schief hängenden Waschbeckens auf.
Der Rothaarige kam herein. Verlegen strich Theresa mit ihren nassen Händen ihren Unterrock glatt.
Wieder begegneten sich ihre Blicke. Das Gefühl der Erniedrigung trieb ihr die Hitze ins Gesicht.
»Wo sind meine Kleider?«
Statt zu antworten, deutete er auf die Heizung.
»Wie heißen Sie?« Schweigend legte er ihr die Handschellen an.
»Ich will meine Kleider.«
Er drehte den Schlüssel um, steckte ihn in die Tasche seiner ausgebleichten Jeans und ging zur Tür.
»Hören Sie.« Theresas Stimme war heiser.
Der Rothaarige drehte sich zu ihr um und sah sie an.
»Haben Sie eine Mutter?«
Theresa hatte den Eindruck, dass sich seine Augen weiteten und dass er eine Spur hastiger die Tür hinter sich schloss, als er sie zuvor geöffnet hatte.
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2017
- ISBN (ePUB)
- 9783738913613
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Oktober)
- Schlagworte
- killer-service