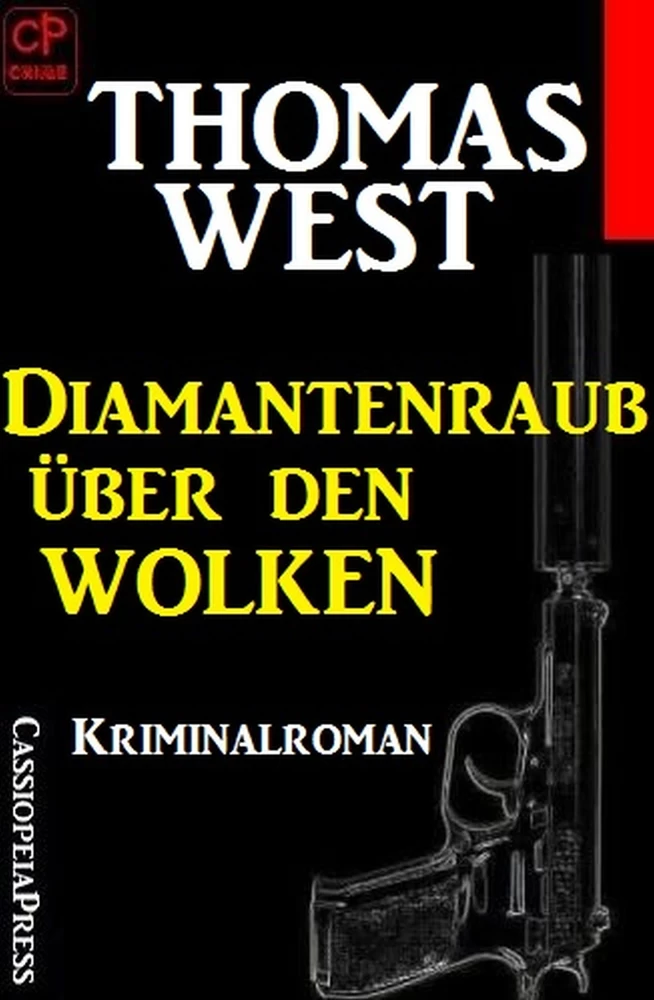Zusammenfassung
Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 120 Taschenbuchseiten.
Angela Beagle war stellvertretende Leiterin des FBI-Labors – und nun ist sie tot. Deshalb wurde die Klärung des Falles Special-Agent Jesse Trevellian und seinen Kollegen übertragen. Die FBI-Beamtin war zusammen mit ihrem Freund, dem Flugkapitän Craig Warren, in einem New Yorker Hotel erschossen aufgefunden worden. Zunächst vermuten die Agents, dass ihre Kollegin das eigentliche Opfer war, doch dann ermitteln sie in Richtung des PanAm-Piloten … Er hatte einen Flug nach London fliegen sollen, dessen Platz nun von einem Kollegen eingenommen wurde. War das das Motiv für einen Doppelmord? Zumal die Boing 747 nicht nur über vierhundert Passagiere an Bord hatte, sondern auch eine Sonderfracht - Rohdiamanten im Wert von mindestens zehn Millionen Dollar ...
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Diamantenraub über den Wolken
Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 120 Taschenbuchseiten.
Angela Beagle war stellvertretende Leiterin des FBI-Labors – und nun ist sie tot. Deshalb wurde die Klärung des Falles Special-Agent Jesse Trevellian und seinen Kollegen übertragen. Die FBI-Beamtin war zusammen mit ihrem Freund, dem Flugkapitän Craig Warren, in einem New Yorker Hotel erschossen aufgefunden worden. Zunächst vermuten die Agents, dass ihre Kollegin das eigentliche Opfer war, doch dann ermitteln sie in Richtung des PanAm-Piloten ... Er hatte einen Flug nach London fliegen sollen, dessen Platz nun von einem Kollegen eingenommen wurde. War das das Motiv für einen Doppelmord? Zumal die Boing 747 nicht nur über vierhundert Passagiere an Bord hatte, sondern auch eine Sonderfracht - Rohdiamanten im Wert von mindestens zehn Millionen Dollar ...
1
Während auf der Rückseite des Terminals die Boing abhob, mit der sie vor sechs Stunden aus London gekommen waren, standen sie an der Frontseite der Flughalle vor einer der Eingangsschleusen und sahen sich schweigend an.
Alles war gesagt. Fast fünf Stunden lang hatten sie in der Cafeteria des Kennedy International Airports gesessen und ihren Kaffee kalt werden lassen, während einer dem anderen seine Lebensgeschichte erzählte.
Und das, obwohl sie sich erst wenige Stunden kannten. Seit dem Abflug in London, um es ganz genau zu sagen. Die Stewardess Vanessa Stainkeeper und der Flugkapitän Craig Warren. Amor hatte sie auf eine Weise erwischt, von der die meisten Menschen nur träumten: Ohne jede Vorwarnung und aus heiterem Himmel. Im Londoner PanAm Büro, als der Copilot Christopher Teel sie miteinander bekannt machte.
Craig räusperte sich. "Ich muss jetzt gehen." Er zog Van an sich und küsste sie. Zum ersten Mal. Und definitiv zum letzten Mal.
Aber das wusste allenfalls der Mann, der keine fünfzig Meter entfernt von ihnen in die Montagsausgabe der >New York Post< vertieft zu sein schien. Ein untersetzter, sportlich, aber elegant gekleideter Mann mit pomadig glänzenden, grauen Locken.
Und selbst der hatte vermutlich andere Sorgen als eine Romanze von Leuten, die er nicht kannte.
"Sieht so aus, als würden sie sich doch noch verabschieden", murmelte er in das Handy, das er mit dem Daumen gegen die Innenseite des Sportteils klemmte.
Das Liebespaar bemerkte ihn nicht. Es bemerkte überhaupt nichts mehr von der Welt um es herum. Vanessa löste sich endlich aus Craigs Umarmung und schaute den Piloten fragend an.
Der wusste, welche Frage ihr auf der Zunge lag. "Ich will es auch", sagte er. "Aber ich hab' dir ja von ihr erzählt." Vanessa nickte langsam. "Ich muss erst reinen Tisch machen. Sie wartet im Hotel auf mich. In zwei, drei Stunden hab' ich's hinter mir. Dann rufe ich dich an."
"Okay." Vanessa hängte sich ihre Tasche um. "Ich warte auf deinen Anruf." Zärtlich strich sie ihm mit den Fingerspitzen über die Lippen. Dann wandte sie sich ab.
Craig sah ihr nach. Erst als das Cabby, in dessen Font sie gestiegen war, davonrollte, nahm auch er seine Tasche und schlenderte auf die Taxibucht zu.
Er fühlte sich ein wenig, wie nach der glücklichen Notlandung, die er vor zwei Jahren während eines Schneesturms in Canberra hingelegt hatte - aufgekratzt, euphorisch und unverschämt glücklich. Die Frau hatte ihn umgehauen. Er konnte es immer noch nicht fassen, was er in den letzten Stunden erlebt hatte.
"Da triff man einen wildfremden Menschen, und ..." Kopfschüttelnd brach er den vor sich hin gemurmelten Satz ab. Seine Gefühle und Gedanken fuhren Karussell mit ihm. "Wenn ich nicht wüsste, dass ich verliebt bin, würde ich sagen, ich bin wahnsinnig."
Der Fahrer des ersten Cabbys stieg aus. Während er das Gepäck im Kofferraum verstaute, blickte Craig in den strahlend blauen Abendhimmel. Überrascht registrierte er zum ersten Mal seit der Landung, dass es in New York City nicht regnete. Beim Start in London hatte es in Strömen gegossen.
Er zog die Beifahrertür auf und ließ sich auf den Sitz fallen. "Astron-Hotel." Der Fahrer, ein Chinese, nickte.
Das Hotel lag nicht weit vom Flughafen entfernt. Ein teurer Massenschuppen, der in erster Linie von den Crews der Fluggesellschaften benutzt wurde, die den Kennedy International Airport anflogen.
Craig fühlte sich topfit und wunderte sich darüber. Immerhin war er schon seit über vierundzwanzig Stunden auf den Beinen. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er sich sofort wieder ins Cockpit setzen können, um den Atlantik gleich noch einmal zu überqueren.
Aber die Vorschriften waren eindeutig: Wer acht Stunden am Stück geflogen war, musste eine Pause von mindestens sechzehn Stunden einlegen, bevor er den nächsten Flug antrat.
Craig sah auf die Uhr: Kurz vor acht Uhr abends. Zwanzig Stunden Zeit bis zum nächsten Start. Und mindestens achtzehn davon mit Van. Aber vorher musste er die Sache mit Angie zu Ende bringen. Diesmal endgültig.
Der Gedanke an seine alles andere als unkomplizierte Freundin trübte seine Stimmung. "Ich muss es hinter mich bringen. Je schneller, desto besser", dachte er.
Das Taxi hielt vor dem Astron-Hotel-Komplex. Craig bezahlte und stieg aus. Das zweite Cabby, dass nicht einmal zehn Meter hinter seinem Taxi stoppte, beachtete er überhaupt nicht. Warum auch? Kaum ein Hotel in dieser Gegend, vor dem nicht zwei oder drei Taxis standen.
Kurz darauf stand er vor der Rezeption. "Sorry - ich muss mein Zimmer stornieren." Er setzte eine Miene des Bedauerns auf. "Mein Flugplan hat sich vollständig geändert."
Er ließ sein Gepäck an der Rezeption und fuhr mit dem Lift in den neunten Stock hinauf. Der Gedanke, gleich gar nicht hier zu übernachten, sondern mit Sack und Pack bei Van aufzukreuzen, war ihm erst vor dem Tresen der Rezeption gekommen.
Angie wohnte in Zimmer 923. Er atmete tief durch. "Du musst es hinter dich bringen, Junge", seufzte er. "Es ist längst überfällig. Und danach auf dem kürzesten Weg zu Van."
Es war nicht viel Zeit, die ihnen für ihren ersten Honeymoon bleiben würde. Am Nachmittag des nächsten Tages ging ihre Maschine zurück nach London. Flug 712. Punkt viertel nach vier.
Auf der roten Digitalanzeige erschien eine Neun. Die Lifttüren schoben sich auseinander. Craig stieg aus und trat in eine lange Zimmerflucht. Abgesehen von der protzig ausgestatteten Empfangshalle wirkte das Hotel wie ein nachlässig umgebautes Gefängnis. Je weiter man hineinging, desto mehr wurde man der Enge überwältigt.
Seine Augen wanderten über die blauen Plastikschilder neben den blauen Metalltüren - 919, 920, 921 ...
Sein Schritt verlangsamte sich und und wurde unsicher - 922, 923. Er atmete tief durch und klopfte. Angie öffnete. Sie sah merkwürdig blass aus, und ihre Gesichtszüge wirkten kantig und verkrampft. Als wüsste sie schon, was er ihr zu sagen hatte.
Es gab ein paar Männer in Manhattan, die hatten sich in den Kopf gesetzt, dass Flug 712 ohne Craig Warren nach London startete. Männer von denen Craig nichts wusste.
Einer von ihnen stieg eben im Erdgeschoss des Hotels in den Lift. Ein zweiter tauchte hinter der sich schließenden Zimmertür neben Angie auf. Er zielte mit einer schalldämpferbewehrten Pistole auf Angies blonden Hinterkopf. "Zuck einmal mit dem kleinen Finger, und das Hirn deiner Perle klebt an der Wand", sagte er leise.
2
"Das kann nicht dein Ernst sein, Orry!" Clive Dillagio knallte sein Bierglas auf die Theke. "Das kann verdammt noch mal nicht dein Ernst sein! Er ist kein Privatmann, wie du und ich! Er ist Präsident!" Fassungslos sah er Milo und mich an. "Hab' ich nicht recht?" Zu viert standen wir an diesem Montagabend an der Theke des >North Star Pubs< und tranken ein Feierabendbier.
In Orrys Augen blitzte es spöttisch auf. Er schien die Empörung seines Partners zu genießen. "Sei nicht albern, Clive", sagte er mit provozierender Gelassenheit. Ich bin auch kein Privatmann. Als FBI-Agent bin ich Bundesbeamter - und trotzdem lasse ich mir von niemandem vorschreiben, mit wem ich vögele."
"Er ist verheiratet, Orry! Ehemann und Familienvater - und als Präsident ein Vorbild aller Amerikaner! Da kann er nicht einfach eine babyspeckige Praktikantin auf den Schreibtisch legen! Da kann er nicht einfach tun und lassen, was er will!"
"Blödsinn." Orry griff sich sein Bierglas und nahm einen kleinen Schluck. ">Ehemann und Familienvater< - das heißt doch nur, dass er für den Mist, den er gebaut hat, einzig und allein vor seiner Frau und seiner Tochter geradestehen muss." Er stellte sein Bierglas ab und zog eine Schachtel West aus der Innentasche seines hellen, groß karierten Maßanzuges.
"Geradestehen?", ereiferte sich Clive. "Dafür kann er nicht geradestehen, dafür muss er auf den Knien liegen!"
"Von mir aus", brummte Orry. "Aber nur vor Frau und Tochter."
"Er ist Präsident!" Clives Stimme nahm einen beschwörenden Klang an. "Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika! Wie stehen wir denn jetzt vor der Welt da?!" Wieder wandte er sich mit einem hilfesuchenden Blick an Milo und mich. "Hab' ich nicht recht? Sagt doch auch mal was!"
Seit ein paar Tagen stand Amerika Kopf. Seit der Kongress in einem Anfall geistiger Umnachtung den Untersuchungsbericht zur Lewinsky-Affäre der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hatte. Die eine Hälfte dieser Öffentlichkeit entrüstete sich, die andere stand im Internet Schlange, um sich aufzugeilen.
"Hast ja recht, Clive", seufzte Milo. "Ein Trauerspiel. Und irgendwie auch zum Lachen." Er schüttelte den Kopf und grinste säuerlich. "Die gleichen Leute, die noch vor Kurzem eine Menge Steuergelder locker gemacht haben, um Pornographie im Internet zu bekämpfen, beglücken uns jetzt mit einem offiziell abgesegneten Softporno. Wirklich toll!"
"Mir tut der Präsident leid", sagte ich. Orry nickte befriedigt.
"Wie kann er dir leid tun?!" Clive hatte sich in Rage geredet. "Verdammt noch mal - wie kann dir ein Präsident, der sich durch die Weltgeschichte lügt und bumst, leid tun, frag' ich dich!?"
Ich zuckte mit den Schultern. Natürlich hatte der Mann Mist gebaut. Unbegreiflichen Mist sogar. Aber die verlogene Art und Weise, wie sich seine politischen Gegner jetzt auf ihn stürzten, hatte für mich etwas zutiefst Unappetitliches.
"Manchmal ist eine Lüge klüger und vor allem menschlicher als die Wahrheit", sagte ich. "Sicher - du hast recht: Das Präsidentenamt ist durch die ganze Sache nicht eben gestärkt worden. Aber daran ist auch der Kongress schuld. Und vor allem dieser starrsinnige Sonderermittler."
"Genau!" Orry schlug mit der flachen Hand auf die Theke. "Statt einem menschlichen Hirn hängt diesem Kerl hat doch einen Batterie von Schraubstöcken unter der Schädeldecke! Und darin eingeklemmt seine moralinsaure Lebensphilosophie: >Sei brav und rotte das Böse aus<!"
"Prost", grinste Milo und setzte sein Glas an die Lippen.
"Ihr seid doch nicht mehr recht bei Trost!", schnaubte Clive. "Noch ein Bier!", rief er dem Barkeeper zu.
Das Gedudel unter Milos Jackett machte der unerfreulichen Diskussion ein Ende. Er zog sein Handy heraus. "Tucker?" Sein Gesicht verfinsterte sich, während er sich anhörte, was sein Gesprächspartner zu erzählen hatte. "In Ordnung, Sir", sagte er schließlich.
Er klappte das Sprechteil des Gerätes hoch und ließ es wieder in seiner Innentasche verschwinden. Gespannt sahen wir ihn an.
"Der Chef. Die Kollegen von der City-Police haben zwei Tote gefunden. In einem Hotel in Queens." Er griff nach seinem halb vollen Bierglas und leerte es in einem Zug. Das sah ganz nach Ende des Feierabends aus. "Einer der Toten gehört zum FBI."
"Ach du Scheiße ...", entfuhr es Orry.
3
Das Boot lag in einem kleinen Yachthafen von Montauk. Eine hochseetaugliche Yacht, die gut siebzehn Knoten machte. >Nautilus< stand in ehemals weißen Lettern unter der Reling des graublauen Bugs.
Thomas McAnjou hatte den kleinen, aber PS-starken Schlepper vor mehr als zwanzig Jahren der taiwanesischen Marine abgekauft und seitdem sämtliche Weltmeere damit bereist. Meistens als technischer Leiter von Expeditionen irgendwelcher Meeresforschungsinstitute oder Firmen, die es darauf angelegt hatten, den Meeresboden nach Bodenschätzen abzusuchen. Einige Jahre lang war er auch für eine Umweltorganisation unterwegs gewesen.
Hier in Montauk, der Stadt am äußersten Zipfel von Long Island, hatte er selten angelegt. Vier- oder fünfmal in den letzten zehn Jahren. Wenn er etwas in Manhattan zu erledigen und Gründe genug hatte, den Behörden seine vorübergehende Anwesenheit zu verbergen.
Keine schwerwiegenden Gründe in der Regel: Steuerschulden - McAnjou war amerikanischer Staatsbürger - oder monatelanger Rückstand von Unterhaltszahlungen.
Sein energischer, federnder Schritt fiel auf, als er über den Landungssteg lief. Weder groß noch besonders kräftig gebaut, wirkte McAnjou doch wie ein Energiebündel. Sein Gang, seine Gestik, seine Mimik, sein drahtiger, aufrechter Körper - alles strahlte Konzentration und Zielstrebigkeit aus. Vor allem die Augen in seinem sonnenverbrannten und zerknitterten Gesicht. Eisgrau wie sein langes, graues Haar und sein üppiger Schnauzer.
Die Aluminiumrampe vibrierte, als er mit großen Schritten darüber hinwegeilte und sein Boot betrat. "Wie sieht's aus?", rief er. Seine Stimme hatte etwas von einer Krähe.
Über ihm, an der offenen Tür der Kommandobrücke, erschien die schmächtige Gestalt Bobby Lings. "Alles klar, Tom", sagte der Chinese. Ein brauchbarer Navigator. Abergläubisch, aber schlau wie ein Fuchs. McAnjou hatte ihn vor acht Jahren auf Sumatra vor der indonesischen Polizei versteckt. Und ihm so vermutlich das Leben gerettet. Denn die indonesischen Behörden pflegten mit Piraten kurzen Prozess zu machen.
McAnjou sah auf seine Armbanduhr. Halb neun. Am östlichen Horizont schon die ersten Spuren der aufdämmernden Nacht über dem Atlantik. "Ich check das Zeug selbst noch mal durch", knurrte der Grauhaarige.
Auf Bobby konnte er sich hundertfünfzigprozentig verlassen. Und auf Wash zumindest hundertprozentig. Aber die bevorstehende Aktion - sollte sie zustande kommen - war so heikel und so entscheidend, dass er heute Nacht nur ruhig schlafen würde, wenn er die Ausrüstung selbst noch einmal kontrollierte.
Er zog eine kleine Tür auf und stieg in den Lagerraum hinab. Washington Bassedy hockte im Schneidersitz am Boden und ölte die Einzelteile einer Maschinenpistole. "Hi, Tom", grüßte er, ohne aufzusehen.
Äußerlich war er so ziemlich das Gegenteil von Thomas McAnjou: Groß, breitschultrig, kahl geschoren und schwarz. Seine Bewegungen wirkten langsam und schwerfällig. Aber das täuschte. Wenn der ehemalige Marinetaucher mit dem Kindergemüt auch ein wenig phlegmatisch war, so konnte er sich doch in eine blitzschnell reagierende Kampfmaschine verwandeln, wenn es darauf ankam.
"Wie geht's, Wash?" Bassedy war über zwanzig Jahre jünger als er selbst. McAnjou hatte ihn vor drei Jahren in einem Spielkasino in Atlantic City kennengelernt. Am Roulettetisch hatte er zwanzigtausend Dollar verspielt. Ein halbes Dutzend Männer des Sicherheitsdienstes waren nötig gewesen, um den tobenden Schwarzen zu bändigen.
McAnjou hatte ziemlich konkrete Vorstellungen von der schwindelerregenden Summe, die Bassedy Monat für Monat benötigte, um seine Spielleidenschaft und die sieben Kinder aus drei gescheiterten Ehen zu finanzierten. Solche Leute waren mehr als motiviert für ein Projekt wie dieses.
McAnjou schritt langsam an den sorgfältig auf dem Boden des Lagerraums ausgebreiteten Ausrüstungsgegenständen vorbei: Sauerstofflaschen, Taucherbrillen, Schwimmflossen, Taucheranzüge, ein Maschinengewehr, zwei Uzi-Maschinenpistolen, drei Kisten Munition, ein Dutzend Handgranaten, Unterwasserlampen, zwei Harpunen, Schweißgeräte.
Er ging in die Hocke, um Sauerstofflaschen und Atemgeräte zu überprüfen. Zufrieden nickte er. "Seid ihr mit den sechzig Riesen hingekommen?"
"Gerade so."
"Gut." Fünfzehntausend Dollar hatte er selbst in die Ausrüstung investiert. Den Rest die anderen fünf. Doch wenn alles glattging, würde mehr als das Hundertfache hereinkommen. Man konnte kein Geld verdienen, ohne welches auszugeben. So war das eben.
Er richtete sich auf. Fast andächtig betrachtete er Waffen und Geräte. Thomas McAnjou hatte schon manche Coups weit jenseits der Legalität gelandet. Aber noch nie so einen großen. Trotzdem hatte er nicht lange gezögert, als sein engster Freund ihm die Sache vorgeschlagen hatte.
Man konnte nicht sein Leben lang über den Globus kreuzen, ohne ein Cent Sozialversicherung zu bezahlen, und dann so einen Job ausschlagen. Schon gar nicht, wenn man in zwei Jahren die Grenze in die Sechziger überschreiten würde, wie McAnjou. Danach wollte er eigentlich nichts Nennenswertes mehr arbeiten. Sondern zwischen den Kontinenten hin und her pendeln, um jedes seiner neun Kinder wenigstens alle zwei Jahre einmal zu sehen.
Und diese Art von Ruhestand kostete nun mal Geld.
"Okay", krächzte McAnjou. "Sobald er angerufen hat, stechen wir in See."
4
Sie lagen beide auf dem Bett. Die Frau auf dem Bauch, der Mann auf dem Rücken. Vollständig angezogen - sogar Schuhe trugen sie. Dem Bett sah man an, dass es noch nicht benutzt worden war - wie frisch bezogen sah es aus. Abgesehen natürlich von den großen Blutflecken, die sich um die Köpfe der beiden Toten herum gebildet hatten.
Der Frau hatte man durch einen Genickschuss getötet, den Mann durch einen aufgesetzten Schuss in die Schläfe.
"Allerhöchstens zwei Stunden her." Der Pathologe aus dem Zentrallabor war grau wie feuchte Holzasche. Er sah niemandem von uns in die Augen. Die Tote war eine ehemalige Kollegin von ihm.
"Das Zimmermädchen hat sie vor anderthalb Stunden gefunden. Zwanzig Minuten zuvor hatte Mrs. Beagle eine Flasche Champagner bestellt." Barry Koch deutete mit einer Kopfbewegung auf die tote Frau.
Milo und ich kannten den kleinen, stämmigen Polizisten aus vielen Einsätzen, in denen wir mit der New York City Police zusammengearbeitet hatten. Wenn ich mich recht erinnerte, hatte ich Barry zuletzt gesehen, als er noch Deputy Inspektor in der Bronx gewesen war. Inzwischen hatte man ihn zum Inspektor befördert, und er koordinierte die Morddezernate der Polizeireviere in Brooklyn und Queens. Wie immer trug er einen Hut, und einen zerknitterten Anzug.
"Meine Jungs haben mich sofort aus einem Basketballspiel gerufen, als sie Mrs. Beagles Identität ermittelt hatten." Ganz bestimmt war er als Zuschauer und nicht als Spieler mit einem Basketballspiel beschäftigt gewesen. Dennoch drängte sich mir die Vorstellung des fleischklößigen Barry unter einem Basketballkorb auf. Unter anderen Umständen hätte sie mich vermutlich erheitert.
Doch jeder von uns war meilenweit entfernt von heiteren Gedanken - die Leute von der Pathologie und der Spurensicherung genauso wie Barry, seine Detectives und wir vier vom FBI-District-Office. Die tote Frau hatte früher als Laborantin im Zentrallabor des New York City Police Departments gearbeitet. Und seit zwei Jahren war sie als stellvertretende Leiterin unseres Labors FBI-Beamtin.
"Und der Mann?", wollte Orry wissen.
"Ihr Lover", sagte der Polizeiarzt mit hohler Stimme.
"Sie kannten ihn?", wunderte ich mich.
"Flüchtig." Der Arzt bückte sich zu dem Bett mit den Toten und packte seine Tasche zusammen. "Ich bin sein Vorgänger."
Barrys buschige Augenbrauen wanderten nach oben. Wieder ein Blick auf die blonde kurzhaarige Tote auf dem Bett. Sie musste gut zwanzig Jahre jünger gewesen sein, als ihr ärztlicher Kollege.
Barry räusperte sich. "Tut mir leid." Der Arzt verließ mit hängenden Schultern das Apartment.
"Muss er sie etwa obduzieren?", fragte mein Partner mit einem Anflug von Ekel in der Miene. Makabere Vorstellung, eine ehemalige Geliebte aufschneiden zu müssen.
"Er wird sich darum zu drücken wissen." Barry deutete auf die männliche Leiche. "Zurück zu ihm - er heißt Craig Warren und fliegt als Chefpilot für PanAm."
"Flog als Chefpilot", korrigierte ein Mann in weißem Labormantel und mit Latexhandschuhen von der Eingangstür des Apartments. Mit Rußpulver und Pinsel bearbeitete er die Türklinke, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen.
Barry runzelte die Stirn. "Vielen Dank, Sergeant", sagte er mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit und Zynismus. "Vielleicht sollte ich Sie doch gelegentlich zur Beförderung vorschlagen."
Er wandte sich wieder uns zu. "Wir haben die Fluggesellschaft bereits verständigt." Mit beiden Händen setzte er sich den Hut auf und rückte ihn sorgfältig zurecht. "Und mit Jonathan habe ich auch gesprochen."
"Und was sagt unser Chef?", erkundigte Clive sich.
"Dass ihr den Fall übernehmt." Er winkte und schaukelte aus dem Hotelzimmer.
5
Dankenswerterweise hatten sie ihm diesmal eines der begehrten Zimmer im Eckturm gegeben. Er stand am Fenster und schaute auf die nächtliche Straße achtzehn Stockwerke unter ihm hinunter.
Das Reiterdenkmal unten auf dem Platz war hell erleuchtet. Die Autos glitten lautlos und winzig über die Fifth Avenue, wie zweiäugige Leuchtkäfer.
Das runde Zimmer strahlte eine unwirkliche Behaglichkeit aus und vermittelte die Illusion längst verlorenen Zuhauseseins. Noch bevor er heute Vormittag die Tür hinter sich geschlossen hatte, war ihm plötzlich warm geworden - innerlich warm - und er hatte sich zurückversetzt gefühlt in die Tage seiner Jugend, als er, der Großstädter aus Chicago, seine Ferien ein paar Jahre lang am Lake Huron verbracht hatte. Mit der Pfadfindergruppe der baptistischen Kirche.
Die durchwachten Nächte in der schwarzen, vom Lagerfeuer erhellten Kote gehörten zu den wenigen Erinnerungen, die er hütete, wie einen Goldschatz. So geborgen und rund wie damals hatte er sich nie wieder gefühlt.
Dieses Zimmer hatten sie ihm noch nie gegeben. Vermutlich hatte die Hotelmanagerin dafür gesorgt, dass man es diesmal für ihn reserviert hatte. Es zahlte sich noch jedes Mal aus, Beziehungen zu pflegen.
Drei Kerzen eines Bronzeleuchters erfüllten den Raum mit flackerndem, warmem Licht. Michael Lockshire lauschte auf die tiefen Atemzüge der Frau hinter sich im Bett. Suzanne Lovell, die Hotelmanagerin des >Plaza<. Er drehte sich nach ihr um.
Wie eine dunkle Wolke bedeckte ihr schwarzes Haar den Kissenbezug. Sie lag auf dem Bauch, und die Wölbung ihres Gesäßes zeichnete sich prall und fest unter dem Leintuch ab. Ihre aufregend schönen Schulterblätter hoben und senkten sich im Rhythmus ihres Atems, und ihre nackten langen Beine nahmen die ganze untere Hälfte seines Bettteiles ein.
Wahrscheinlich würde sie sich auch in seinem Leben so breit machen, wenn er leichtsinnig genug wäre, ihr die Möglichkeit dazu zu geben. Und wahrscheinlich war sie es auch, die seiner Frau gesteckt hatte, mit wem sie hier in New York City ein bis zweimal im Monat zu schlafen pflegte.
Woher sonst sollte eine Frau in Brighton, Südengland, wissen, dass ihr Mann sie betrügt? Natürlich hatte er Suzanne eine Szene deswegen gemacht. Aber am Ende waren sie doch wieder im Bett gelandet.
Mike fröstelte. Er war vollständig nackt. Behutsam schlich er über den Teppichboden zu Suzannes Bettseite. Der Boden davor wurde nicht vom Kerzenständer erleuchtet, und er musste sich durch die Dunkelheit tasten, bis er wenigstens Unterhemd und seine dunkelblaue Uniformhose fand.
Er klemmte die beiden Kleidungsstücke unter den Arm. Ein Blick zum Digitalwecker auf dem Nachttisch – halb elf - und dann leise zurück zum Fenster. Er schlüpfte in Hose und Unterhemd.
Über der Stuhllehne vor dem Tisch mit dem Kerzenleuchter hing seine Uniformjacke. Aus deren Tasche zog er eine Schachtel Benson & Hedges. Er angelte eine Zigarette aus der Schachtel, steckte sie zwischen die Lippen und beugte den Kopf über den Tisch, um sie an einer der Kerzen zu entzünden.
Das Kerzenlicht verursachte einen unwirklichen Reflex in dem blanken Kupferemblem seiner Schirmmütze, die neben dem Leuchter auf den Tisch lag. Das Emblem des PanAm-Globus.
Tief sog er den Rauch in die Lungen und blies ihn ins Kerzenlicht. Sein Blick fiel auf das Handy neben der Uniformmütze. Er hob die Mütze an und schob das Gerät darunter. Dann zog er das Jackett von der Stuhllehne, faltete es zusammen und legte es über die Mütze. Er wollte vermeiden, dass Suzanne aus ihrem Wolllustschlaf gerissen wurde, wenn die Rufakustik seines Handys losplärrte.
Für einen Augenblick ruhten seine Augen noch auf den Schulterstücken seiner Uniformjacke - sie wiesen ihren Träger als Flugkapitän aus. Die Abruptheit, in der er sich plötzlich abwandte, widersprach der Gelassenheit, mit der er sich die ganze Zeit bewegt hatte. Er ging zurück zum Fenster.
Die bevorstehende Scheidung war nicht seine einzige Sorge - bei Weitem nicht. Es war sowieso nur eine Frage der Zeit gewesen. Seit seine Frau ihn zum dritten Mal mit einer Stewardess erwischt hatte - natürlich nicht persönlich, sondern mittels eines Privatdetektivs - wartete sie auf eine Gelegenheit, endlich den fälligen Bruch zu vollziehen.
Nun war die Gelegenheit gekommen, nun war der Bruch absehbar - und okay: Irgendwann sind die Dinge eben vorbei. Schade, aber zu verkraften.
Aber wenn ihn die Fluggesellschaft tatsächlich entlassen sollte - und es gab keine Signale dafür, dass die entsprechenden Ankündigungen des Personalchefs nur ein Warnschuss gewesen sind - wenn sie ihn also feuern würden, dann allerdings sah er alt aus.
Das Eis, auf dem Michael Lockshire sich bewegte, war dünn genug. Dann noch auf zweihunderttausend im Jahr verzichten zu müssen, war für ihn schlicht unvorstellbar.
Nachdenklich betrachtete er den langen Aschekegel seiner Zigarette. "Keine Panik, Mickiboy - du bist noch immer auf die Beine gefallen."
Er wandte sich um und ließ seinen Blick durch das halbdunkle Zimmer wandern. Im Bücherbord über dem Bett stand etwas, das wie ein Aschenbecher aussah. Er schlich zum Bett und griff nach der flachen Porzellanschale.
Zurück am Fenster stellte er den Ascher auf das Fensterbrett. Zwischen den Glühwürmern, die tief unter ihm rechts und links und in entgegengesetzten Fahrtrichtungen am Reiterdenkmal vorbeiglitten, das aufgeregte Blinken von Rotlichtern. Im Zickzackkurs bohrte sich das rasende Ding seinen Weg durch den nächtlichen Verkehr. Die Sirene war dank der dreifach verglasten Fenster nicht zu hören. Irgendwo in diesem Moloch von Stadt hatte irgendjemand die Polizei gerufen.
"Merkwürdige Gattung", dachte Michael Lockshire. "Vierundzwanzig Stunden am Tag fahren oder fliegen sie durch die Gegend, schießen oder schlagen sich nieder, zerren sich vor Gerichte und Traualtäre, zeugen Kinder, vögeln fremde Frauen oder Männer, jagen Dollars und weniger handfesten Träumen hinterher. Und bewegen sich bei all dem auf einem gefährlich schmalen Felsgrat.
Manchmal kam ihm der Gedanke, dass er unbewusst vielleicht deswegen Pilot geworden war. Um wenigstens die Hälfte der Lebenszeit, die ihm blieb, wenn man die Schlafenszeit abzieht, in der Luft sein zu können. Weit weg von dem lächerlichen Getümmel dreißigtausend Fuß unter ihm.
Erst in den letzten Monaten hatte er sich klargemacht, dass dieses Getümmel auf dünnem Eis sich vor allem in dem pulsierenden Ding in seiner Brust abspielte. Selbst auf dem Mars würde er ihm nicht entkommen können.
Wie von sehr weit weg der Dreiklang seines Handys. Hastig drückte er die Zigarette aus. Zwei Schritte, und er war am Tisch. Vorsichtig schob er seine Hand unter Jacke und Schirmmütze, drückte den Callknopf und zog das Gerät heraus. "Lockshire?" PamAm war am Apparat. Er wurde gebraucht.
"Kein Problem, Sir. Ich bin pünktlich am Flughafen." Er unterbrach die Verbindung und legte das Gerät auf den Tisch. Unten, durch die dahingleitende Kette der Glühwürmchen, wedelten zwei auffallend große Glühwürmer. Mit Blaulicht. Ihre Presslufthörner waren trotz der isolierverglasten Fenster zu hören. Ein Löschzug. "Es brennt", murmelte Lockshire gedankenverloren. "Irgendwo im Big Apple brennt es."
"Mick?"
Eine verschlafene Frauenstimme hinter ihm. Er drehte sich um. "Suzanne? Bist du wach?"
"War der Anruf für mich?" Sie streckte sich.
Er grinste. "Wer würde versuchen, dich über mein Handy zu erreichen?"
"Du kennst meine Kollegen nicht."
"Natürlich", dachte er. "Was sich bis nach Großbritannien herumspricht, wird auch innerhalb eines Hauses kein Geheimnis bleiben."
"Was Dringendes?"
"Nicht direkt." Er schürzte die Lippen, als müsste er die Bedeutung des Anrufes selbst erst abschätzen. "Ich muss morgen nach London. Ein Pilot ist ausgefallen."
Langsam ging er zu ihr ans Bett, beugte sich herab und küsste sie auf den Oberschenkel. Warm und fest fühlte sich ihr Fleisch an. "Aber wir haben noch eine Menge Zeit", flüsterte er. "Der Flug geht erst um viertel nach vier."
6
Das monotone Summen des Rasierapparates beschwor seine mühsam abgeschüttelte Schläfrigkeit wieder herauf. So diszipliniert William Bellbrook jeden Morgen um sechs Uhr aufstand, so hartnäckig zog es ihn jedes Mal wieder ins warme Bett zurück, wenn sein Remington zu brummen begann. Doch seit seinem ersten Jahr bei der Navy hatte er es sich abgewöhnt, diesem Drang nachzugeben.
Das einschläfernde Summen seines Remingtons war so etwas wie der letzte Nachhall der Nacht. Die Pianofanfare vor dem anbrechenden Alltag. Spätestens nach der kalten Dusche würde er hellwach sein.
"Hier." Die Hand seines Neunjährigen streckte sich ihm entgegen. Er löste den Blick von seinem Spiegelbild und sah herunter zu seinem Sohn. Marc hielt ihm die kleine Kamera hin, die er ihm zu seinem letzten Geburtstag vor drei Wochen geschenkt hatte.
"Soll ich dich im Schlafanzug fotografieren, oder beim Pinkeln?", fragte er den Jungen.
"Nein, du sollst mir die Männer mit den Pelzturmhüten fotografieren. Die vor dem Schloss der Königen."
Will lachte. "Die Wachen vor dem Buckingham Palace, ach so!"
Er wandte sich wieder seinem halb rasierten Spiegelbild zu. Kantiges, rechteckiges Gesicht, stahlblaue Augen, makelloses Gebiss und bürstenschnittartig konstruierte Frisur. Wie man sich einen nur noch in Wach- und Nachtträumen aktiven Ledernacken eben vorstellte. "Aber die kann ich doch mit meiner eigenen Kamera fotografieren."
"Ich will aber Fotos mit aus meinem Apparat."
"Okay, okay - ich weiß aber nicht, ob ich lang genug in London bleiben werde, um den Buckingham Palast besuchen zu können. Ich muss doch gleich weiter nach Brüssel."
Sein Sohn schürzte die Lippen. "Für mich kannst du das doch tun."
"Also gut. Ich werd' sehen, was sich machen lässt. Leg die Kamera neben meinen Koffer."
Marc blieb am Waschbecken stehen und beobachtete interessiert, wie sein Vater den brummenden Remington durch sein Gesicht zog. "Kämpft ihr in Brüssel gegen die Russen?"
William Bellbrook lachte. "Nein, Junge. Die Zeiten sind vorbei. Gegen die Russen kämpfen wir nicht mehr."
"Gegen Terroristen?"
"Schon, aber nicht in Brüssel."
"Was machst du dann dort?"
"Na ja - was mach' ich dort." Bellbrook schaltete den Remington aus und strich sich prüfend über die glatte Haut. "Was mach' ich dort - ich überlege zusammen mit anderen, wie man es anstellen könnte, gegen die Russen oder sonst wen zu kämpfen, wenn man gegen sie kämpfen müsste."
"Ein Schlachtplan." Das Gesicht des Jungen nahm einen verklärten Ausdruck an.
"Ein Schlachtplan, hm ..." Bellbrook klatschte sich Rasierwasser auf die Haut, was eigentlich erst nach dem Duschen dran gewesen wäre. "Vielleicht kann man es so nennen. Eigentlich eher ein Plan, wie man künftig Schlachten verhindern könnte."
"Keine Schlacht?" Der Junge zog die Augenbrauen zusammen. "Aber du hast doch erzählt, wie toll es war, gegen die Russen zu kämpfen."
"Hab' ich nicht."
"Hast du doch!"
Verflixt noch mal - dieser Knirps kriegte mehr mit, als Bellbrook für möglich hielt. Natürlich hatte er von der Operation >Wüstensturm< erzählt, aber es war ihm nie bewusst gewesen, dass er begeistert davon erzählt hatte.
"Ich hab' nicht gegen die Russen gekämpft sondern gegen die Irakis. Gegen Saddam Hussein genauer gesagt. Und das war nicht toll gewesen."
"Ich dachte."
"Falsch gedacht. Und jetzt putz dir die Zähne - ich muss unter die Dusche." Er zog seinen Morgenmantel aus und stieg in die Duschkabine.
"Dad?"
"Ja?"
"Wenn du in Brüssel einen Iraki oder einen Russen siehst - kannst du mir den auch mit meiner Kamera fotografieren?"
"Da seh' ich nur Franzosen und Deutsche." Er drehte den Wasserhahn auf.
"Dann fotografier mir eben einen Deutschen!", brüllte sein Sohn um das Rauschen des Wassers zu übertönen.
"Mach' ich!", schrie Bellbrook.
Eine Stunde später saß er auf dem Beifahrersitz seines Cadillacs. In seiner Uniform. Seine Frau Patricia steuerte die Limousine über die Manhattan Bridge nach Brooklyn hinein. Um neun Uhr hatte er einen Termin auf der U.S. Naval Air Station. Drei Stunden würde er sicher mit den Offizieren zusammensitzen um die Richtlinien für seine Teilnahme an der Konferenz im NATO-Hauptquartier in Brüssel auszuarbeiten.
Als einer von drei Vertretern der US-Army sollte er ein Herbstmanöver der NATO-Truppen im Mittelmeer vorbereiten. Kein Job, der Major William Bellbrook vom Hocker reißen konnte. Aber er musste getan werden. Und seit er nach seiner Verwundung Anfang der neunziger Jahre in der strategischen Planungsgruppe der NAT O mitarbeitete, spielte sich sein geliebtes Soldatenleben nun mal vor Monitoren, Wandkarten, Reißbrettern oder am Sandkasten ab. Besser, als gar nichts. Aber manchmal eben doch zu wenig für einen Heißsporn wie Bellbrook.
Im Golfkrieg hatte er mit einer Landungstruppe der Marine einen strategisch wichtigen Artilleriebunker-Komplex der Irakis gestürmt. Das hatte ihn acht Männer und ein spiegeleigroßes Stück seiner Schädelplatte gekostet. Seitdem war es mit dem Dienst bei der kämpfenden Truppe vorbei. Obwohl er noch keine vierzig war.
Durch hohe Auszeichnungen und die Beförderung zum Major hatte sich die Army seine Dienste am grünen Tisch gesichert.
"Wann geht dein Flug?", wollte Patricia wissen.
"Vier Uhr fünfzehn vom JFK Airport. Ich habe einen halben Tag Aufenthalt in London."
"Und wann kommst du zurück?", fragte seine Frau zaghaft.
"In genau zwei Wochen, Darling."
"Verdammt lang." Sie kniff die Lippen zusammen.
"Ich weiß, Darling." Er beugte sich zu ihr hinüber und hauchte ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wangen. "Wenn ich in Brüssel fest im Sattel sitze, ziehen wir nach Europa."
"Ich weiß gar nicht, ob ich das will."
"Jetzt komm - du hast gewusst, dass du einen Mann heiratest, der mit Leib und Seele Soldat ist. Und jede amerikanische Frau weiß, dass man nicht ewig an ein und demselben Ort wohnen bleiben kann, wenn man einen Soldaten heiratet. Da muss man einfach flexibel sein."
"Aber gleich nach Europa ..."
Patricia war in Brooklyn aufgewachsen. Sie hatten sich in Brooklyn kennengelernt, sie hatten in Brooklyn geheiratet und in Brooklyn hatte sie Marc entbunden. Schon der Umzug in die West-Side vor zwei Jahren, wo Bellbrook ein Haus geerbt hatte, war ihr wie die Auswanderung auf einen anderen Kontinent erschienen.
Er hatte sich nicht groß um ihre Ängste gekümmert. Damals nicht und danach nicht. >Was man will, kann man auch<, war sein Standpunkt. Und er war davon überzeugt, dass man auch in Europa leben konnte. Wenn man nur wollte. Und als seine Frau hatte Patricia das zu wollen ...
Die Sitzung mit den Offizierskameraden dauerte vier Stunden. Nach einem ausgiebigen Mittagessen wurde ein Feldwebel abkommandiert, der ihn zum Kennedy International Airport chauffierte.
In der Flughalle blickte er auf die Abflugtafel. >London - Flug 712 - 16.15 Uhr ...<
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2017
- ISBN (ePUB)
- 9783738912142
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Juli)
- Schlagworte
- thomas west kriminalroman diamantenraub wolken