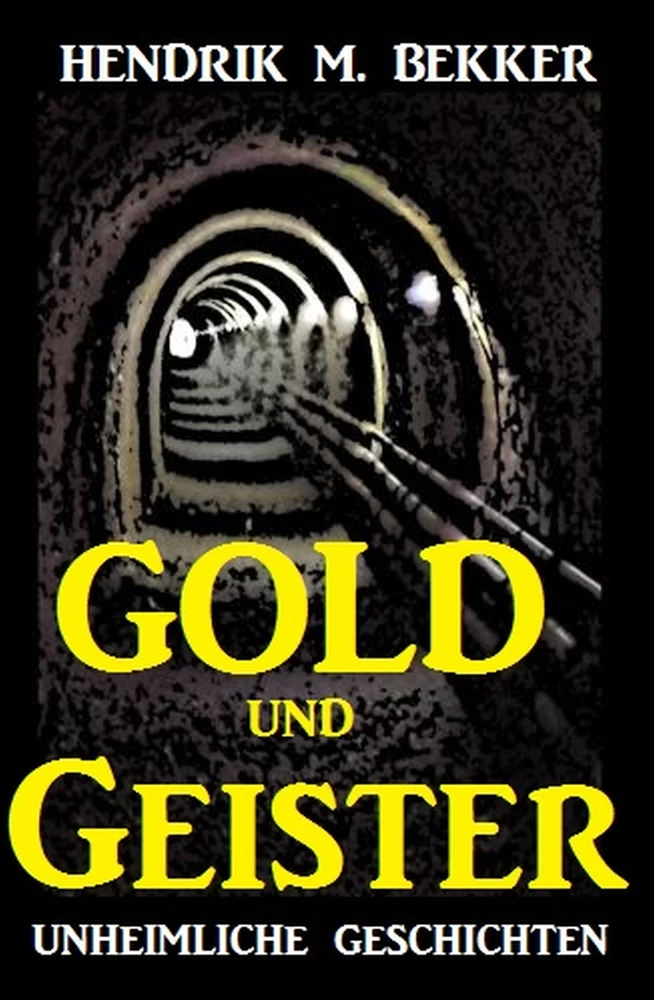Zusammenfassung
Unheimliche Geschichten
von Hendrik M. Bekker
Der Umfang dieses Buchs entspricht 184 Taschenbuchseiten.
Sei es ein alter Spiegel, ein verlassenes Museum oder das nächtliche Hamburg, an vielen Orten lauern mysteriöse Erscheinungen... Ein Makler in Ostfriesland hat Probleme mit einem ruhelosen Geist, der ein Haus befallen hat. Und manchmal kann man froh sein, seine eigene Haut zu retten.
Diese Anthologie enthält folgende Geschichten:
Hendrik M. Bekker: Verlorene Gelegenheiten kommen nicht zurück …
Hendrik M. Bekker: Das Gold der Kowaja-Berge
Hendrik M. Bekker: Preisnachlass wegen Geisterbefall
Hendrik M. Bekker: Mein Freund der Zwerg
Hendrik M. Bekker: McGrath - Magische Ermittlungen aller Art
Hendrik M. Bekker: McGrath 2: Thanatos
Hendrik M. Bekker: Nights of New York: Aufstand
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Gold und Geister - Unheimliche Geschichten
Published by Cassiopeiapress/Alfredbooks, 2017.
Gold und Geister
Unheimliche Geschichten
von Hendrik M. Bekker
Der Umfang dieses Buchs entspricht 184 Taschenbuchseiten.
Sei es ein alter Spiegel, ein verlassenes Museum oder das nächtliche Hamburg, an vielen Orten lauern mysteriöse Erscheinungen... Ein Makler in Ostfriesland hat Probleme mit einem ruhelosen Geist, der ein Haus befallen hat. Und manchmal kann man froh sein, seine eigene Haut zu retten.
Diese Anthologie enthält folgende Geschichten:
Hendrik M. Bekker: Verlorene Gelegenheiten kommen nicht zurück ...
Hendrik M. Bekker: Das Gold der Kowaja-Berge
Hendrik M. Bekker: Preisnachlass wegen Geisterbefall
Hendrik M. Bekker: Mein Freund der Zwerg
Hendrik M. Bekker: McGrath - Magische Ermittlungen aller Art
Hendrik M. Bekker: McGrath 2: Thanatos
Hendrik M. Bekker: Nights of New York: Aufstand
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© Cover by Hendrik M. Bekker
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
postmaster@alfredbekker.de
Verlorene Gelegenheiten kommen nicht zurück ...
von Hendrik M. Bekker
1
Karl Gordes saß gemütlich in seiner kleinen Küche. Er setzte die blau-weiße Teetasse ab und sah zur Uhr. Er fluchte laut und pustete die Kerze im Stövchen unter der Kanne aus. Dann sprang er auf und zog sich eine Jacke an. Während er das Haus verließ, schloss er noch schnell seine Wohnungstür ab und machte sich dann auf den Weg die Große Straße entlang. Es war die Haupteinkaufsstraße seiner Stadt. Er bog in eine Seitenstraße ein, in Richtung des alten Drogeriemarktes. Die Kette war pleite gegangen, seitdem hatte sich kein neuer Investor finden können. Dort fanden seit einiger Zeit kleinere Auktionen von Haushaltsauflösungen statt. Viele Leute hatten heutzutage keine Erben mehr und auf diese Weise konnte noch Geld für die Beisetzung gesammelt werden. Die Stadt hatte das Projekt begrüßt und unterstützte es mit der Überlassung einer ungenutzten Immobilie. Karl ging gerne zu den Auktionen.
Er hoffte auf den ein oder anderen Glückstreffer bei der Auktion. Außerdem genoss er es, sich die Leute anzusehen, die boten. Seitdem Jakob Hinrichs diese Auktionen regelmäßig durchführte, waren sie vom Geheimtipp zu einer regionalen Attraktion geworden. Ob ältere Leute, die Eiche-rustikal-Möbel bevorzugten, oder Studenten der örtlichen Hochschule, die sich preiswert aber hochwertig einrichten wollten, bis hin zu Hausfrauen, die einfach nur ein Schnäppchen machen wollten, alles war vertreten. Es erinnerte ihn an die Flohmärkte, auf denen er mit seinem Vater früher immer gewesen war. Es war ein geschäftiges munteres Treiben voller Fremder und doch interessanter Leute. Als Karl den kleinen, ehemaligen Drogeriemarkt betrat, hatte die Auktion schon angefangen. Er ließ sich am Eingang ein Schild mit Nummer geben und setzte sich ins Publikum. Gut drei Dutzend Menschen waren anwesend, für einen Donnerstagabend eigentlich ziemlich gut.
Wer ein Gebot abgab, hob das Schild. Durch die Nummer war klar, wer die Person war und man brauchte nur zu sagen, was man bereit war zu zahlen. Wer nicht bar oder mit Karte zahlen konnte, da er das Geld nicht besaß, bekam den ersteigerten Gegenstand auch nicht ausgehändigt. Dann wurde er beim nächsten Mal erneut versteigert.
Gerade kam ein verzierter fünfzig Jahre alter Schreibtisch unter den Hammer. Er erinnerte an den Bauhausstil der goldenen Zwanziger.
Dann kam ein Spiegel. Dieser Spiegel gefiel Karl sofort. Dabei war er nicht besonders auffällig gearbeitet, er war nicht einmal offenkundig wertvoll.
Doch Karl war sich ziemlich sicher, dass es ein mittelalterliches Stück sein konnte. Das hier war auf jeden Fall ein solide gearbeitetes Stück mit hohem Alter.
So was hatte einen gewissen Wert bei Sammlern und durchaus auch bei Museen. Ansonsten konnte er es immer noch jemandem verkaufen, der auch glaubte, dass es alt und wertvoll war.
Dazu kam, dass der Spiegel einen Holzrahmen hatte. Holz ließ sich C14-datieren und so das wahre Alter ziemlich genau feststellen. Kohlenstoff-14-Atome kamen in jedem Lebewesen vor und wenn man aufhörte einen Stoffwechsel zu haben, weil man tot war, zerfiel es langsam. Daraus ließ sich das Alter bestimmen, oft auf wenige Jahre genau. Karl hatte zum Glück einen Studienkollegen, der sich mit der Ausrüstung der Universität ein wenig dazu verdiente. Solche Altersnachweise waren gern gesehen in den höheren Antiquitätenhändlerkreisen. Auch mancher Kunde, der mehr des Prestiges wegen ein altes Stück kaufte, als weil er wirklich Ahnung hatte von Antiquitäten, wollte so einen Nachweis.
„Der folgende Spiegel von Fritz Jakobs wurde im Haus vorgefunden. Es ist möglicherweise ein Erbstück, das der verstorbene Herr Jakobs hinterließ. Das Alter wurde von einem Fachmann auf mehrere hundert Jahre geschätzt. Leider gibt es keine klar datierbaren Verzierungen. Der Spiegel ist ohne Holzwurm, ohne Sprung und solide gearbeitet. Er hat kein Hersteller- oder Werkstattzeichen. Ich erwarte die Gebote“, begann der Auktionator. Er war nicht ganz bei der Sache. Bei Stücken, die er für wirklich wertvoll hielt, wurde er deutlich enthusiastischer. Karl kannte das schon. Das hier war mehr das Standardprogramm.
Karl machte ein faires Angebot. Nicht allzu viel, aber doch einen vernünftigen Preis.
Zu seiner Überraschung bot ein etwas älterer Mann mit ihm. Er hatte ihn schon einige Male gesehen, immer wieder bot er für Gegenstände. Manches Mal bot er ziemliche Summen, um Dinge zu bekommen. Nach welchem Muster er das tat, wusste Karl nicht. Möglicherweise war er Antiquitätenhändler. Er wusste nur, dass er sich „Herr ten Dornan“ nennen ließ. Der Mann überbot ihn, viermal in Folge. Karl zögerte erst, dann bot er weiter mit. Langsam ging es Karl nicht mehr nur um den Spiegel, es ging auch ums Gewinnen. Der Mann ging immer einige Euro über seinen Betrag! Irgendwann reichte es Karl. Hier ging es jetzt ums Prinzip! Er bot einen Betrag hundert Euro über dem aktuellen Angebot. Ein Raunen ging durch den Raum. Der andere Mann schien im Kopf zu rechnen, dann war alles vorbei. Karl hatte gewonnen! Der Mann ging nicht mit. Karl seufzte zufrieden und überlegte dann, ob es wirklich sinnvoll gewesen war. Doch für langes Nachdenken blieb keine Zeit, die nächsten Angebote kamen. Nach mehreren interessanten Stücken, bei denen er überboten wurde, entschied er sich, dass es genug war. Er ging zur Abholstelle und zahlte den gebotenen Preis für den Spiegel. Er hatte das Geld in bar dabei. Am Abend würde man ihn liefern.
2
Später am Abend saß Karl vor dem Fernseher und sah sich die Sportschau an. Irland hatte gegen Deutschland gespielt, kein berauschendes Ergebnis für die Deutschen. Zumindest nicht, wenn man das vorher an den Tag gelegte Selbstvertrauen mit beachtete. Es klingelte an der Haustür.
Karl schlurfte zur Tür. Ein freundlich lächelnder Mann im Trainingsanzug begrüßte ihn.
„Moin, hier is‘ Ihr Paket, nech. Haben Sie heute ja ersteigert, Karl Gordes, nech?“
Karl nickte.
„Dann unterschreiben Sie mal hier, nech“, sagte der Mann im Trainingsanzug und reichte Karl ein Formular. Karl überflog es, es war eine Empfangsbestätigung. Er kannte das Formular schon, es war nichts Anstößiges daran. Nach dem Unterschreiben reichte er es dem Mann zurück. Daraufhin holte der Mann im Trainingsanzug ein großes Paket aus seinem VW-Bulli und trug es ihm in den Flur.
„So, viel Spaß, nech“, sagte der Mann und war auch schon verschwunden. Karl kam gar nicht dazu, ihm einen Fünfer in die Hand zu drücken und ihn zu bitten, den Spiegel nach oben zu bringen.
Er seufzte. Wieder einmal war die Welt zu schnell für ihn.
Zuallererst räumte er im oberen Stockwerk seines Reihenhauses im Flur ein Stück der Wand leer, dann machte er sich daran, den Spiegel nach oben zu schaffen. Sein Rücken machte ihm seit einiger Zeit zu schaffen, zu viel Büroarbeit, zu wenig Bewegung, sagte der Arzt.
Stufe für Stufe brachte er mühsam den Spiegel nach oben. Er hängte ihn in sein Lesezimmer. So nannte er den großen Raum voller Bücher im zweiten Stock seines Reihenhauses.
Er lebte alleine dort und empfing selten Besuch. Es war nicht so, dass er kein Interesse an anderen Menschen oder einer Partnerin gehabt hätte, es hatte sich nur nie ergeben.
Oft, wenn er versuchte Bindungen aufzubauen oder aufrecht zu halten, scheiterte er. So vermied er sie irgendwann, um auch den Schmerz zu vermeiden.
Im Lesezimmer hängte er den Spiegel auf. Er war schön gearbeitet und bereits für die Auktion gesäubert worden.
Karl nahm sich vor, ihn ein paar Tage hängen zu lassen, bevor er entschied, was er mit ihm tat. Immerhin war er ziemlich teuer gewesen. Er kochte sich einen neuen Tee und setzte sich aufs Sofa im Lesezimmer. Dabei machte er das Radio an. Irgendein Sender, bei dem die ganze Zeit geredet wurde.
Anschließend nahm er sich ein Buch und begann zu lesen.
Er mochte das Gerede des Radios im Hintergrund. Es gab ihm das Gefühl, dass es Leben im Haus gab.
Während er las, griff er immer wieder nach seiner Tasse. Dann klirrte es, als er sie verfehlte und sie umstürzte.
Er fluchte, sprang auf und eilte in die Küche, um etwas zum Aufwischen zu holen.
Während er den Tee vom Linoleum damit aufwischte, fiel ihm etwas Seltsames auf.
Er ließ das vollgesogene Küchenpapier liegen und trat zum Spiegel.
Erst jetzt begriff er, was ihn stutzig gemacht hatte.
Der Raum war der Gleiche wie der, in dem er stand. Nur war Karl nicht zu sehen.
Er ging ins Badezimmer und sah in den Spiegel. Dort war er, so wie er sich kannte.
Er zog ein paar Grimassen. Sein Spiegelbild tat es ihm gleich.
Dann trat er erneut vor den Spiegel im Lesezimmer. Immer noch war dort kein Spiegelbild.
Er trat näher heran und hauchte dagegen. Es bildete sich kein Fleck, wo sein Atem die Oberfläche berührte.
Dann beugte sich Karl so weit vor, dass seine Nasenspitze den Spiegel berühren musste.
Doch sie tat es nicht. Da war kein Spiegel, es war vielmehr wie beim Fassen durch einen Fensterrahmen.
Er schrak zurück.
Dann hängte er den Spiegel ab und lehnte ihn an die Wand.
Vorsichtig machte er einen Schritt hindurch und kletterte auf die andere Seite.
Der Raum war der gleiche, selbst der Spiegel lehnte dort, wo er es eben getan hatte. Der einzige Unterschied war, dass der Raum verkehrt herum war. Was links stand, war rechts und umgekehrt.
Er sah sich um.
„Schatz?“, fragte eine brünette Frau, die im Türrahmen zum Lesezimmer stand. „Ist dir nicht gut?“
Karl fand keine Worte. Diese Frau, er kannte sie! Es fiel ihm nur nicht mehr ein woher. Sein Blick wanderte ihre Silhouette hinab, über ihr einladendes tief ausgeschnittenes Dekolleté hinab zu ihrer Hüfte.
„Ähm“, setzte er an. Dann fiel es ihm ein. Er hatte sie schon mal getroffen. War das im Studium? War das eine Frau, mit der er sich mal verabredet hatte?
„Komm her“, sagte sie und trat zu ihm, da er sich nicht bewegte. Sie duftete nach irgendwelchen Blumen, doch er wusste nicht, was für welche. Ihm gefiel der Duft. „Wenn dir nicht nach reden ist, ist das auch in Ordnung“, flüsterte sie ihm ins Ohr.
3
Es klingelte, laut und drängend. Karl öffnete die Augen und sah sich um.
Er lag alleine in seinem Bett, in Boxershorts und Socken. Erneut betätigte jemand die Türklingel. Wieder drückte dieser jemand mehrmals, was dem Klingeln etwas Forderndes gab.
Karl stand auf und zog seine Jeanshose an. Wer auch immer ihn störte, musste mit seinem nackten Oberkörper vorliebnehmen.
An der Tür war ein älterer Mann in einem Anzug, über dem er einen Kurzmantel trug. Er deutete eine Verbeugung an.
„Guten Tag, Herr Gordes“, sagte der Mann. „Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie gestern einen Spiegel bei einer Auktion ersteigert haben?“
„Hmm“, brummte Karl.
„Hätten Sie Interesse, den Spiegel zu verkaufen?“
„Sie sind dieser andere, der mitgeboten hat“, stellte Karl fest, der das Gesicht plötzlich einzuordnen wusste.
„Balthasar ten Dornan, ja. Ich habe großes Interesse an diesem Spiegel.“
„Tja, der ist aber gerade nicht zu verkaufen“, stellte Karl patzig fest. Was fiel diesem Kerl ein? Wer von den Auktionsveranstaltern hatte dem seine Privatadresse gegeben?
„Sie haben sich gar nicht meinen Preis angehört“, stellte Balthasar ruhig fest. Karl begann die Tür zu schließen.
„Werde ich auch nicht.“
Bevor sie ins Schloss fallen konnte, schob Balthasar ten Dornan seinen Fuß dazwischen. Karl hörte, wie der Mann scharf einatmete.
„In Ihrem und meinem Interesse sollten Sie mich anhören“, stellte Balthasar fest. „Dieser Spiegel ist der Tod seines Besitzers.“
„Ach was, auf einmal ist er verflucht, wenn man nicht verkaufen will?“, erwiderte Karl.
„Ich beschäftige mich damit, solche Dinge aus dem Verkehr zu ziehen. Der Spiegel erahnt Ihre Wünsche und ...“, setzte Balthasar erneut an, doch Karl drückte seinen Schuh zur Seite und zog die Tür zu.
Er ging zum Frühstück. Das Klingeln des Fremden ignorierte er einfach, bis dieser aufgab. Er schüttelte den Kopf. Erst dieser seltsame Traum und dann so ein schlechter Verlierer, der ihm Blödsinn erzählte.
Er wusste noch, dass er vor dem Einschlafen durch den Spiegel getreten war und den Abend mit dieser hinreißenden Frau verbracht hatte, seiner Ehefrau, wie sie sagte. Er seufzte. Es war einer der realistischsten Träume seit Langem gewesen und dabei auch einer der besten.
Wobei, das mit dem Spiegeltreten kam ihm bekannt vor. Ob er das schon mal bei Stephen King gelesen hatte? Dessen Bücher hatte er früher gerne und immer wieder gelesen. Da musste sein Unterbewusstsein die Inspiration her haben.
Karl ging nochmal ins Lesezimmer und sah sich den Spiegel an. Dabei beugte er sich vor und packte mit der Hand darauf. Er fühlte die Kälte des Spiegels und seine Finger hinterließen deutliche Fettflecken.
Zufrieden lächelte er. Was für ein mieser Antiquitätenhändler, der Leuten mit Geschichten Angst machen will.
Karl sah auf die Uhr und fluchte. Er beeilte sich, um pünktlich zur Arbeit zu kommen und verließ das Haus.
Als er später abends nach Hause kam, fand er an seiner Haustür die Karte von Balthasar ten Dornan vor. Er hatte sie in den Briefkastenschlitz gesteckt.
Karl warf sie in den Müll und machte es sich mit einem Teller Dosenravioli in seinem Lesezimmer gemütlich.
Während er so den Stimmen im Radio lauschte, dachte er noch einmal über den Spiegel nach. Noch immer lehnte er an der Wand.
Er stellte die Schale ab und trat vor den Spiegel.
Als er sich vorbeugte, war dort kein Spiegelbild zu sehen.
Er atmete scharf ein.
Das kann nicht sein, ging es ihm durch den Kopf.
Er reckte den Kopf hinein. Tatsächlich, wie ein Fenster, überlegte er.
Erneut kletterte er hindurch und sah sich um. Das Lesezimmer sah ganz anders aus. Es waren viele Dinge dort, die dort nicht sein sollten. Die persönliche Note von jemand anderem, ging es ihm durch den Kopf.
Dann rief jemand nach ihm. Es war eine Frauenstimme. Er ging die Treppe hinab und fand dort eine Frau vor, mit flammenden roten Locken. Sie half einem kleinen Jungen beim Ausziehen seiner Winterstiefel. Dabei berichtete er ihr mit gewichtiger Miene von seinem Schultag.
„Schatz, ist irgendwas?“, fragte die Frau. Diese Frau kannte er. Es war eine Kollegin, die er vor einigen Jahren mal zum Essen eingeladen hatte. Eine freundliche Dame, die er sehr anziehend gefunden hatte. Aber er hatte sich wohl nicht richtig um sie bemüht und so war sie irgendwann in eine andere Abteilung versetzt worden und der Kontakt abgebrochen.
4
Einige Wochen später saß Balthasar ten Dornan auf einem der billigen Klappstühle bei einer Auktion.
„Wir haben hier einen Spiegel, in sehr gutem Zustand. Er wurde von seinem Vorbesitzer erst kürzlich erworben und es handelt sich um ein sehr altes Stück“, begann der Auktionator sein neuestes Stück anzupreisen.
Balthasar hob seine Nummer und rief eine Zahl. Der Spiegel musste aus dem Verkehr gezogen werden. Diesmal durfte ihn niemand überbieten. Karl Gordes hatte ihm nicht geglaubt. Der Spiegel ernährte sich von der Lebenskraft der Menschen und zeigte ihnen dafür, was sie sich wünschten. Die Illusion war perfekt und so versanken die Menschen immer tiefer, bis von ihnen nicht mehr übrig blieb als ausgemergelte Hüllen.
Ein anderer überbot Balthasar. Balthasar hielt dagegen, doch der Fremde zog die Stirn ärgerlich in Falten und verdoppelte den Preis. Balthasar ten Dornan fluchte. So viel Geld hatte er nicht dabei ...
ENDE
Das blutige Gold der Kowaja-Berge
von Hendrik M. Bekker
1
Allan McFadden schlug immer wieder auf den Fels vor sich ein. Dieser Stein war verflucht hart! Stück um Stück konnte er ihn zersplittern, doch Gold kam nicht zum Vorschein.
Er wischte sich mit dem Handrücken über die verklebte Stirn. Schweiß und Staub bildeten eine dicke Schicht.
Hatte ihn diese dreckige Rothaut etwa belogen?
Er leckte sich über die Lippen, schmeckte den feinen Staub, der nach Stunden der Arbeit alles bedeckte. Seine Kehle brannte. Was würde er jetzt für einen kleinen Whisky geben.
Nein, ganz sicher hatte die Rothaut sie nicht betrogen. Er hatte gewusst, dass sonst seine Frau hätte dran glauben müssen. McFadden, Clive und Thomas hatten die Indianer bei einem kleinen Stelldichein in den Wäldern überrascht. McFadden und seine Männer waren auf der Flucht. Es gab seit langem das Gerücht, dass es Gold in den nahen Bergen gab. Doch angeblich wussten nur die Indianer davon. Also hatte Allan vorgeschlagen, doch einfach einen Indianer zu fragen. Doch sie hüteten das Geheimnis.
Nun, dieser hatte schließlich nachgegeben, dachte Allan McFadden und sein Grinsen wurde breiter. Wieder und wieder schlug er mit der Spitzhacke zu.
Hier sollte es doch sein!
Er und seine beiden Begleiter waren auf der Flucht hinauf in den Norden. Alle wurden aus verschiedenen Gründen an der mexikanischen Grenze gesucht. Doch McFadden wollte keinesfalls als armer Schlucker enden. Er wusste schon immer, er war zu Höherem bestimmt.
Dann endlich war es soweit. Eine dünne, goldgelbe Ader war im Fels zu erkennen.
McFadden nahm seinen ledernen Trinkschlauch und goss Wasser darüber, um den Staub loszuwerden.
Tatsächlich, es war das Ziel seiner Träume.
„Gold“, hauchte er. „Gold!“, brüllte er dann lauter.
Wenige Minuten später waren Clive Brown und Thomas Debroer bei ihm. Sie arbeiteten nun nur noch in Schichten hier, weil der Stollen zu eng war, um den Dreien die Arbeit gleichzeitig zu erlauben.
Er mochte seine Kompagnons nicht, doch sie waren aufeinander angewiesen. Jeder auf seine Weise.
2
Tagelang ging es so weiter. Als nun nach Stunden Allan eine Pause hatte und sich den kleinen Haufen goldener Klumpen ansah, war er zufrieden. Davon würde man sich ein hübsches Sümmchen Geld auszahlen lassen können. Ihm fiel auf, dass Thomas und Clive nun seit Tagen bewaffnet herumliefen. Immer, zu jeder Zeit.
Er sah zu seinem Holster herunter. Sein dicker Colt ruhte auf seinem Oberschenkel.
Seit wann hatte er damit angefangen? Hatte Clive angefangen, oder er?
War Clive nicht mal wegen Befehlsverweigerung beim Militär herausgeflogen? Er kramte in seinem Gedächtnis, kam aber nicht mehr darauf.
Er erinnerte sich daran, wie der Indianer gesagt hatte, das Gold sei verflucht von irgendeinem heidnischen Wesen. Blutgold sei es, es würde sich vermehren, wenn es Blut zu trinken bekäme.
McFadden schüttelte den Kopf. Was für ein heidnischer Bullshit.
3
Clive Brown war ein Mann, der die besten Jahre bereits hinter sich hatte. Er wusste das, während er mit der Zunge über den Zahnstumpf fuhr, der von seinen Schneidezähnen übrig geblieben war. Er trug den eisenbeschlagenen Holzeimer zum Berg von Nuggets, den sie bereits aufgehäuft hatten.
Der Eimer war rostig, aber noch hielt er das Holz zusammen. Clive dachte mit Freude daran, was er sich alles von seinem Anteil würde leisten können! Gold, zu einem kleinen Haufen aufgetürmt. Kurz wanderte sein Blick in weite Ferne. Vielleicht würde er eine kleine Farm haben? Sicher, hübsch war er nicht, doch mit genug Geld in den Taschen fand er sicher eine Frau.
Er erinnerte sich daran, wie sein Vater seine Mutter behandelt hatte. Die war schließlich auch geblieben, obwohl man eine Lady so nicht behandeln sollte. Hatte man ihm beim Militär später gesagt. Aber die hatten so einiges gesagt, was für ihn wenig Sinn machte. Zum Beispiel, dass Zivilisten so ungemein respektvoll behandelt werden mussten. Clive fühlte, wie trocken sein Mund wurde, als er daran zurückdachte, wie er dieses Bauernmädchen zurechtgewiesen hatte. So kokett war sie gewesen und so sehr hatte sie geschrien.
Er hielt kurz inne und stellte den Eimer ab. Dann nahm er einen der Trinkschläuche, die herumlagen, und trank gierig das Wasser daraus. Er brachte im Moment die Nuggets herauf, und auch wenn die Aufgabe sicher schöner war, als mit der Spitzhacke im Fels zu wühlen, war es verdammt anstrengend. Aber das hatte man im Militär immer gesagt und Clive fand, dass es wahr war: Nichts Gutes bekam man geschenkt, man musste es sich nehmen. Oder war es verdienen? Er wusste es nicht mehr genau.
Er griff nach dem Eimer und fluchte. Das Metall schnitt ihm in die Hand und Blut tropfte herab.
Dabei sah er fasziniert, wie es auf die goldenen Steine traf und versickerte. Doch nicht zwischen den Steinen, es verschwand in die Steine. Wie Wasser, das auf lockere Erde traf, saugten die Steine das Blut auf.
Er blinzelte ungläubig. Er war sich sicher, dass er einfach nur überarbeitet und erschöpft war. Die Steine konnten doch das Blut nicht aufnehmen wie weiche Erde. Was für ein Unsinn.
Allan McFadden wird dich für das Gold töten, flüsterte eine Stimme. Erschrocken sprang Clive auf. Woher war das gekommen? War es nur ein plötzlicher Gedanke gewesen? Er sah sich um. Doch die Stimme war wirklich aus seinem Kopf gekommen.
Er wird dich töten und dein Blut wird die Steine vermehren. Der Gedanke war so klar in ihm und doch völlig fremd, als wäre es nicht sein eigener.
Clive schüttelte ungläubig den Kopf. Der Gedanke begann an ihm zu nagen. Dann, neugierig, blickte er hinab zu dem Stein, der sein Blut aufgesogen hatte.
War diese Ausbeulung am Goldnugget vorher schon da gewesen? Oder war sie genau dort, wo sein Blut aufgekommen war?
Er verwarf den Gedanken, das war doch verrückt. Er brauchte eine Pause.
4
Später am Abend brachte Clive einen neuen Eimer mit Goldnuggets hinauf. Thomas war unten und schürfte nun. McFadden saß beim Gold und starrte es an. Seine Haare hingen in fettigen Strähnen ins Gesicht, angeklebt vom Schweiß. Doch er schien sie nicht zu bemerken.
„Na, was kaufst du dir davon?“, fragte Clive. Er fühlte sich angespannt. Irgendwas stimmte nicht. War McFadden schon immer so fasziniert vom Gold gewesen? Blinzelte er eigentlich noch regelmäßig?
Allan McFadden sah weiter vor sich hin. Dann, wie aus tiefer Ferne, sprach er: „Ich werde es mehren.“
„Willst du etwa ins Casino?“, fragte Clive und lachte. Es klang künstlich, leicht angespannt.
McFadden sah auf. „Was sagst du?“ Er blinzelte ein paar Mal schnell hintereinander.
„Nichts, nur, ob du damit ins Casino gehst?“
„Damit man es mir wegnimmt? Nein. Das nimmt man mir nicht mehr weg. Ich will, dass es mehr wird.“
„Das ist doch schön“, sagte Clive und bewegte langsam und unauffällig seine Hand zum Colt.
Er fühlte sich nicht wohl. Irgendwas stimmte doch nicht.
5
Thomas Debroer hieb die Spitzhacke in den Fels vor sich. Er war wütend. Auf sich, auf die Welt, auf seine tote Frau und auf die beiden Halunken, mit denen er arbeitete.
Er war wütend darauf, so wütend zu sein. Das Einhacken auf etwas tat gut, seiner Meinung nach. Er wusste, dass er viel zu selten die Gelegenheit bekam die Wut herauszulassen. Einmal hatte er einen Mann auf offener Straße erwürgt, weil er ihn beleidigt hatte.
Doch seitdem musste er sich aus dem Grenzgebiet zu Mexiko fernhalten.
Nur, weil er sich verteidigt hatte! Als wäre er ein Tier, das keine Selbstkontrolle hatte. Was für ein Unsinn. Wie die Leute sich aufgeregt hatten, dabei hatte er sich nur angemessen verteidigt. Lehrte einen das Leben nicht, schnell zu sein?
Er hörte einen Schuss.
Sofort warf er die Hacke weg und lauschte. Sein Colt lag nahe bei ihm im Holster. Beim Arbeiten behinderte ihn das nur.
Er griff nach dem Colt und ging hinauf zu den anderen.
Er hoffte, dass es nicht diese Indianer waren, die Rache wollten, weil sie hier ihr Gold stahlen.
Dabei benutzten die Rothäute es doch gar nicht! Sie ließen es hier liegen. Was für eine Verschwendung.
6
Allan McFadden fand, dass Clive nervös wirkte. Seltsam unruhig und gekünstelt. Das machte ihm Sorgen. Clive war ein Halsabschneider, das hatte er immer gewusst. Aber er würde sich an eine Abmachung halten. Doch als er sah, wie Clive seine Waffe langsam zog, reagierte Allan McFadden automatisch. Er zog seinen eigenen Colt, doch da donnerte es bereits.
Der Schuss traf ihn direkt in die Brust und schlug in seinen Knochen ein. Die Wucht riss ihn nach hinten.
Er taumelte gegen die Höhlenwand und sank an ihr herunter.
„Wieso?“, hauchte er.
7
Clive sah den sterbenden Allan McFadden. Er hatte seine Waffe ziehen wollen, dieses Schwein! Clive wusste schon immer, dass McFadden ein dreckiger Dieb war, der seine eigene Mutter verkaufen würde, doch er hatte geglaubt, er würde sich an eine Abmachung halten können.
Clive schüttelte den Kopf. Er trat gegen die Hand von McFadden, die die Waffe hielt. Der Colt klapperte davon. Nicht dass er im Sterben doch noch schoss.
Da hörte er Schritte. Thomas Debroer stürmte hinauf, seine Waffe im Anschlag. Er betrat die Höhle und sah sich um.
„Wer greift uns an?“, fragte er Clive, die Situation missdeutend.
Clive hatte noch immer den Colt in der Hand und drückte ab.
Schuss um Schuss feuerte er in Thomas hinein. Die Tränen traten ihm in die Augen. Um ihn tat es ihm wirklich leid. Doch wie sollte er ihm das erklären? Er würde glauben, dass er McFadden umgebracht hatte, um sich zu bereichern. Doch das würde er nie tun!
Zufrieden sah er auf den Berg aus Gold.
Plötzlich klackerte es neben ihm.
Er sah auf. Ein Stein hatte sich gelöst. Es knirschte und knackte plötzlich. Noch bevor er reagieren konnte, brach die Decke zusammen.
Das nächste, was Clive einatmete, war Felsstaub während er versuchte aus dem Stollen zu entkommen.
8
Wochen später ...
Prediger Ferdinand Rysum schob sich den alten Dreispitz tiefer ins Gesicht. Es war der Hut der Uniform seines Großvaters. Der hatte in den Unabhängigkeitskriegen gekämpft. Der Hut war geflickt, aber gut. Das Leder war gepflegt und immer noch besser, als die Sonne direkt auf den Kopf zu bekommen. Manchmal fragte er sich, ob er deswegen Prediger geworden war: Um das Unrecht seiner Vorväter wiedergutzumachen.
Andererseits, musste jeder sein eigenes Unrecht wiedergutmachen. Zumindest war er der festen Überzeugung. Diese katholische Lehre, die von der Erbsünde, sagte ihm nicht zu. Ein gerechter Gott bestrafte ja wohl jeden für seinen eigenen Mist.
Er ritt seinen jungen Hengst Epo gemächlich einen Abhang hinunter.
Er wollte vor Sonnenuntergang noch New-Theene erreichen. Das war eine kleine Siedlung, eingerahmt zwischen weiten ebenen Feldern und einigen Bergen. Die Indianer hier waren stark dezimiert worden durch die Pocken und machten den Menschen keinen Ärger, ebenso wenig wie der Unabhängigkeitskrieg es bis hierher geschafft hatte.
Es gab einiges an Handel durch den breiten Fluss, was viel Gesindel anzog. Aber das war unumgänglich.
Hier sollte er seinen neuen Beruf antreten. Ferdinand war Prediger und diese Gemeinde hatte ihren Pastor vor einem halben Jahr verloren. Man hatte bei der Nachbargemeinde angefragt und so war irgendwann die Wahl auf Ferdinand gekommen. Er hatte verschiedene Berufe ausgeübt und ein Freund hatte ihm Unterschlupf gewährt, als es ihm nicht gut ging. So war er mit dem Predigen in Berührung gekommen. Nun hatte dieser Freund ihn hergeschickt, um in New-Theene als Pastor zu dienen.
Schließlich tauchten die Häuser der kleinen Siedlung vor ihm auf. Der Fluss zog sich als Band durch das Land und die Baumgruppen wurden deutlich überragt von den dreistöckigen Häusern. Es waren neun Häuser, die so groß waren und um die sich der Rest der deutlich niedrigeren Gebäude drängte.
Die Stadt lärmte vor Geschäftigkeit. Ferdinand fragte sich ob ihm das nur so vorkam, weil die Natur vorher so ruhig gewesen war, oder ob er sich das einbildete.
Er ritt gemächlich an einen Mann im Dreiteiler heran, der auf seine Uhr sah, und fragte: „Guten Tag, der Herr, ich suche das Pastorat des Ortes.“
„Da muss ich Sie enttäuschen, der Pastor ist tot, dort wird Ihnen nur die Haushälterin die Tür öffnen können“, erwiderte der Mann.
„Das trifft sich gut, denn ich bin der neue Pastor“, erwiderte Ferdinand und verbeugte sich so tief es ihm auf dem Pferd möglich war.
Der Mann sah ihn kurz überrascht an und lachte dann.
„Nun, wenn Sie meinen, trifft sich das wirklich. Ich bin der Hilfssheriff Tom FitzPatrick“, stellte sich der Mann vor.
„Angenehm“, nickte ihm Ferdinand zu.
„Ich schicke ihnen dann nachher mal Coppersmith vorbei. Er ist hier der Sheriff und ehrlich gesagt auch der Bürgermeister.“
„Selten, eine solche Doppelung.“
„Der alte Bürgermeister liegt im Krankenbett. Sumpffieber, wir werden sehen, ob er es schafft. Bis dahin gibt es aber keine gute Alternative zu Coppersmith“, stellte FitzPatrick fest. „So ist es am besten.“
„Sicher“, stimmte Ferdinand zu. „Wie komme ich zum Pastorat?“
FitzPatrick beschrieb ihm den Weg und Ferdinand machte sich auf den Weg.
Das Pastorat war ein am Rand der Siedlung gelegenes einstöckiges Haus mit einigen kleinen Wirtschaftsgebäuden daneben. Nicht weit davon erhob sich auf einem Hügel die hölzerne Kirche. Sie war aus Rundhölzern errichtet, anders als das mit Holzbrettern gebaute Pastorat.
Die Kirche war hoch und Ferdinand vermutete, dass ein skandinavischer Baumeister dafür verantwortlich war. Selten war eine Holzkirche so erhaben in ihrer Bauweise.
Er war noch nie in der Alten Welt gewesen, doch hörte er gern Geschichten von dort. Immerhin waren die Vorfahren einst von dort gekommen, um hier einen neuen Garten Eden zu errichten.
Ferdinand Rysum band sein Pferd am Zaun fest und klopfte ihm auf den Rücken.
„Bin gleich zurück, mein Guter“, stellte er fest und ging zur Haustür. Im Vorgarten waren diverse Kräuter und Nutzpflanzen angebaut. Sie ergaben die Form eines Kreuzes, wobei der Weg zur Tür einen der beiden Kreuzbalken darstellte.
Er klopfte dreimal fest gegen die Tür. Schritte kamen näher und schließlich machte ihm nach einer gefühlten Ewigkeit eine junge Frau auf. Sie hatte rabenschwarzes Haar und ihre Augen waren etwas zu schmal für Ferdinands Geschmack.
„Ja bitte?“, fragte sie. Sie trug ein dunkles Kleid, das hoch geschlossen war und ihr etwas Matronenhaftes gab.
„Ferdinand Rysum, der neue Pastor“, stellte er sich vor. „Ich wurde von Dean Traviss geschickt, er wollte mich postalisch ankündigen.“
„Das hat er“, stellte die Frau fest und musterte ihn. Die Zeit verstrich und langsam fühlte sich Ferdinand unwohl. Er wusste nicht genau wieso, doch diese Pause war einfach zu lange.
„Dann wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn sie mich einlassen würden“, stellte Ferdinand fest und sah sie erwartungsvoll an.
Sie nickte ruckartig und ließ ihn herein.
„Bitte, den Flur runter ist der Salon, dort können wir uns hinsetzen.“
Der Salon war ein hübscher lichtdurchfluteter Raum mit einer zweiflügeligen Tür. Im Inneren standen schwere Sessel mit Lederbezug und drei Regale, die eine ganze Wand ausfüllten. Sie waren vollgestopft mit Büchern, selbst auf den normalen Buchreihen lagen noch weitere Exemplare quer.
Ferdinand legte seinen Mantel und den Hut vorsichtig auf eine Stuhllehne und setzte sich. Die Haushälterin setzte sich ihm gegenüber.
„Ihr Name, gute Frau?“
„Meliassa“, erwiderte sie.
„Keinen Nachnamen?“
„Keinen.“
Er hob die Augenbrauen. „Bitte? Wie darf ich das verstehen?“
„Im Ort wissen es doch eh alle. Der alte Pastor nahm mich auf, fand mich im Wald. Vermutlich war meine Mutter ‘n Schlitzauge und wollte keinen Bastard, denn reinblütig bin ich sicher nicht“, stellte Meliassa fest.
Ferdinand musterte sie. Dann zuckte er die Schultern.
„Und, so sind Sie als Haushälterin hier gelandet?“
„Ja. Werd‘ ich es auch bleiben?“
Ferdinand merkte an der Beiläufigkeit, mit der sie das sagte, wie sehr es sie bewegte.
Das war der Grund für ihre Zurückhaltung.
„Seien Sie unbesorgt. Ich bewerte Sie, wie es der Herr tut: an Ihren Taten. Ich bin kein Freund der Erbsünde, Sie werden an sich gemessen.“
Sie sah Ferdinand kurz mit großen Augen an, dann lachte sie von Herzen.
„Sie klingen wie er. Ich mache uns mal einen Tee.“
Damit stand sie auf und ging in die Küche.
„Wie wer?“, rief Ferdinand ihr hinterher.
„Der alte Pastor. Pastor Jakob.“
9
Später am Nachmittag hatte Ferdinand sich alles zeigen lassen und seine Privatsachen eingeräumt, als der Sheriff an der Tür klopfte. Bei ihm war Tom FitzPatrick. Sheriff Will Coppersmith war ein älterer Mann mit Lederweste und Glatze, die er durch einen üppigen Backenbart zu kaschieren versuchte.
Der Sheriffstern prangte gut sichtbar an der Lederweste und an seiner Seite baumelte ein alter Colt. Es war ein Armeemodell, soweit kannte Ferdinand sich aus.
„Sheriff“, nickte Ferdinand ihm zu.
Er bat ihn in den Salon, Meliassa brachte ihnen Tee.
„Sie wirken gestresst, Sheriff“, stellte Ferdinand fest.
„Das is‘ nichts, was einem Prediger gefallen würde.“
„Erzählen Sie es mir bitte trotzdem. Ich möchte über die Belange des Ortes Bescheid wissen. Ich schätze es, dass es einen Wachhund unter den Schafen gibt“, stellte Ferdinand klar. „Ich schätze keine unnötige Gewalt, aber auch ich weiß, dass es Menschen gibt, mit denen man sich nicht einigen kann. Mit denen man nicht verhandeln, argumentieren oder sie auf den rechten Weg bewegen kann.“
Der Sheriff musterte ihn und nickte dann ruckartig.
„Wir machen eine Menschenjagd.“
„Eine Menschenjagd?“
„Sie wissen, was das ist?“
Ferdinand nickte. „Natürlich. Nur wieso machen Sie eine? Wem wird was zur Last gelegt?“
„Es ist ein Mann. Wir sind nicht ganz sicher, wie er heißt, er streift seit Wochen durch die Wälder und hat schon acht Leute auf dem Gewissen. Zumindest wissen wir das von denen. Ob er noch andere Reisende überfallen hat, kann ich nicht ausschließen.“
Ferdinand steckte sich eine Pfeife an und bot dem Sheriff ebenfalls eine an. Dieser lehnte ab.
„Aber einen Schluck könnte ich vertragen“, erwiderte er mit Blick auf eine Kristallflasche auf dem Tisch.
„Bedienen Sie sich“, sagte Ferdinand. Es war immerhin schon Nachmittag.
Pfeife stopfen und anzünden hatte auf Ferdinand immer etwas Beruhigendes, eine Handlung, die einem Zeit zum Nachdenken verschaffte.
„Wann wird es losgehen?“
„Direkt morgen früh. Wir müssen das selbst machen. Ich will nur Männer, denen ich vertraue. Hab über ein Kopfgeld nachgedacht, aber dann hat man gleich den ganzen Abschaum dabei“, stellte Coppersmith klar.
Ferdinand nickte. Er blies einen kleinen Rauchkringel in die Luft.
„Ich möchte sie begleiten.“
Coppersmith lachte und prustete in sein Glas. Kurz fiel die ganze Anspannung von ihm ab und Ferdinand erkannte einen fröhlichen Menschen in ihm. Dann legte sich seine Stirn wieder in Falten.
„Wieso sollte ein Prediger uns helfen? Wollen Sie ihn anlocken, mit Verlaub?“
„Ich denke, eine Jungfrau in Nöten wäre da attraktiver als ich“, erwiderte Ferdinand trocken. „Mir geht es darum zu helfen. Ich bin einige Monate mal mit ein paar Trappern gereist und kann in der Wildnis auf mich aufpassen.“
„Sie wollen Präsenz zeigen“, sagte Coppersmith und Ferdinand war sich nicht sicher, ob es Anerkennung oder Kritik in seiner Stimme war.
Ferdinand nahm einen tiefen Zug aus seiner Pfeife und blies wieder einen Rauchring. Ein nussiges Aroma verbreitete sich langsam.
Coppersmith betrachtete Ferdinand nachdenklich. Dann nickte er.
Er zog eine kleine Karte aus der Tasche.
„Die können Sie haben. Sehen Sie hier, dort ist das Gebiet, in dem Sie suchen werden. Wir durchkämmen das Gebiet mit drei Dutzend Mann. Jeder von ihnen hat eine Marke von mir bekommen, klein, rund, mit einem Kreuz. Ich lasse Ihnen eine zukommen. Das sind alte Münzen, die ich hab umschmieden lassen. Wenn Sie irgendwen finden und gefangen nehmen, haben Sie so die Sicherheit, dass es keiner von den eigenen Leuten ist.“
Ferdinand nickte anerkennend. „Dann danke ich Ihnen, dass ich dabei bin.“
Sie saßen noch ein wenig beisammen und unterhielten sich über den Ort und die letzten Wochen. Zudem bekam Ferdinand etwas genauer geschildert, wer verschwunden war.
Der Ort war nicht so groß, dass nicht jeder zumindest vom Sehen wusste, wer verschwunden war. Ob sie tot waren, wusste man nicht genau. Coppersmith hatte die vage Hoffnung, dass sie vielleicht an Schlepper verkauft worden waren und irgendwo in einer Miene arbeiteten. Dann könnte man sie retten. Ferdinand hoffte, dass er recht hatte, aber er äußerte seine Zweifel nicht. Was würde es bringen?
10
Am nächsten Morgen versammelten sie sich alle auf einer großen Lichtung. Mehrere Dutzend Männer waren dabei, unterschiedlichste Berufe. Alle hatten Pistolen oder Gewehre dabei, auch wenn einige der Waffen älter aussahen. Coppersmith hielt eine kurze Ansprache, dann ging es los.
Bald war Ferdinand alleine im Wald und führte sein Pferd am Zügel hinter sich her. Da sie sich sternförmig in alle Himmelsrichtungen ausbreiteten, war bald kaum noch etwas von den anderen zu sehen. Letztlich waren sie nur das Ablenkungsmanöver, hatte ihm Coppersmith im Vertrauen erklärt. Der Sheriff würde mit einem Fährtenleser losziehen, um den hoffentlich aufgescheuchten Mörder zu finden. Umso mehr Leute im Wald unterwegs waren, umso mehr behinderten sie sein Verstecken.
11
Bis zum Abend hatte Ferdinand immer noch niemanden entdeckt. Er entschied, dass er umdrehen musste, um vor Mitternacht zurück zu sein. Er wollte nicht, dass die anderen sich Sorgen machten. Plötzlich erkannte er die Silhouette von einem Menschen im Wald. Er legte die Hand auf die Pistole und rief: „Hey da. Hände so, dass ich sie sehen kann. Wer ist da?“
Der Mann hob die Hände wie befohlen und kam näher.
„Begrüßt man sich so, da wo Sie herkommen, Mister?“
„Tut mir leid, aber man muss vorsichtig sein“, stellte Ferdinand fest.
Der Mann nickte. Er trat noch näher, nun war er auf zwei Armlängen heran. Er wirkte heruntergekommen, zerschlissene Kleidung und eine Jacke, die zu groß war. Sein Bart war dicht und reichte bis unter die Augen.
„Vor was haben Sie denn Angst?“
„Vor wem, trifft es eher“, erwiderte Ferdinand.
„Haben Sie eine Marke?“, fragte der Mann. Ferdinand hob verblüfft die Augenbrauen.
„Sie wissen schon, alle, die suchen, haben eine“, stellte der Mann fest. Seine Stimme verriet Anspannung.
Ferdinand ließ die Waffe sinken und wollte ihm seine Marke reichen, da sprang ihn der andere an und entriss ihm seine Pistole.
Er schlug Ferdinand fest gegen das Gesicht.
Die Welt wurde dunkel.
12
Später erwachte Ferdinand, gefesselt an Händen und Beinen.
„Ah, Sie sind wach. Das tut mir leid“, erklärte der Mann. Sie saßen in einer kleinen Höhle. Es stank bestialisch. Ein Haufen roter Steine war es, der für den Geruch verantwortlich war.
„Sie“, murmelte Ferdinand und fühlte sich immer noch benommen.
„Ja, Sie waren nicht der erste mit Marke. Daher war das leicht“, stellte er fest. „Ich habe Sie beobachtet. Sie alle. Sie bekommen mich nie.“
Ferdinand versuchte sich zu konzentrieren.
„Wofür die Menschen entführen?“, brachte er hervor.
„Wegen des Goldes“, erklärte der Mann und aus seinen Augen blitzte es wahnhaft.
„Des Goldes?“, fragte Ferdinand
„Des Goldes!“, rief der Mann nun und deutete auf die rotbraunen Steine. „Umso mehr Blut es bekommt, umso mehr wird es. Damit werde ich reich, reich werd‘ ich.“
Ferdinand begriff schlagartig, wieso diese Steine verfärbt waren und woher der Gestank kam.
„Aber Sie sind doch schon reich“, stellte er fest, um Zeit zu gewinnen. Wenn all diese Steine in Wirklichkeit Nuggets waren, war der Mann in der Lage, sich nicht nur eine Ranch zu kaufen, sondern einen kleinen Staat.
Ferdinand versuchte dabei an ein Messer zu kommen, das er im Stiefel trug. Es war nicht groß, aber es würde reichen, sich zu befreien.
Der Mann sah ihn plötzlich irritiert an und schlenderte zum Gold. Er nahm eines der Nuggets und strich es zärtlich.
Ferdinand bekam endlich das Messer zu fassen und drehte es so, dass er in seine Handfessel schneiden konnte.
„Aber es wird immer mehr. Jetzt bin ich reich, aber wie wäre es, noch reicher zu sein? Nur etwas. Nur etwas weniger Sorgen haben“, murmelte er.
Ferdinand bekam endlich seine Hände frei. Er stand langsam auf und näherte sich dem Mann. Dieser bemerkte, was passierte und zog die Waffe.
Ferdinand warf sich auf ihn und schlug ihm so hart er konnte ins Gesicht, packte den Lauf der Waffe und drückte ihn nach oben. Sie rangen miteinander. Ein Schuss krachte und dröhnte durch die Höhle. Blut spritzte über Ferdinands Gesicht.
Der fremde Mann sackte nach hinten, ein Teil seines Gesichts fehlte.
Ferdinand spuckte Blut aus und betrachtete das Gold. Blut lief darüber und ließ es wirken, als wäre es in Bewegung.
Er atmete tief durch, dann packte er seine Sachen und nahm eine leere Munitionskiste.
Darin verstaute er die Nuggets und verließ die Höhle. Er konnte von hier aus die Stadt New-Theene sehen. Die Kiste hinter sich her schleifend, machte er sich auf den Weg. Der Mond schien hell und war bereits wieder auf dem Abstieg. Ferdinand wusste genau, was zu tun war. Der Mann hatte recht, dieses Gold war besonders.
13
„Sie sind sich sicher?“, fragt Coppersmith.
„Beerdigen wir ihn auf dem Friedhof. Egal wer es nun war, er hat Vergebung verdient“, erklärte Ferdinand. Er und der Sheriff saßen im Salon. Meliassa brachte beiden ein frisches Bier.
„Und der Rest?“
„Das Gold hat er sich eingebildet. Sie waren in der Höhle. Da war keines. Er war verrückt.“
„Nicht besessen?“, fragt Coppersmith mit Spott in der Stimme.
„Sheriff, es gibt böse Menschen. Gäbe es das Böse nicht, wie könnten wir Güte und Gnade erfahren?“, erwiderte Ferdinand scharf.
„Nichts für ungut“, sagte der Sheriff.
Ferdinand nickte und sah aus dem Fenster hinaus in den Garten.
Dort hatte er das Gold vergraben. Niemand würde es nehmen. Vielleicht würde er es irgendwann den Armen geben können ohne aufzufallen. Vielleicht würde sich dieser Zeitpunkt aber nie ergeben. Es war zu gefährlich, zu verdächtig, jetzt etwas zu tun. Er würde es erst einmal in sicherer Verwahrung behalten. Es war nie verkehrt, etwas in Reverse zu haben.
Der Sheriff würde es ihm schließlich nur wegnehmen, beschlagnahmen, und dann? Würde er es für sich behalten.
Nein, es war besser bei ihm aufgehoben, er würde darauf aufpassen.
Jetzt war er reich, was konnte besser sein? Außer vielleicht, noch reicher zu sein ...
ENDE
Preisnachlass wegen Geisterbefall
Gruselkrimi aus Ostfriesland
von Hendrik M. Bekker
1
„Davids“, meldete sich Theodor Davids am Telefon. Einen Moment war nichts im Hörer zu vernehmen.
Dann begann ein Mann zu sprechen. Es begann für Theodor wie immer. Er bekam eine kleine Lebensgeschichte erzählt. Am Ende dann wurde der Termin vereinbart.
Theodor war ein Mittvierziger und seit fast zwanzig Jahren in der Maklerbranche tätig. Er überprüfte die Adresse während des Telefonats im Internet. Ostfriesland, nahe Emden.
Er würde sie sich erst morgen ansehen. Jetzt noch von Oldenburg rauf zu fahren war ihm zu lang. Die Stadt war der Erbverwalter und wollte die Immobilie schnell loswerden.
2
Es war ein stattliches Haus, eher die Villa eines Gutsbesitzers als ein alter Bauernhof.
Viel hatte Theodor bei der Stadtverwaltung nicht erfahren. Das Haus war vermutlich sehr alt, mit Grundmauern aus dem Mittelalter. Theodor ahnte, was das hieß: Schwer zu vermitteln, da alle Renovierungsarbeiten in Konflikt geraten konnten mit dem Denkmalschutz. Einerseits veränderte das Denkmalschutzsiegel die mögliche Käuferschicht, andererseits wurde sie damit auch kleiner. Viel Geld fand sich eben nur bei wenigen. Die letzte Besitzerin war an Herzversagen gestorben, nach einer Woche von ihrem Zivi gefunden worden, der regelmäßig nach ihr schaute.
Ein Auto hielt in der Einfahrt. Patrick „Paddy“ Schuman stieg aus.
„Was haben wir genau?“, fragte er.
„Alte Frau, tot. Das Haus gehört nun, mangels Erben, der Stadt. Es soll weg, du sorgst dafür, dass es leer wird. Vierzig Prozent für die Stadt. Es gibt ein paar Interessenten, denke ich. Ist allen lieber als eine Zwangsversteigerung“, erklärte Theodor kurzangebunden. Paddy nickte. Er arbeitete seit Jahren mit Theodor zusammen. Er war Gebrauchtwarenhändler und hatte einen großen, viel über das Internet handelnden Laden: „Von Antiquitäten bis Zündstoff“, und ein großes Lager in Bremen.
Sie gingen zur Tür und Theodor schloss auf.
„Geschmackvoll“, bemerkte Patrick. Sie betraten einen Flur mit dunklem roten Teppich und einer großen alten Standuhr. Patrick strich mit prüfendem Blick über das Holz der Uhr.
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2017
- ISBN (ePUB)
- 9783738912128
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2019 (Juli)
- Schlagworte
- gold geister unheimliche geschichten