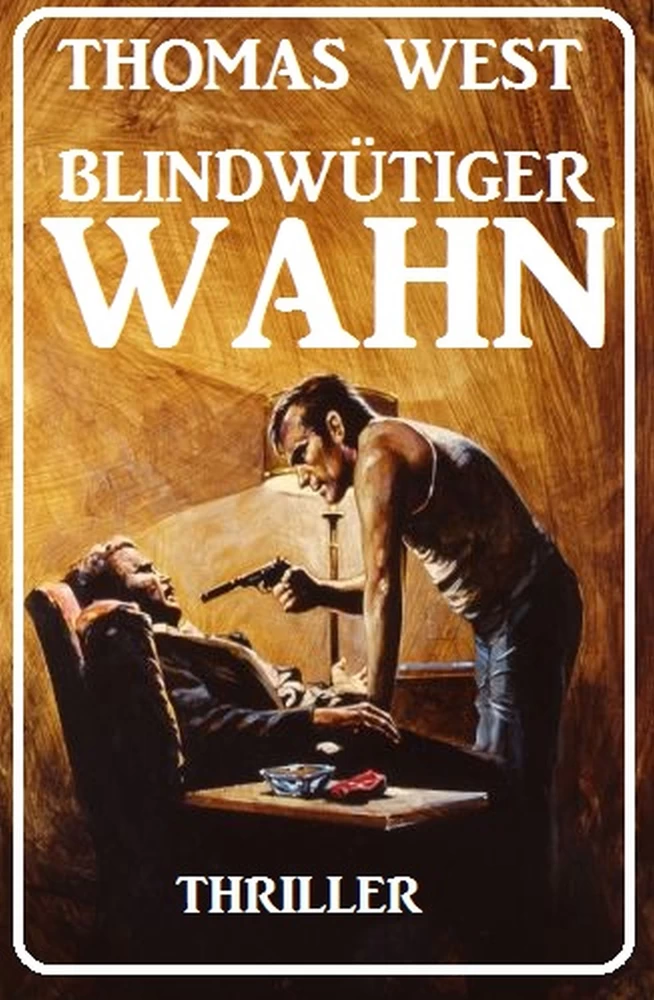Zusammenfassung
Thriller von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 236 Taschenbuchseiten.
Mickey Archer hält sich für auserwählt, die Welt von Dreck und Abschaum zu befreien – seit ihm diese weiße Gestalt erschien, die er Jefferson nennt. Der verlangt von ihm, die >Dreckschleudern< aus der Filmbranche zu beseitigen. Nach seinem ersten Opfer hatte sein Vater, der für die Präsidentschaft kandidiert, dafür gesorgt, dass die Sache vertuscht wurde. Stattdessen hatte man Mickey in einer psychiatrischen Anstalt mit Pillen vollgestopft; aber da die verhinderten, dass er Jefferson sah, nahm er sie nicht mehr. Seither versetzen die grausamen Morde des >Nagelkillers< in Kalifornien die Film- und Fernsehstars in Angst. Als der erste Mord in New York geschieht, werden die Special Agents Jesse Trevellian und Milo Tucker vom FBI auf den Serienmörder angesetzt ...
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Blindwütiger Wahn
Thriller von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 236 Taschenbuchseiten.
Mickey Archer hält sich für auserwählt, die Welt von Dreck und Abschaum zu befreien – seit ihm diese weiße Gestalt erschien, die er Jefferson nennt. Der verlangt von ihm, die >Dreckschleudern< aus der Filmbranche zu beseitigen. Nach seinem ersten Opfer hatte sein Vater, der für die Präsidentschaft kandidiert, dafür gesorgt, dass die Sache vertuscht wurde. Stattdessen hatte man Mickey in einer psychiatrischen Anstalt mit Pillen vollgestopft; aber da die verhinderten, dass er Jefferson sah, nahm er sie nicht mehr. Seither versetzen die grausamen Morde des >Nagelkillers< in Kalifornien die Film- und Fernsehstars in Angst. Als der erste Mord in New York geschieht, werden die Special Agents Jesse Trevellian und Milo Tucker vom FBI auf den Serienmörder angesetzt ...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author / Cover: Firuz Askin
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Prolog
Manhattan, Ende Oktober 1999
Ein Dunstteppich lag auf dem Hudson. Als würde das Wasser kochen. Aber es kochte nicht. Es war kalt. Eiskalt.
Langsam glitten wir durch den nächtlichen Fluss. Keine heftigen Schwimmstöße, kein kraftvolles Rudern mit den Beinen - bloß nicht das Wasser allzu sehr bewegen, nur kein Plätschern verursachen. Die Konturen des Schiffrumpfes vor uns schälten sich immer deutlicher aus Dunkelheit und Dunst.
Es ging nicht nur darum, die Yacht möglichst schnell zu erreichen - es ging vor allem darum, sie unentdeckt zu erreichen. Jedes Geräusch konnte ein Todesurteil bedeuten. Ein Todesurteil für die Menschen im Rumpf des Schiffes ...
Milo schwamm an meiner rechten Seite. Die Kälte des Wassers kroch durch die Isolierschicht meines Tauchanzuges. Meine Fingerspitzen schienen sich bereits in Eiszapfen zu verwandeln. Dabei trugen wir Handschuhe und eine zweite Haut aus nicht leitendem Spezialkunststoff. Angeblich konnte man damit bei Wassertemperaturen knapp über dem Gefrierpunkt zwei Stunden lang überleben. Wir hatten nicht vor das zu testen.
Ich blickte mich um. Hinter uns, etwa vierzehnhundert Meter entfernt, ragte die nächtliche Skyline Manhattans in den dunklen Himmel. Ein Dschungel aus glitzernden Säulen unter einer matten Lichtkuppel. Keine Spur mehr von dem Kajak, der uns vom Battery Park aus bis auf dreihundert Meter an die Yacht herangebracht hatte. Dunst und Dunkelheit hatten seinen Schatten längst verschluckt.
Der Schiffsrumpf vor uns war jetzt deutlicher zu erkennen. Kein Motorengeräusch, kein aufschäumendes Wasser unterhalb des Hecks über der Schraube. Die Yacht trieb ohne Fahrt auf dem Hudson. Aber nicht ohne Besatzung. Das wussten wir.
Der Dunst kam uns entgegen. Mit ein bisschen Glück würden sie uns nicht entdecken. Den Kajak oder sonst ein Boot hätten sie längst gesichtet.
Vor mir schaukelte ein aufgeblasenes Kunststoffkissen. In ihm, geschützt vor der Nässe, ein Funkgerät, zwei Maschinenpistolen, ein Nylonseil und ein paar Blendgranaten.
Schweigend glitten wir durch Wasser und Dunst. Noch knapp fünfzig Meter bis zur Yacht. Wir steuerten ihr Heck an. Ein Lichtfleck schob sich aus ihrem Schatten in unser Blickfeld. Die Statue of Liberty im Licht der Strahler. Etwa anderthalb Kilometer entfernt. Und dahinter, im Dunst kaum noch wahrnehmbar, die Skyline von Jersey City.
Milos Arm hob sich aus dem Wasser. An der Yacht vorbei deutete er nach Süden in den Himmel. Ein Band verwaschener Lichtflecken schimmerte über der nächtlichen Upper Bay. Als würde ein Fackelzug dort oben flussaufwärts schweben. Mit ein bisschen Fantasie konnte man sich auch den Anflug einer Ufo-Flotte vorstellen. Oder noch exotischere Erscheinungen.
Es war natürlich kein Fackelzug. Und schon gar keine Ufo-Flotte. Es war das Ergebnis eines organisatorischen Meisterstücks der Zentrale. Dort, in der Federal Plaza, saßen Orry Medina und Clive Caravaggio. Und Jonathan McKee, unser Chef. Sie leiteten den Einsatz. Und sie legten ein perfektes Timing hin. Das Lichtband am Himmel war der Beweis.
Wir erreichten das Schiff. Eine Hochsee-Yacht von gut dreißig Meter Länge. Ich schob das Lastkissen an den Schiffsrumpf, Milo griff nach dem Nylonseil und legte den Kopf in den Nacken. Anderthalb Meter über uns die Heckreling der Yacht.
Wir lauschten. Eine Stimme drang aus der Dunkelheit. Eine Männerstimme. Irgendwo am Bug des Schiffes redete jemand. Und zwar ziemlich laut. Wir wussten nicht, mit wem der Mann sprach.
Die erste größere Klippe unseres Einsatzes lag vor uns. Mein Partner nahm den Widerhaken am Ende des Seils und wog ihn in der Hand. Eine dicke Gummischicht überzog das faustgroße, stachlige Teil. Ganz würden sich Geräusche nicht vermeiden lassen.
Milo warf den Widerhaken zur Reling hinauf. Er fiel über den Brüstungsholm der Reling, schlug dumpf gegen das Gestänge und pendelte hin und her. Atemlos lauschten wir. Keine Schritte, nichts. Noch immer die Stimme von der anderen Seite der Yacht. Irgendjemand schien am Bug zu stehen und die Lichter am Himmel zu betrachten.
Milo zog am Seil, bis sich der Widerhaken in der Reling verfing. Ich kletterte als erster an Bord. Meine klammen Finger schlossen sich um die Reling. Ohne die genoppten Innenflächen der Handschuhe wäre ich abgerutscht. Ich zog mich hoch, schwang mich über die Reling und drückte mich flach aufs Deck.
Wieder lauschen, wieder nach allen Seiten sichern. Keine Schritte näherten sich. Rechts die glitzernden Konturen des Big Apples, links, undeutlich, die Statue of Liberty im Scheinwerferlicht. Und über dem Hudson waberte der Dunst. Nacheinander reichte Milo mir die Ausrüstungsstücke hinauf.
Es passierte in dem Augenblick, in dem Milo über die Brüstung kletterte - ein seltsames Fauchen vom Bug her, ein dumpfer Knall, und plötzlich lag flackernder Lichtglanz über dem Dunst rechts und links des Schiffes.
Wir rollten uns dicht an die Deckaufbauten. Die Maschinenpistolen im Anschlag spähten wir zum Bug. Von dort kam das Licht. Wir sahen seine lodernde Korona, aber den Blick auf die Feuerquelle selbst verstellten uns noch die Deckaufbauten. Ich fröstelte.
Milo deutete hinauf zum Kajütendach. Wir kletterten hoch. Meter um Meter arbeiteten wir uns Richtung Bug voran. Es stank nach Benzin und verbranntem Haar. Behutsam schoben wir uns am Rettungsboot vorbei bis auf das Dach des Navigationsraums.
Und dann sahen wir das Feuer. Zwischen dem spitzen Winkel der Bugreling brannte es auf einer Art Tisch oder Podest. Es sah aus wie ein Scheiterhaufen. Grelle Flammen loderten über ihrem Fraß und schickten schwarzen Qualm in den Nachthimmel. In ihnen ein undefinierbarer Haufen brennbaren Materials. Nur eines erkannte ich genau - die Umrisse eines menschlichen Körpers ...
Eine Frostschicht überzog mein Zwerchfell und das Innere meines Brustkorbes. Der Atem stockte mir. Ein menschlicher Körper, ohne Zweifel - aus seinem Kopf ragte ein langer Gegenstand.
Ein Mann stand unter uns auf dem Vorderdeck zwischen Feuer und Navigationsraum. Wir konnten keine Waffe in seinen Händen erkennen. Er trug einen hellen Trenchcoat, blickte in den Himmel der heranschwebenden Lichterkette entgegen und breitete die Arme aus. Unverständliche Worte stieß er aus, beschwörend, flehend. Worte, die ich nicht begriff ...
Wir wussten, dass wir keinen gewöhnlichen Verbrecher jagten. Wir wussten, dass wir dem Wahnsinn auf der Spur waren. Ja, dem Wahnsinn. Aber etwas mit dem Kopf zu wissen, und etwas mit allen Sinnen zu erleben - das sind zwei Paar Stiefel...
Als hätte der Mann in dem hellen Trenchcoat meine Gedanken gespürt, drehte er sich um ...
*
Ein paar Tage später in der Federal Plaza. Schneeregen klatschte gegen die Fensterscheiben. Ich saß allein in unserem Büro. Der Sessel hinter Milos Schreibtisch war leer. Ich starrte in den bleigrauen Herbsthimmel. Die Spitzen der Hochhaustürme vor meinem Fenster verschwanden in dichten Wolken.
In allen Knochen hing mir die Erschöpfung. Und die Trauer. Vor mir auf dem Schreibtisch stapelten sich Papiere: Verhörprotokolle, Laborberichte, Aktennotizen, Personendossiers, Berichte des Erkennungsdienstes, und so weiter und so weiter.
Die Unterlagen mussten gesichtet und in eine sinnvolle Ordnung gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft wartete auf unseren Bericht. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Und alles in mir sträubte sich dagegen überhaupt anzufangen.
Weniger, weil ich die Arbeit für sinnlos hielt - nach meiner Einschätzung würde es nie zum Prozess kommen. Aber das war es nicht - ich wollte mit dem Fall einfach nichts mehr zu tun haben. Das war es. Ich wollte ihn so schnell wie möglich vergessen. Aber die erschütternden Bilder und Eindrücke hatten sich in den letzten Wochen zu einem klebrigen Netz verdichtet - wie eine Krake lag es auf meinem Hirn, sonderte Erinnerungen ab und raubte mir den Frieden.
Den Bericht für den Staatsanwalt zusammenstellen und dabei noch einmal alles mit meinem Partner durchsprechen - vielleicht hätte mir das geholfen. Vielleicht. Aber Milos Stuhl war leer, wie gesagt. Ich hatte Sehnsucht nach ihm.
Ich schaltete meinen PC ein. Das Laufwerk tickte, der Bildschirm flammte auf. Aus der untersten Schublade meines Schreibtisches fischte ich eine Schachtel Camel ohne Filter. Ich griff selten zu ihr. Aber das war eine von den Stunden, in denen ich eine Zigarette brauchte.
Ich zündete sie an und blies den Rauch gegen den Aktenstapel auf meinem Schreibtisch. Zuoberst lag ein umfangreiches Dossier über den Mann, der uns so viele schlaflose Nächte bereitet hatte. Vor allem Krankenberichte.
Ich griff danach und schlug sie auf. Eine üble Geschichte. Vermutlich hatte sie schon vor vielen Jahren angefangen. Aber wenn man den Akten glaubte, begann sie erst vor wenigen Monaten ...
1
Manhattan, SoHo, 27. April 1999
Ein Mädchen kletterte die Feuertreppe hinauf. Mickey zog den Vorhang noch ein Stück weiter zurück. Das Mädchen hatte hellblondes, langes Haar.
Er blinzelte über die Green Street in die gusseiserne Fassade auf der anderen Straßenseite. Das Mädchen kletterte auf die Gitterrostplattform des dritten Stockwerks. Es trug ein ärmelloses, weißes Kleid, das ihm bis zu den Knöcheln reichte.
Normalerweise hätte Mickey sich darüber gewundert. Immerhin war es Ende April - ein nasskalter Wind fegte seit Tagen durch Manhattan. Aber Mickey wunderte sich nicht. Fast war ihm, als hätte er nichts anderes zu sehen erwartet, als er sich wenige Augenblicke zuvor aus dem Bett geschoben und zum Fenster geschleppt hatte. Nichts anderes, als dieses Wesen in dem ärmellosen Kleid und mit dem blonden Langhaar.
Das Mädchen trat an die Brüstung. Seine Hände schlossen sich um die Aluminiumholme der Rettungsplattform. Es stützte sich auf und sah zu Mickey herüber.
Mickeys Apartment lag ebenfalls im dritten Stock. Sie befanden sich also auf gleicher Höhe. Er winkte. Das Mädchen reagierte nicht. Eine Windböe wehte ihm das Langhaar ins Gesicht. Das Mädchen machte nicht einmal Anstalten, sich die Strähnen aus Augen und Stirn zu streichen.
Mickey schob das Fenster hoch. Er beugte sich heraus. Es stank nach Abgasen und Ozean. Unten auf der Green Street wälzte sich eine Blechschlange vorbei. Lauter Pendler, die versuchten den Stau auf dem Broadway zu umfahren. Die abendliche Rushhour hatte die Stadt bereits im Griff. Mickey hatte lange geschlafen.
"Hi!" Er winkte noch einmal. "Wie geht's so!?" Das Mädchen reagierte nicht. Reglos stand es an der Brüstung und sah zu ihm herüber. Mickey kniff die Augen zusammen. Er hatte bis gegen Morgen gearbeitet, dabei viel zu viel Gras geraucht, und sich danach schlaflos auf der Matratze gewälzt. Sein Kopf dröhnte, das Bild des Mädchens verschwamm vor seinen Augen. Er hätte gern sein Gesicht gesehen.
"Moment - nicht weglaufen!" Er ruderte mit beiden Armen. "Ich komm' gleich zurück!" Über Bücher, Magazine, leere Flaschen, Kleider, Schuhe und CD-Hüllen hinweg stolperte er zu seinem Kleiderschrank. Er riss die rechte Tür auf. Seine Rechte tastete sich durch das Chaos im obersten Schrankfach. Zwischen Tabaksdosen, Pistolen, Wasserpfeifen, und Camping-Ausrüstung fand er endlich seinen Feldstecher. Er stürzte zurück ans Fenster, setzte die Gläser an die Augen und spähte hinüber in die gusseiserne Fassade. Das Mädchen war weg.
So begann der Tag, an dessen Ende Michael Jefferson Archer begreifen würde, dass er dazu ausersehen war die Welt zu retten.
Bis zu dieser Einsicht war es noch ein Weilchen hin. Noch begriff Mickey gar nichts. Vor allem begriff er nicht, wo das Mädchen geblieben war.
Jedes einzelne Fenster der gegenüberliegenden Hausfassade suchte er mit dem Feldstecher ab, jede Treppe des Feuerleitersystems, jede Plattform, die Dachkante, auch den Bürgersteig vor dem Haus. Nichts.
Ratlos blickte er noch ein Weilchen hinüber. Dann warf er seinen Feldstecher auf die Matratze und zog das Fenster herunter. "Schade", murmelte er.
Das Ticken seines altmodischen Weckers drang in sein Bewusstsein. Ein golden glänzendes Ding mit römischen Ziffern und zwei Glocken rechts und links des Bügels. Mickey bückte sich und fischte ihn aus dem Durcheinander von Büchern und Kleidern neben seiner Matratze. Kurz nach vier. Um fünf hatte er ein Date im >Actor's Studio< am Washington Square. Fechtunterricht war angesagt.
Er nahm ein paar Äpfel und eine Flasche Wasser mit ins Badezimmer. Während das heiße Wasser in die Wanne strömte, betrachtete er sich im Spiegel. "Morgen, Mickey. Alles klar?"
Er drückte die Zahncreme auf seine Zahnbürste. Die Zahnbürste war schwarz, genau wie die Kacheln des Badezimmers und das Kunststoffregal hinter der Badewanne. Hingebungsvoll putzte er sich die Zähne. Dabei beobachtete er sein Spiegelbild. Etwas daran verwirrte ihn. Etwas war anders als sonst. Er zog die Zahnbürste aus dem Mund und beugte sich über das Waschbecken dem runden Spiegel entgegen.
Ein schmales, hohlwangiges Gesicht blickte ihm entgegen. Große, leicht gebogene Nase, breiter Mund mit farblosen, rissigen Lippen, ein kleines Kinn mit einem kurzen Ziegenbärtchen. Das Gesicht eines Halbwüchsigen. Dabei stand Mickeys sechsundzwanzigster Geburtstag ins Haus. Am zweiten Mai. Er hatte eine Fete geplant.
Als wollte er die Wirklichkeit des Spiegelbildes überprüfen, strich er sich über sein dunkles Stoppelhaar. Die Hand, die im Spiegel das Gleiche tat, kam ihm fremd vor. Hatte er schon immer solch große, langgliedrigen Hände gehabt?
Neben Mickey plätscherte das Wasser in die Wanne. Wasserdampf stieg auf. Der Spiegel beschlug sich. Das Gesicht darin verschwand hinter einer Nebelwand. Mit der flachen Hand wischte Mickey über die feuchte Schicht auf dem Spiegelglas. Ein bogenförmiger, breiter Streifen entstand. Braune Augen blickten ihm daraus entgegen. Braune Augen unter schwarzen Brauen und einer hohen Stirn.
Die Augen waren es. Der gehetzte Ausdruck war aus ihnen verschwunden. Seit Wochen gehörte dieser Ausdruck zu Mickey wie die Krümmung seines Nasenrückens oder sein kurz geschorenes Haar zu ihm gehörte. Jetzt war er verschwunden.
Sanft und ruhig lächelten ihm die Augen aus dem wasserdampffreien Streifen im Spiegel entgegen. Fast friedlich. Genau – friedlich ... Wie die Augen eines Menschen, der ganz und gar in sich selbst ruhte.
Selten hatte Mickey so etwas wie Frieden empfunden. Und schon gar nicht ruhte er in sich selbst. Noch nie. Sein ganzes Leben lang nicht. Staunendes Lächeln flog über das Gesicht im Spiegel. "Hey, Mickey", murmelte er, "du bist ja tierisch gut drauf heute ..."
Noch etwa zwei Stunden trennten ihn von der Schwelle zu seiner wahren Existenz.
Später in der Badewanne - Mickey nahm täglich ein heißes Bad, selbst im Hochsommer - versuchte er sich an seine Träume zu erinnern. Irgendetwas war da gewesen, während der wenigen Stunden Schlaf. Irgendetwas Bedeutungsvolles. Ein Bild, ein Gesicht, Bruchstücke eines Satzes. Das Bild des Mädchens auf der Feuerleiter drängte sich in seine Grübeleien.
Je länger er grübelte, desto gewisser glaubte er sich zu erinnern, von dem Mädchen geträumt zu haben.
Er trank Wasser und aß drei Äpfel. Seit sieben Tagen ernährte Mickey sich nur von Obst. Ohne besonderen Grund, einfach so. Seine Gedanken kreisten um das Mädchen. Er fragte sich, ob der ungewohnte Ausdruck in seinen Augen mit dem weißgekleideten, blonden Wesen zusammenhing.
Nach dem Bad zog er sich an. Schwarze Polycotton-Hosen, schwarzes Muskelshirt, schwarzes Leinenhemd, schwarzes Jackett, dunkelrote, knöchelhohe Turnschuhe. Mickey liebte Schwarz.
Während er in seine Kleider stieg, wanderte sein Blick zum Fenster. Wieder und wieder. Über die Green Street zur gusseisernen Fassade auf der anderen Straßenseite. Keine Spur mehr von dem Mädchen. Aber es war da, Mickey spürte es, irgendwo, ganz in seiner Nähe ...
Der Wecker - Mickey fragte sich, ob er nicht gestern noch leiser getickt hatte. Kurz vor fünf, es wurde knapp. Yoshiro, sein Fechtlehrer, verabscheute Unpünktlichkeit. Mickey warf sich seinen schwarzen Wildlederrucksack über die Schulter, verließ sein Apartment und lief die Treppe hinunter.
Vor den Briefkästen stand Larry Plymouth, der Freak, der seit zwei Monaten über ihm wohnte. Ein Afro, er grüßte und lächelte dabei sogar. Das hatte er noch nie gebracht.
Zwei Briefe im Briefkasten. Einer von seinem Vater, und einer vom >Actor's Studio<. Vor dem Haus blieb Mickey einen Augenblick stehen und schaute noch einmal hinüber auf die andere Straßenseite. Das Mädchen war nirgends zu sehen.
Im Dauerlauf lief er die Green Street bis zur Spring Street hinunter. Und dann die Spring Street bis zur Sixth Avenue. Dort hinunter in die Metro-Station. Die Bahn fuhr in dem Augenblick ein, als er den Bahnsteig erreichte. Mickey hielt das für ein gutes Zeichen. Auch dass er einen freien Platz fand, hielt er für ein gutes Zeichen.
Die Bahn fuhr an. Mickey dachte über die merkwürdige Häufung guter Zeichen an diesem Tag nach. Erst das blonde Wesen auf der Feuerleiter, dann seine Augen im Spiegel, dann Plymouth so freundlich, und jetzt die Bahn und der freie Platz. Das musste etwas zu bedeuten haben, ganz sicher hatte es etwas zu bedeuten. Mickey vermutete, dass es mit dem Mädchen zusammenhing. Ganz stark vermutete er das. Warum sonst spürte er die Gegenwart des Mädchens, obwohl der Zug ihn längst aus SoHo heraustrug?
Er blickte sich um. Das blonde Wesen in Weiß saß nirgends. Fast war er enttäuscht.
Blicke trafen ihn. Er glaubte zu sehen, dass einige Fahrgäste rasch die Köpfe drehten oder senkten oder hinter Zeitungen verschwinden ließen. Als hätten sie ihn zuvor die ganze Zeit beobachtet. Sie schauen mich an, dachte er, sie beobachten mich ... irgendwas ist an mir, das sie fasziniert, das sie beeindruckt ...
Noch knapp vierzig Minuten trennten ihn von seinem wahren Leben.
Er öffnete den Brief von der Schauspielschule. Sie wollten Geld von ihm. Auf über neunhundert Dollar waren seine Schulden bei der Schule inzwischen gewachsen.
Mickey finanzierte seine Ausbildung als Schauspieler hauptsächlich durch Thekenjobs. Seit Anfang des Jahres bediente er hinter der Theke des >Substages<, einer Discothek in der White Street. In letzter Zeit häuften sich auch die Anfragen kleinerer Theater. Obwohl er seine Ausbildung erst im Sommer abschließen würde. Mickey war einfach gut. Und so etwas sprach sich herum.
Während er den Brief von seinem Vater öffnete, wunderte er sich über die Ruhe, die ihn ausfüllte. Kein Knoten im Bauch, keine Enge in der Brust wie sonst, wenn er Post von seinem Vater bekam oder gar mit ihm telefonierte. Ganz entspannt fühlte er sich. Mickey entfaltete den Brief. Wie immer benutzte sein Vater auch diesmal den offiziellen Briefkopf des Senats. Mickey las:
Lieber Jefferson,
danke für deinen Brief. Schade, dass du nur dann schreibst, wenn du Geld brauchst. Du weißt, dass ich dir nicht nur das Studium, sondern auch das Leben in Boston oder Washington finanziert hätte. Für die Ausbildung in New York City musst du selbst aufkommen. Du kennst mein Prinzip - wer sich gegen besseren Ratschlag für einen Weg entscheidet, muss auch die Konsequenzen allein tragen.
Mum geht es gut. Mir auch. Wir melden uns an deinem Geburtstag.
Gruß. Dein Vater.
Mickey blickte in die dunkle Scheibe des Zugfensters. Dein Vater ... Die Tunnelwände rauschten vorbei. Jefferson ...
Sein Vater war der einzige Mensch auf der Welt, der ihn noch immer >Jefferson< nannte. Selbst seine Mutter hatte in der vorletzten Highschool-Klasse angefangen, ihn Mickey zu nennen. So wie seine Freunde ihn nannten.
Die Finger seiner Rechten zupften kleine Schnipsel aus dem Brief. Sie schwebten an seinen schwarzen Hosen entlang und landeten zwischen seinen Turnschuhen auf dem Boden.
Mickeys Vater hätte gern gesehen, dass Mickey Jura oder Volkswirtschaft studierte. Die Schauspielerei war ihm suspekt. Er verachtete sie sogar. Mickey glaubte nicht, dass es an der Schauspielerei lag. Er glaubte, dass es an ihm lag. Sein Vater verachtete ihn, glaubte er. Er glaubte das schon lange.
Der Zug bremste ab, Mickey stand auf. Sein Blick fiel auf den Boden. Lauter kleine Papierfetzen. Nur noch die Hälfte des Briefes hielt er in der Hand. Er faltete ihn zusammen und steckte ihn in sein Jackett.
Im Laufschritt jagte er die Treppe hoch. Und dann am Washington Square Park entlang. Das >Actor's Studio< lag zwischen der New York University und dem Washington Square Village. Er lief in das Grundstück hinein und vorbei an der großen Jugendstil-Villa in den Hof, wo die kleine flache Sporthalle der Schule stand.
Er kam fast zehn Minuten zu spät. Sechs meist junge Männer und Frauen hockten in einem weiten Kreis am Boden um den Fechtlehrer herum. Yoshiro Obaiyoshi, ein drahtiger, knapp vierzigjähriger Japaner, bedachte ihn mit einem finsteren Blick. Mickey nickte nur stumm. Obwohl er wusste, dass Yoshiro eine Entschuldigung erwartete.
Er zog Jacke und Hemd aus und setzte sich wortlos in den Kreis. Yoshiro räusperte sich, bevor er den Faden wieder aufnahm. "Also weiter - beim Sportfechten kommt es darauf an, den Gegner zu treffen. Anders gesagt, du musst dir Bewegungsabläufe und Schlag- und Stoßtechniken aneignen, mit denen du den Gegner überraschen kannst. Du musst seine Reaktionszeit unterschreiten, du muss ihn täuschen."
Zwei Jahre lang stand 'Bühnenfechten' auf dem Unterrichtsplan der vierjährigen Ausbildung. Mickey nahm seit einem halbem Jahr an dem Kurs teil. Zweimal in der Woche fand er sich mit den sechs anderen hier in der Halle zusammen, um bühnen- und filmreifes Fechten zu lernen.
"Ganz anders das Bühnenfechten - ich kann's euch nicht oft genug sagen", fuhr Yoshiro fort. "Hier kommt es genau auf das Gegenteil an: Dein Partner muss deine Bewegungsabläufe und deine Hiebe kennen und vorausahnen. Es ist ein Tanz, den ihr beide auf der Bühne oder vor der Kamera tanzt. Ein Tanz bei dem jede Schrittfolge festgelegt ist. Ein Tanz mit dem Degen!"
Der japanische Fechtlehrer sprach schnell. Er spuckte die Worte geradezu aus. Seine Miene aber und sein Körper blieben dabei vollkommen unbewegt. Mickey betrachtete das breite, harte Gesicht des Mannes. Wie eine Maske kam es ihm vor. Wie eine steinerne Maske, hinter der sich ein Unbekannter verbarg.
Zum ersten Mal kam Mickey der Gedanke Yoshiro wäre womöglich gar nicht Yoshiro.
Der Japaner bückte sich nach einem der acht Kurzdegen, die in einem Halbkreis zu seinen Füßen lagen. Zweimal ließ er die Klinge durch die Luft sausen. Das pfeifende Geräusch ließ Mickey erschauern.
"Ihr versteht", sagte der Japaner. "Ihr kämpft nicht wirklich. Aber wenn ihr kämpft, müsst ihr dem Zuschauer die Illusion vorgaukeln, ihr würdet kämpfen. Der Zuschauer muss davon überzeugt sein, dass ihr um euer Leben kämpft. Oder dass ihr um jeden Preis töten wollt ..."
Mit einer herrischen Handbewegung wies Yoshiro Obaiyoshi auf die Degen vor ihm am Boden. Die Schüler standen auf. Jeder griff sich eine Waffe. "Ihr habt inzwischen gelernt den Schwerpunkt eures Körpers stabil über der Standfläche eurer Füße zu halten und euch gemeinsam mit dem Partner auf einer gemeinsamen Gefechtslinie zu bewegen."
Das Mädchen von der Feuertreppe tauchte auf Mickeys innerer Bühne auf. Er glaubte, ihre Nähe zu spüren. Unwillkürlich sah er sich um.
"Bist du bei der Sache, Mickey?", schnarrte Yoshiro. Mickey nickte. Der Japaner winkte ihn zu sich. Breitbeinig nahmen sie zwei Schritte voneinander entfernt Aufstellung. Die Degen gezückt, die Oberkörper leicht nach vorn gebeugt standen sie sich gegenüber. Ohne Vorwarnung ging Yoshiro auf Mickey los. Leichtfüßig tänzelte der zur Seite, zog die Klinge hoch, fing den Hieb des anderen ab, und griff selbst an. Yoshiro parierte, die Degen klirrten aufeinander.
So ging das ein Weilchen hin und her, der eine griff an, der andere wehrte ab, und so weiter. Alles mit genau einstudierten Schrittfolgen, und alles von einer geraden Gefechtslinie aus. Meistens war es Mickey, mit dem der Fechtlehrer die Paraden und Schritte demonstrierte. Auch im Fechtunterricht war Mickey der Beste.
Yoshiro ließ den Degen sinken. "Und nun ihr", befahl er. Paare bildeten sich, Degen prallten aufeinander, die einstudierten Paraden wurden geübt. Der Japaner, mit ausdrucksloser Miene, ging von einem Paar zum anderen, kritisierte, zeigte, wie man es besser machte. Er lobte nie.
Wer ist dieser Mann wirklich?, fragte sich Mickey.
"Letzte Woche haben wir gelernt, die Gefechtslinie zu verlassen!", sagte Yoshiro. "Drehungen, ausweichen, antäuschen, unter den gegnerischen Hieben wegtauchen." Wieder demonstrierte Yoshiro die Schlag- und Schrittkombinationen und die Bewegungsabläufe zusammen mit Mickey. "Und jetzt alle!", rief der Fechtlehrer ohne von Mickey abzulassen.
Vier Kampfpaare bewegten sich durch die Halle. Die Klingen zischten durch die Luft, metallenes Klirren, Funkensprühen und Kampfgeschrei.
Wie immer schrie Yoshiro am lautesten. Viel lauter als sonst, fand Mickey. Es ging ihm durch Mark und Bein. Er parierte die Hiebe des Lehrers, drehte sich, tanzte vor und zurück, duckte sich, sprang hoch, schlug zu und wehrte die gegnerische Klinge ab.
Das steinerne Gesicht des Japaners verschwamm plötzlich vor Mickeys Augen. Mickey drosch auf seine Deckung ein, dass die Degen sich bogen. Was ist das für ein Gesicht? Yoshiros Miene verzerrte sich zur grimmigen Maske. Wer ist dieser Mann? Mickey wich zurück, drehte sich, tanzte auf die linke Seite des Japaners. Wie ein Dämon sieht er aus, wie ein Teufel, wie ein Alien ... Yoshiro griff an, Mickey riss den Degen hoch, drückte die Klinge des Gegner zur Seite - und dann fiel sein Blick auf die Tür der Sporthalle.
Dort sah er eine weißgekleidete Gestalt mit blondem Haar. Das Mädchen von der Feuertreppe. Wie eine Statue stand es vor der verschlossenen Tür und deutete mit ausgestrecktem Arm auf Yoshiro Obaiyoshi ...
"Schlaf nicht ein!", fauchte Yoshiro. Er stach nach Mickey Bauch. Die Klinge berührte den schwarzen Stoff seines Muskelshirts. "Abwehren, drehen, angreifen!", schrie der Japaner.
Er will mich töten ... Mickey sprang zurück, drehte sich einmal um seine Achse, legte eine Angriffsparade hin, und führte drei heftige Hiebe gegen Yoshiros Degen. Er will mich töten ... Wieder und wieder schlug er zu. Noch immer die weiße Gestalt an der Tür, ihr blondes Haar, ihr ausgestreckter Arm. Etwas Böses beherrscht ihn, etwas, das dein dein Feind ist, etwas, das dich töten will ...
Yoshiro brüllte und riss den Degen hoch, doch statt auf die Deckung zu schlagen, führte Mickey einen Stoß unter der Deckung des Lehrers hindurch. Mit aller Kraft stach er zu.
Yoshiros Schrei gellte durch die Halle. Die anderen sechs fuhren herum. Mit aufgerissenen Augen und offenen Mündern sahen sie ihren Fechtlehrer rückwärts durch die Halle taumeln.
Sein Schrei ging in röchelndes Gurgeln über. Er strauchelte und schlug lang hin. Ein paar Sekunden hielt er noch die gespreizten Hände über seinen Kopf, bevor sie leblos neben seinen Körper fielen. Mickeys Degen ragte aus seinem linken Auge.
Für Sekunden herrschte Totenstille in der Halle. Dann ließ eine der Schauspielschülerinnen ihren Degen fallen, schlug die Hände vor den Mund und schrie hysterisch ...
*
Washington, D.C., 29. April 1999
"Gute Nachricht, Billy!" Der hagere Mann trug dunkelblauen Nadelstreifen-Zwirn und eine breite, bordeauxrote Krawatte. Sein braungebranntes, jugendliches Gesicht strahlte, als er in das Büro des Senators stürmte. "Der Termin mit Giuliani steht!" Triumphierend schwenkte er einen Briefbogen über dem Kopf. "Eben kam das Fax mit der Bestätigung."
"Prächtig, Tom, prächtig!" Senator William Archer erhob sich aus seinem ledernen Schreibtischsessel. Er wies auf die Sitzgruppe um den Konferenztisch. "Wann?"
"Ende September." Thomas Barnfield ließ sich auf einen der Armlehnen-Stühle fallen und legte das Fax auf den ovalen Tisch. Er organisierte den bevorstehenden Wahlkampf des Senators. William Archer hatte es sich in den Kopf gesetzt im nächsten Jahr Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.
"In fünf Monaten also", knurrte er und setzte sich Barnfield gegenüber. "Zeit genug, um die Wahlschlacht vorzubereiten."
"Ein genialer Zug, in New York City zu beginnen." Der knapp vierzigjährige Barnfield machte ein zufriedenes Gesicht. "Giuliani hält große Stücke auf dich. Er wird ein paar Zweifler unter den Wahlmännern von dir überzeugen."
"Ich weiß, Tom, ich weiß." Der Bürgermeister von New York City war ein alter Freund von Archer. Ein Law-and-Order-Mann, aus dem gleichen Holz geschnitzt wie er selbst.
Der Senator zog die Konsole der Gegensprechanlage zu sich heran und drückte auf einen Knopf. "Bringen Sie uns doch einen Kaffee, Rita."
William >Billy< Archer war einen halben Kopf größer als sein Wahlkampfmanager Barnfield. Und er wog vermutlich vierzig bis fünfzig Pfund mehr. Der Stoff seines anthrazitfarbenen Dreiteilers spannte sich über Schultern und Brustkorb. Silbergraues Haar bedeckte seinen großen Schädel, kurzgeschnitten und akkurat frisiert. Er hatte breite, sinnliche Lippen und eine große Hakennase. Hinter vorgehaltener Hand nannten ihn seine Gegner >Geier<. Man munkelte, dass Archer sich diesen Spitznamen nicht nur wegen seiner krumme Nase eingehandelt hatte.
Er lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. Für seine achtundfünfzig Jahre sah er erstaunlich gut aus. Auch wenn sich unübersehbar ein Bauchansatz unter seiner Weste wölbte. "Ist die Kriegskasse gefüllt?", erkundigte er sich.
"Wir nähern uns der Zwanzig-Millionen-Grenze", verkündete Barnfield stolz. Archer nickte zufrieden. Er wusste, dass er die hohe Summe zum größten Teil seinem rührigen Manager zu verdanken hatte. Nur dreißig Prozent des Geldes stammten aus dem persönlichen Vermögen des Senators. Barnfield scheute keine Mühe bei Konzernen und Prominenten um Spenden zu bitten.
"Fast so viel wie Mercury", sagte Barnfield. "Und zehn Millionen mehr als Baker."
Henry Mercury und Frederick Baker gehörten zur Republikanischen Partei. Genau wie Billy Archer. Und genau wie er wollten beide als Präsidentschaftskandidat der Republikaner im nächsten Herbst gegen den Kandidaten der Demokraten antreten.
"Na prächtig", brummte der Senator. "Dann kann der Krieg ja losgehen."
Die Vorwahlen würden im September beginnen. Ein Marathon von zahllosen Terminen und öffentlichen Auftritten. Zwei würden auf der Strecke bleiben. Den Industriellen Frederick Baker fürchtete Archer nicht. Doch Henry Mercury war Gouverneur von Texas. Er hatte viele Freunde in der Partei. Trotzdem war der Senator zuversichtlich ihn bei den Vorwahlen schlagen zu können.
Billy Archer erkundigte sich nach den Kontakten zu Presse und Fernsehen, ließ sich Wahlwerbekonzepte präsentieren und beriet mit Barnfield personelle Fragen. Das Wahlkampfteam war noch nicht vollständig.
Seine Sekretärin brachte ein Tablett mit Tassen und einer Kanne Kaffee. Rita Narrow war eine blasse, unscheinbare Endvierzigerin. Ziemlich dürr und mit dunklen Ringen unter den Augen wirkte sie erschöpft und kränklich. Insgeheim rechnete Archer damit, dass sie bald kündigen würde. Er hielt schon Ausschau nach Ersatz für seine langjährige Sekretärin.
"Danke, Rita." Er bedachte sie mit einem gönnerhaften Lächeln. "Eine Bitte noch - Anfang Mai hat mein ältester Sohn Geburtstag. Der Termin müsste im Kalender stehen. Erinnern Sie mich einen Tag zuvor daran, damit ich ihm rechtzeitig schreibe." Sie nickte und verließ das Büro.
Tom Barnfield zog den Entwurf der Rede aus der Tasche, die der Senator ab Herbst bei seinen Wahlkampfauftritten halten wollte. Nur Stichpunkte standen auf dem Blatt Papier, das Barnfield auf den Tisch legte. Statements zur Familien- und Steuerpolitik, Thesen zu Todesstrafe, Außenpolitik und Abtreibung und ein paar Formulierungen über William Archer als Privatmann.
Barnfield hatte vorgeschlagen die robuste Gesundheit, das kirchliche Engagement, die harmonische Ehe und die Kriegserfahrungen des Senators in den Mittelpunkt zu stellen. Archer war vollkommen einverstanden. Natürlich brauchte ein künftiger Präsident ein Image, mit dem sich der durchschnittliche amerikanische Wähler identifizieren konnte.
Ein Redenschreiber würde die Rede im Laufe der nächsten Monate schreiben. Eine Art Wahlprogramm und persönliche Propaganda. Die Munition gewissermaßen, die Billy Archer auf den vor ihm liegenden Auftritten zu verschießen gedachte.
Sie stimmten ein paar Einzelheiten ab, sprachen einige Pressetermine durch und berieten über eine Autobiographie, die Barnfield in groben Zügen skizziert hatte. Archer beauftragte ihn einen Ghostwriter zu finden, der das Werk bis zum Frühsommer zu Papier brachte. Danach verabschiedeten sie sich.
Archer sah auf die Uhr. Kurz vor sechs. Er griff zum Telefon und rief seine Frau an. "Ich bin's, Billy - wie geht's, Darling?"
"Gut, Billy, wann kommst du?" Edith Archers Stimme klang kühl und sachlich. Und das war sie auch. Sie hatte das Hauspersonal und den Haushalt tadellos im Griff, sie konnte repräsentieren wie sonst niemand, sie konnte Ausstellungen, Hauskonzerte und Sektpartys auf die Beine stellen, von denen die Leute noch wochenlang sprachen. Aber Wärme und Geborgenheit zu vermitteln, das war nicht ihre Stärke.
Am Anfang ihrer Ehe hatte Billy Archer das vermisst. Aber jetzt nicht mehr. Schon Jahre lang nicht mehr.
"Kann sich hinziehen, Darling." Er schlug einen gestressten Ton an. "Wir müssen noch ein paar Sachen wegen des Wahlprogramms abstimmen. Tom hat nur heute Abend Zeit - es kann also spät werden."
"Schade." Es klang nicht so, als würde sie es wirklich schade finden. "John und Miriam haben sich für heute angemeldet. Sie hätten dich sicher gern gesehen. Aber wir werden wohl mit dem Essen nicht auf dich warten."
Billy Archer war einverstanden, natürlich. Er legte auf und wunderte sich, dass zwei seiner drei Kinder heute Abend zum Essen kommen wollten. John und Miriam studierten beide hier in Washington. Trotzdem kamen sie nicht öfter als höchstens einmal im Monat zu Hause vorbei. Sein ältester Sohn Jefferson sogar noch seltener. Zuletzt hatte er sich zu Silvester blicken lassen.
Archer glaubte, dass es an seiner Frau lag. Ihre gefühlskalte Art stieß die Kinder ab. Davon war er überzeugt. Er wählte eine zweite Nummer. Wieder meldete sich eine Frauenstimme, tiefer und rauer, als die seiner Frau. "Ich komm vorbei, Julia. In etwa anderthalb Stunden. Ist das okay?"
Es war okay, und eine Stunde später saß Billy Archer hinter dem Steuer seines dunkelgrauen Buick Park Avenues. Die abendliche Rushhour hatte Washington D.C. längst wieder aus ihrer Umklammerung entlassen, und der Senator konnte seine zweihundertdreißig-PS-starke Luxuslimousine über die Pennsylvania Avenue Richtung Südosten jagen.
Kurz nach halb acht hielt er in einem Parkhaus in Boulevard Heights. Über Handy bestellte er ein Taxi. Das chauffierte ihn zu einem achtstöckigen Apartmenthaus am Rande der Vorstadt. Seine Geliebte wohnte in der siebten Etage.
Während er mit dem Aufzug zu Julias Apartment hinauffuhr, fragte er sich, was er während der heißen Phase des Wahlkampfes mit seiner Geliebten anstellen sollte. Das Risiko auf die Titelseiten der Skandalblätter zu kommen, war ihm zu hoch. Der politische Gegner lauerte auf jeden noch so geringfügigen Fehltritt.
Die Aufzugtür schob sich auseinander. Ich muss mir etwas einfallen lassen, dachte er, bald ...
Julia Rosen stand im Türrahmen ihres Apartments. Eine hochgewachsene Frau, schlank, mit rotem, langem Haar und grünen Augen. Ein verträumter, fast wehmütiger Zug lag auf ihrem ungewöhnlich schönem Gesicht.
Sie zog ihn ins Apartment, schloss die Tür und fiel ihm um den Hals. "Endlich, Billy ..." Sie küsste ihn stürmisch. Archer drückte sie an sich. Seine Hände glitten über ihren schlanken Körper und schoben sich unter ihre Bluse auf ihren Rücken. "Du musst dir mehr Zeit für mich nehmen", flüsterte sie.
"Das werd ich tun, versprochen ..."
Sie hatten sich in einem Fernsehstudio in New York City kennengelernt. Archer hatte dort an einer Talkshow teilgenommen. Und Julia war Schauspielerin. Die Folge einer Serie, in der sie eine Hauptrolle spielte, wurde an genau dem Tag abgedreht, an dem Archer zum ersten Mal in seinem Leben freiwillig vor eine Kamera trat.
Es war eine zufällige Begegnung. Archer hatte sich aus dem Stand in die dreißig Jahre jüngere Frau verguckt. Genau elf Monate her. Seitdem sahen sie sich fast jede Woche.
Sie zog ihm das Jackett aus und hängte es an die Garderobe. Während er ihre Bluse aufknöpfte, löste sie seinen Krawattenknoten. Atemlos vor Begierde vergrub er sein Gesicht zwischen ihren spitzen Brüsten. "Mein wilder Stier." Sie bog den Kopf in den Nacken und seufzte. "Mein wilder, wilder Billy ..."
Archer drängte sie zu einem der Sessel ihrer Sitzgruppe. Sie ließ sich darauf fallen und lachte. "Ich liebe es, wenn du so ausgehungert hierherkommst ..." In kürzester Zeit hatte er sie vollständig ausgezogen. Er bedeckte ihren nackten Körper mit Küssen, seine Hände flogen über ihre Schenkel, ihr Gesäß und ihre Brüste. Und Julia genoss es.
Er streifte Hosen und Wäsche ab, zog sie hoch und setzte sich auf den Sessel. "Komm zu mir, Honey ...", knurrte er. Mit gespreizten Beinen rutschte sie auf seinen Schoß ...
Ein Handy orgelte los. Archer stutzte und spähte zur Garderobe, wo sein Jackett hing. Irgendjemand versuchte, ihn anzurufen. Julia nahm seinen Kopf zwischen ihre Hände und wandte sein Gesicht weg von der Garderobe. "Wozu hast du eine Mailbox?", flüsterte sie. "Vergiss jetzt alles, denk nur an mich ..."
Sie küsste ihn, wiegte sanft ihre Hüften und drückte seinen Mund zwischen ihre Brüste. Das Gedudel des Handys rückte in den Hintergrund. Ihr Duft, ihre Hitze, ihre Bewegungen überfluteten ihn wie eine gewaltige Brandung. Er überließ sich dem Hunger nach ihrem Körper ...
Später entkorkte Julia eine Sektflasche. Sie trank Sekt für ihr Leben gern. Archer hatte sich um ihretwillen an das Zeug gewöhnt. Sie schenkte ein und stieß mit ihm an. Archer trug einen blauen Morgenmantel aus Seide. Den hatte seine Geliebte ihm geschenkt. Julia war noch immer nackt. Archer hatte darauf bestanden. Er konnte sich nicht sattsehen an ihrem Körper.
Schon während sie tranken, schielte er hinüber zur Garderobe. Mit dem Glas in der Hand ging er hin und zog sein Handy aus dem Jackett. Sein Sohn John hatte ihm auf die Mailbox gesprochen. Archer solle zu Hause anrufen. Johns Stimme klang alarmierend heiser.
Archer ging zur Sitzgruppe zurück und stellte sein Glas auf den Tisch. "Ist was passiert?" Die Sorgenfalten auf seiner breiten Stirn beunruhigten Julia. Er hob ratlos die Achseln, ließ sich in den Sessel fallen und wählte seine Privatnummer.
John war am Apparat. "Du musst kommen, Dad, wo steckst du?" Der aufgescheuchte Unterton in der Stimme seines jüngeren Sohnes trieb Archers Blutdruck in die Höhe.
"Ich bin mit meinem Wahlkampfmanager unterwegs. Was gibt's denn?"
"Mickey ..." Dem kaum Zwanzigjährigen brach die Stimme. "Wir haben einen Anruf aus einer New Yorker Klinik bekommen ... Mickey liegt auf einer geschlossenen, psychiatrischen Abteilung. Schon seit zwei Tagen. Er hat ... er hat einen Menschen getötet ..."
*
Manhattan, East Side, 30. April 1999
Seite an Seite mit dem Arzt betrat William Archer das Krankenzimmer. Die Beleuchtungsbalken über den vier Betten streuten gedämpftes Licht auf die Wände und Kopfenden der Betten. Der Arzt, ein Afroamerikaner namens Southport, führte Archer an das Bett seines Sohnes. An fahrbaren Metallrahmen aufgespannte Leintücher schirmten es vor den Blicken der anderen drei Patienten ab.
Zögernd nur näherte sich Archer dem Bett. Er hatte die Zehn-Uhr-Maschine genommen. Direkt vom La Guardia Airport war er hierher an die East Side ins New York Hospital gefahren. Es war lange nach Mitternacht.
Edith war mit einem Weinkrampf im Bett gelegen, als er nach Hause gekommen war. Der Hausarzt hatte ihr eine Beruhigungsspritze gegeben. Sie hatte ihn nicht begleiten können. Vollkommen ausgeschlossen.
Mit einer Kopfbewegung bedeutete der Arzt ihm näher zu treten. Er trat zur Seite, um Archer vorbeizulassen. Ein Infusionsständer stand hinter dem Bett zwischen Kopfbrett und Beleuchtungsbalken. Am Bettrand entlang schob Archer sich Richtung Kopfende. Als würde er fürchten, ein fremdartiges Tier, ein wildes womöglich, in seiner Höhle aufzuscheuchen, so vorsichtig beugte er sich über das Bett.
"Jefferson?", flüsterte er.
Sein Sohn wandte den Kopf. Stumpfe Augen, rissige, trockene Lippen, bleiches, eingefallenes Gesicht, fettiges Haar, das in der Stirn klebte - Archer erschrak. "Jeff? Ich bin's, dein Vater - erkennst du mich?"
Sein Sohn gab ein undeutliches Krächzen von sich. Archer beugte sich über ihn. Sein Blick streifte die Infusionsflasche. Ein Etikett mit einem Medikamentennamen klebte auf ihr - Haldol, las er.
Seine Augen wanderten den Infusionsschlauch herab. Der verschwand direkt vor ihm am Bettrand unter der Decke. Die Schlaufe eines senffarbenen Kunststoffgurtes hing dort. Archer hob die Decke ein wenig an. Der Arm seines Sohnes war mit dem Gurt gefesselt. Er blickte zum Fußende. Auch dort ein Gurt. Auf der anderen Bettseite vermutlich das gleiche Bild.
Archer wandte sich zu dem Psychiater um und runzelte die Stirn. Das schwarze Gesicht sah ihn gleichmütig an. Wieder ein Krächzen. Archer schluckte und beugte sich tief über den Kopf seines Sohnes. "Ich versteh dich so schlecht, Jefferson - red deutlicher." Er neigte sein rechtes Ohr zu den aufgesprungenen Lippen seines Sohnes. Unangenehmer Geruch ging von ihm aus.
"Wer schickt dich ...?"
Archer richtete sich überrascht auf. Aus schmalen Augen musterte er das schmale Gesicht. Wie fremd es ihm plötzlich war. "Wer mich geschickt hat ... wie meinst du das?"
"Haben sie dich geschickt", flüsterte sein Sohn. Archer verstand nicht. Wieder beugte er seinen Kopf über den Mund des Kranken. "Auf welcher Seite stehst du, Dad ...?"
Archer wandte den Kopf. Mit offenem Mund starrte er das eingefallene Gesicht an. Ein Leuchten lag in den Augen seines Sohnes. Ein Leuchten, das ihm Angst machte. "Ihr habt keine Chance ..." Die krächzende Stimme wurde lauter. "Wir werden euch besiegen ... niemand kann mir schaden ... ich bin unverwundbar ... ich bin auserwählt ..."
Archer wich zurück. Er stieß gegen die spanische Wand hinter sich. Langsam drehte er sich zu dem Arzt um. Hilflosigkeit und Entsetzen lag auf seiner Miene. Nichts begriff er, absolut nichts.
Der Arzt trat auf die andere Seite des Bettes. Er drehte das Rädchen der Infusionsklemme auf. Die Tropfenzahl erhöhte sich. Mit einer Kopfbewegung gab er Archer zu verstehen ihm aus dem Zimmer zu folgen.
Sie gingen ins Arztzimmer. Archer ließ sich auf den nächstbesten Stuhl sinken. Er schüttelte den Kopf. "Ich bin fassungslos ...", stöhnte er.
"Ich weiß, wie Ihnen zumute ist, Mr. Archer", sagte der Psychiater. "Es ist immer ein Schock für die engsten Angehörigen, einen geliebten Menschen plötzlich in solch einem Zustand zu erleben."
Einen geliebten Menschen ... Die Worte hallten in Archers Kopf nach. Er fragte sich, wann er zum letzten Mal ein vertrautes Gespräch mit seinem Sohn geführt hatte. Er konnte sich nicht daran erinnern. "Was ist das für eine Krankheit? Ist er ... ist er schizophren ...?"
"Das muss der weitere Verlauf zeigen." Der Arzt setzte sich Archer gegenüber an seinen Schreibtisch. "Bis jetzt halte ich es für eine akute paranoid-halluzinatorische Psychose."
"Hat er denn ... ich meine ... hat mein Sohn Halluzinationen gehabt?"
"Er hat eine Art Engel gesehen. Und sein Fechtlehrer verkörperte für ihn plötzlich eine böse Macht."
Ich hab es gewusst, dass es keine gutes Ende nimmt, dachte Archer, diese verdammte Schauspielerei ... Er sprach den Gedanken nicht aus. "Der arme Mann", flüsterte er stattdessen.
"Der Staatsanwalt gibt ihm eine gewisse Mitschuld. Er hat sich gewundert, dass der Lehrer ohne Schutzmasken Fechttraining erteilte. Die Staatsanwaltschaft hat Ihren Sohn übrigens sofort zu uns bringen lassen, als es passiert war. Er musste also nicht ins Gefängnis. Wir haben nur zwei Tage benötigt, um die Identität ihres Sohnes und Ihre Adresse heraus zu finden."
"Wird es denn ... wird es denn zum Prozess kommen?" Der Boden schwankte unter Archer. Vor seinem inneren Auge tauchten die Schlagzeilen auf. Senatorensohn tötet im Wahnsinn ...
"Da müssen Sie den Staatsanwalt fragen." Dr. Southport zuckte bedauernd mit den Schultern.
"Gibt es Heilungschancen? Wird mein Sohn je wieder normal?"
"In fünfzig Prozent aller Fälle klingen solche psychotischen Schübe ab, ohne Folgen zu hinterlassen. Manchmal kehren sie wieder, manchmal werden sie chronisch. Aber es gibt heute gute Medikamente. Man kann sogar mit einer chronischen Psychose leben."
Der sachliche Ton des Arztes dämpfte Archers Erregung. Er stand auf, um sich zu verabschieden. "Ich danke Ihnen, Dr. Southport." An der Tür drehte er sich noch einmal um. "Eine Bitte", sagte er. "Sie wissen, dass ich als Politiker im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehe. Ich meine ... also, wenn Sie diesen Fall mit äußerster Diskretion behandeln würden, wäre ich Ihnen sehr verbunden."
"Ich verstehe." Der Arzt nickte. "Sie können sich auf uns verlassen, Mr. Archer."
"Danke."
Archer nahm ein Taxi und fuhr zur Grand Army Plaza. Dort mietete er sich im Plaza Hotel ein. Er rief seine Familie in Washington an und brachte ihr schonend die schmerzhafte Wahrheit nahe.
Später ging er in eine Bar in der 58th Straße. Er verkroch sich an den hintersten Tisch. Bei drei oder vier Whiskys dachte er nach. Er würde mit Tom Barnfield darüber reden müssen, was diese familiäre Katastrophe für seinen Wahlkampf bedeutete.
Am nächsten Tag besuchte er den zuständigen Staatsanwalt. Sie sprachen lange miteinander. Am Ende des Gespräches fand der Staatsanwalt eine Reihe von Argumenten, mit denen er sich selbst davon überzeugte, dass ein Prozess gegen einen kranken Mann nicht infrage kam.
Der Senator flog zurück nach Washington. Dort beriet er sich mit seiner Familie und seinem Wahlkampfmanager.
Drei Tage später wurde Jefferson Michael Archer aus dem New York Hospital in eine kleine Klinik südöstlich von Georgetown, South Carolina verlegt. Eine Privatklinik für psychisch Kranke. Edith Archer war einst mit dem leitenden Psychiater in die Highschool gegangen.
Senator William Archer war hochzufrieden mit dieser Lösung. Die Privatklinik war relativ unbekannt. Keine Medienleute würden hier herumschnüffeln. Er musste seinen Wahlkampf nicht abblasen.
2
Manhattan, 24. September 1999
Es war ein Freitagnachmittag. Ein milder, sonniger Spätsommertag. Ich erinnere mich genau an diesen Tag. Bis in das Foyer der City Hall schickte die Sonne ihre Lichtstrahlen.
Unter der Kuppelrotunde, zwischen den zehn Säulen, drängten sich gut dreihundert Menschen. Fernsehkameras ragten links und rechts des Podiums aus der Menge. Hin und wieder zuckten Blitzlichter auf. Milo und ich standen auf der untersten Stufe der geschwungenen Treppe, die hinauf zu den Tagungsräumen und dem Governor's Room führte. Wachsam spähten wir in die Zuhörerschaft.
Mehr oder weniger aufmerksam lauschten sie den Worten des Mannes hinter dem Rednerpult. Ein großer, massiger Mensch mit silbergrauem Haar. Eine scharf geschnittene Raubvogelnase dominierte sein breites Gesicht. Er hieß William Archer und war Mitglied des amerikanischen Senats. Unser Bürgermeister hatte ihn in seiner Begrüßungsrede mit >Billy< angesprochen. Und der Senator unseren Bürgermeister mit >Rudy<.
Der Mann sprach vom Wert intakter Familien, warnte vor Steuererhöhungen, bekannte sich zur Todesstrafe, forderte ein stärkeres Engagement der amerikanischen Außenpolitik in Fernost, und so weiter und so weiter. Ich glaube, er wetterte auch gegen Abtreibung und die lasche Haltung der Demokraten in Sachen Drogenbekämpfung. So genau hörte ich nicht hin.
Manchmal blieb mein Blick an der Statue neben mir hängen. Das Bildnis von Nathan Hales. Über zweihundert Jahre war es her, dass ihn die Briten gehängt hatten. Während des Unabhängigkeitskrieges. Hales war Spion gewesen. Seine letzten Worte lauteten angeblich: Ich bedaure, dass ich meinem Land nur dies eine Leben anzubieten habe.
Ein Satz, der mir seit der Schulzeit vertraut ist. Ich kann ihn im Schlaf aufsagen. In keinem unserer Geschichtsbücher fehlt er.
Die vielen Sätze, die der Mann hinter dem Rednerpult produzierte, würde vermutlich nie jemand auswendig lernen. Außer den sechs Männer vielleicht, die sich seit einigen Tagen als mögliche Präsidentschaftskandidaten in den Medien präsentierten. In etwa sagten sie nämlich alles das Gleiche.
In der New York Times dieses Tages hatte ich gelesen, dass Senator William Archer gute Chancen eingeräumt wurden, Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. In den Umfragen lag er im Augenblick gleichauf mit dem Gouverneur von Texas. Aber die Vorwahlen hatten erst begonnen. Ich persönlich konnte mir nicht vorstellen, dass die Wahlmänner und -frauen einen Mann mit einer derart auffälligen Raubvogelnase zum Präsidentschaftskandidaten küren würden.
Die Federal Plaza war an diesem Nachmittag für die Sicherheit zuständig. Zu zehnt überwachten wir die Veranstaltung. Dazu natürlich ein paar Dutzend Cops und die persönlichen Leibwächter des Bürgermeisters und des Senators.
Die Räume der City Hall durchsuchen, die Monitoren der Überwachungskameras im Auge behalten, die Gäste im Foyer beobachten, die Umgebung kontrollieren - den City Hall Park, die angrenzenden Straßen und so weiter. Das etwa war unser Job an diesem Nachmittag. Ein Routinejob.
Der Senator sprach etwa eine Stunde lang. Es gab eine Menge Beifall. Danach trat Rudolph Giuliani noch einmal ans Rednerpult. Er dankte dem Vorredner, wünschte ihm Glück für seinen Wahlkampf und streute ein paar persönliche Anekdoten aus William Archers Leben ein. Kriegserlebnisse in Vietnam, familiäre Ereignisse, Erlebnisse aus der gemeinsamen Studienzeit.
Archer hatte wohl den Vietnamkrieg nur mit knapper Not überlebt, und schien seit fast dreißig Jahren glücklich verheiratet zu sein. Ein kerniger Mann, ein Amerikaner aus echtem Schrot und Korn, ein zäher Kämpfer, hart aber gerecht - ungefähr das kam rüber.
Danach war Schluss. Unser Job neigte sich dem Ende zu. Flankiert von sechs Leibwächtern geleitete der Bürgermeister seinen Gast aus dem Foyer hinaus auf die Vortreppe. Milo und ich hinterher. Draußen, zwischen den beiden Mittelsäulen noch einmal Shakehands und das unvermeidliche Blitzlichtgewitter.
Und dann tauchte plötzlich dieser seltsame Vogel auf. Wie aus dem Nichts, niemand schien ihn bemerkt zu haben. Auch Milo und ich nicht. Er stieß zwei Pressefotografen zur Seite, streckte ein großes Holzkreuz in die Luft und schrie: "Gott segne Amerika!"
Sein Mantel glitt von seinen Schultern und fiel auf die Erde. Darunter war er mit einem langen gerade geschnittenen Kleid aus grobem Sackstoff bekleidet. Graues Haar hing ihm wirr ins Gesicht und auf die Schultern.
Ich musste an einen alttestamentlichen Propheten denken, während ich Seite an Seite mit Milo die Vortreppe hinunterstürmte. "Gott segne Amerika!", brüllte der Mann. Wir schoben uns zwischen den Verrückten und die vielen Mikros und Kameras, die sich auf ihn richteten.
"Kommen Sie, Sir!", fauchte Milo. "Wir gehen ein bisschen im Park spazieren ..."
Der Mann stemmte sich uns entgegen. "Gott sieht das Herz eines Menschen an!", ereiferte er sich. Wir drängten ihn an Medienleuten und Zuschauern vorbei. "Und Dich hat er nicht zum Präsidenten erwählt!" Er schwenkte das Kreuz über unseren Köpfen und deutete damit auf den Senator. Milo nahm es ihm weg. "Dich nicht! Er hat mir gesagt, was er in deinem Herzen gesehen hat ...!"
"Beruhigen Sie sich, Mister." Ich bog dem Mann den rechten Arm auf den Rücken. Wir mussten ihn mit Gewalt von der City Hall wegtransportieren. Was blieb uns übrig?
Vier Cops nahmen uns den Wunderling ab. Handschellen klickten, sie brachten ihn zu einem Patrolcar, um die Personalien aufzunehmen.
"Was sagst du dazu, Partner?" Milo sah den Cops und dem Pseudopropheten kopfschüttelnd hinterher.
"Was soll ich sagen?" Ich zuckte mit den Schultern. "Langweilig war er jedenfalls nicht."
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass sich in diesen Wochen und Monaten eine Menge Leute damit hervortaten düstere Prophezeiungen auszustoßen und von Gott und seinem Gericht zu faseln. Zur Erinnerung: Nur noch drei Monate trennten uns damals vom Jahrtausendwechsel.
Als wir am Abend im >North Star Pub< unser Feierabend-Bier tranken, dachten wir schon nicht mehr an den Mann mit dem Sackkleid und dem Kreuz. Auch der Senator und seine Rede waren nur blasse Tageserinnerungen unter vielen anderen. Noch waren wir bester Stimmung. Dabei sollte der Name >Archer< schon in wenigen Wochen zu unserem Albtraum-Inventar gehören.
Der Verrückte mit dem Kreuz hätte uns das eventuell voraussagen können. Aber vermutlich hätten wir ihm nicht geglaubt.
*
Los Angeles, 25. September 1999
Sie lagen am Manhattan Beach eine halbe Autostunde südlich von Santa Monica. Andrew Page hielt die zierliche Marguerita Vasques so fest umschlungen, als wollte er sie nie wieder loslassen. Und Marguerita rieb ihren halbnackten Körper an seinem nicht unerheblichen Bauch. Sie küssten sich bis zur Atemlosigkeit.
Der Sand war warm, viele Menschen tummelten sich in der Brandung, und die Sonne prallte auf den Strand, als hätte sie sich in der Jahreszeit geirrt.
Tatsächlich lag ein Hauch von Hochsommer über dem Treiben am Strand - Kinder jagten Bällen hinterher, Männer und Frauen spielten Beachball, auf improvisierten Volleyball-Plätzen tobten Teenies herum, und im Wasser tanzten Surfer auf ihren Brettern. Unzählige Menschen hatte die Sonne an diesem Samstag aus Los Angeles an die Küste gelockt.
Andrew und Marguerita störten sich nicht an den vielen Leuten. Sie hatten einen Windschutz um sich herum aufgebaut und seine offene Seite mit Liegestühlen und Handtüchern abgeschirmt. Ihre Hände flogen über die Haut des anderen, ihre Münder suchten einander, ihre Körper drängten sich stürmisch aneinander.
Sie machten ganz den Eindruck eines Liebespaares im Rausch des noch zauberhaft frischen Honeymoons. Und genau das waren sie.
Marguerita drückte Andrews Arme neben seinen Kopf in den Sand. Kurze, muskulöse Arme. Sie schob ihren zierlichen, schokofarbenen Körper auf seinen bulligen, haarigen Leib und lächelte ihn an. Andrew hob den Kopf und versuchte, ihren unglaublich großen Mund zu küssen. Sie wich ihm aus und lachte.
Marguerita war gebürtige Mexikanerin. In früher Kindheit war sie mit ihrer Mutter nach Kalifornien eingewandert. Mehr als zwanzig Jahre her. Sie hatte glühende Mandelaugen, fast schwarz. Ihr blauschwarzes Haar bedeckte ihren schmalen Kopf wie ein kunstvolles Gesteck aus tausenden von Rastalocken.
Das Lächeln wich plötzlich aus ihrem Gesicht. Ihre Lippen öffneten sich leicht. Ihre schönen, perlweißen Zähne wurden sichtbar. Etwas wie Furcht trat in ihre Augen. "Willst du mich heiraten?", fragte sie leise.
Andrews Unterkiefer sank nach unten. Sein Doppelkinn war jetzt überdeutlich zu erkennen. Er schluckte. "Was hast du gesagt?", krächzte er.
Andrew Page war ziemlich genau fünfundzwanzig Jahre älter als Marguerita, nämlich zweiundfünfzig. Und auch sonst gab er nicht gerade den Mann ab, der Marguerita zu einem Traumpaar vervollständigen würde. Andrew war nicht besonders groß, dafür reichlich korpulent, und von seiner einst üppigen, blonden Haarpracht existierte nur noch ein jämmerlicher, angegrauter Kranz, der seine leergefegte Glatze betrauerte.
Marguerita schluckte. "Ob du mich heiraten willst." Ihre Stimme war jetzt unsicher.
"Das hat mich noch nie eine Frau gefragt", flüsterte Andrew. Er war übrigens Chef einer großen Filmproduktions-Firma in Hollywood.
"Du warst doch schon dreimal verheiratet."
"Aber da hab ich immer gefragt." Er versank in ihren Augen und wusste kaum, was er redete. Ihre Frage hatte ihn vollkommen ausgehebelt.
"Deswegen ist's auch nie was geworden." Zärtlich küsste sie seine fleischigen Lippen. "Diesmal fragt eine Frau dich, und diesmal wirst du glücklich werden."
Eine Zeit lang blickte er sie einfach nur an. Hin und her gerissen zwischen dem Gefühl zu träumen und der Freude, die in seiner Brust schwoll wie Hefeteig in der Sonne. Dann brach der Jubel aus ihm heraus. "Yea!", schrie er. "Yea! Ich will!"
Er sprang auf, packte Marguerita, nahm sie auf seine Arme und tanzte um den Windfang herum, wie ein Indianer mit seiner Kriegsbeute. "Yea!", brüllte er. "Yea! Yea!" Marguerita lachte laut, und die Leute um sie herum am Strand sahen ihrem Tanz zu und feixten.
Viele der Menschen, die der Filmproduzent und die Schauspielerin kannten, würden sich in den nächsten Tagen das Maul zerreißen. Sie heiratet sein Geld, würden sie sagen.
Aber das stimmte nicht. Marguerita liebte Andrew - er war für sie wie ein Vater, der Schutz und Geborgenheit gibt. Nichts davon hatte sie in ihrem siebenundzwanzigjährigen Leben je genossen.
Und Andrew liebte Marguerita - sie war für ihn wie der sagenhafte Jungbrunnen aus dem Märchen.
Noch am selben Abend fuhren sie nach Los Angeles hinein. In der Innenstadt klapperten sie die Schaufenster der Juweliere ab, um sich Ringe anzuschauen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Andrew noch genau dreizehn Tage zu leben. Und Marguerita zwölf Tage ...
*
Staten Island, 26. September, 1999
Timothy Wolfe trat auf die Terrasse seiner Villa. Die Morgensonne hing noch tief über dem östlichen Horizont. Er kniff geblendet die Lider zusammen, gähnte herzhaft und streckte sich.
Er schirmte die Augen mit den Händen ab und blickte über die Lower Bay. Ein funkelnder Lichtschleier lag über dem Meer. Die Westküste von Coney Island erschien an diesem Morgen zum Greifen nahe, so klar war die Luft. Der Sommer hatte sich freundlich verabschiedet, und der Herbst zeigte sich von seiner angenehmsten Seite.
"Ein schöner Sonntag wird das, Sweety!", rief er über die Schulter durch die offene Terrassentür ins Haus hinein. Er trat an die Steinbalustrade der Terrasse, stützte sich aufs Geländer und blickte über die leicht abschüssige Küste aufs Meer hinunter. "Verdammt gutes Wetter!" Der Strand war nicht weiter als vierhundert Meter entfernt. Ein Fußweg führte aus Wolfes Grundstück hinaus, schlängelte sich durch einen von Büschen bewachsenen Grasstreifen und mündete in dem schmalen Sandstrand.
Links des Strandes eine Bucht. Ein kleiner Yachthafen. Zwei Dutzend Schiffe lagen an den Anlegestegen vor Anker. Segelboote und Yachten.
Noch zwei Kilometer weiter links schoben sich die Küsten von Staten Island und Brooklyn auf weniger als sechzehnhundert Meter aneinander heran. Deutlich war die Verrazano Narrows Bridge zu erkennen.
"Was willst du zum Frühstück!", kam Rachels hohe Stimme aus dem Haus.
Wolfe stieß sich von der Balustrade ab. "Cornflakes!", rief er. "Joghurt und Orangensaft." Die erste Tageshälfte pflegte er einigermaßen gesund zu leben. "Und stell schon mal Sekt kalt."
Er streifte seinen weißen Morgenmantel ab und warf ihn auf die Hollywoodschaukel neben der Terrassentür. Nur mit einem Slip bekleidet begann er mit seinem täglichen Gymnastikprogramm - Dehn- und Streckübungen, Kniebeugen, Bauchmuskeltraining und vierzig Liegestützen.
Timothy Wolfe war hundertsiebenundachtzig Zentimeter groß. Ein schlanker Mann mit kräftigen Gliedern. Der leichte Bauchansatz machte ihm zu schaffen. Hartnäckig achtete er darauf die Hundertachtzig-Pfund-Marke nicht zu überschreiten. Wolfe fand, dass man mit dreiundvierzig Jahren noch nicht unbedingt Fett ansetzen musste. Er kämpfte verbissen gegen diese Entwicklung an. Nicht erst, seitdem er mit Rachel zusammen war.
Kein leichter Kampf, wenn man monatelang zehn Stunden am Tag vor dem Monitor saß. Und dabei noch vor Sonnenuntergang anfing, flüssige Kalorien in sich hineinzugießen. Spaßeshalber hatte Rachel mal ausgerechnet, dass er für zwei Seiten eines fertigen Drehbuches im Schnitt eine Flasche Sekt brauchte. Eine Rechnung, die Wolfe beruhigt hatte. Er schrieb Drehbücher von etwa neunzig Seiten Umfang und brauchte zwei Monate für ein Drehbuch. Und fünfundvierzig Flaschen Sekt in sechzig Tagen hielt er noch für vertretbar.
Mit den Liegestützen schloss er seine Gymnastik ab. Danach fünf Minuten Atemübungen vor der Balustrade. Wolfe hatte ein jungenhaftes, rundes Gesicht. Die glatten schwarzen Haare reichten ihm bis zu den Schulterblättern. In der Regel trug er sie zu einem Zopf geflochten. Der kräftige Dreitage-Bart milderte den knabenhaften Zug in seinem Gesicht ein wenig.
Rachel erschien in der Terrassentür. "Frühstück!" Sie war eine schlanke Frau von neunundzwanzig Jahren mit einem hübschen, stupsnasigen Gesicht. Der Gürtel Ihres hellblauen Morgenmantels hing lose herab. Der hellblaue Seidenstoff rahmte einen braungebrannten, straffen Körper ein. Sie trug einen schwarzen Tangaslip. Massen blonder Locken hingen ihr bis auf den drallen Busen herab. Wolfe spitzte die Lippen und warf ihr einen Handkuss zu. Arm in Arm verschwanden sie im Haus.
Während des Frühstücks schaute Wolfe die Post durch. Stapel von großen und kleinen Kuverts häuften sich auf der Anrichte neben dem Tisch. Das Paar war erst am Vormittag des vergangenen Tages von der Westküste zurückgekehrt. Vier Wochen Urlaub nach anstrengenden Drehtagen.
Die meisten der Briefe waren Glückwunschschreiben für Timothy Wolfe. Er hatte eine neue Serie in die Fernsehwelt gesetzt und die Hälfte der ersten zwanzig Drehbücher selbst geschrieben.
>Amtrak-Team< hieß die Serie. Die Geschichten spielten in einem Hochgeschwindigkeitszug zwischen Chicago und Los Angeles. Im Mittelpunkt stand das Zugteam - Zugführer, Schaffner, Sicherheitsleute und das Personal des Speisewagens. Eine scharfe Mischung aus Sex, Verbrechen, Intrigen und Schicksalsschlägen. Rachel Burgh spielte eine der weiblichen Hauptrollen.
Die Serie lief seit Mai wöchentlich im Spätprogramm. Ein Volltreffer. Die Gratulationsbriefe waren voll des Lobes. "Das Jahr hört so gut auf, wie es angefangen hat", strahlte Wolfe. "Wenn >Amtrak-Team< weiter so läuft, kann ich bald von einem Drehbuch im Jahr leben."
Später saßen sie in der Hollywoodschaukel und tranken Sekt. Wolfe war in Gedanken schon bei seinem nächsten Drehbuch. Eine dramatische Geschichte mit viel Action sollte es werden. Er dachte an eine Zugentführung.
Während Rachel sich der Pflege ihrer Nägel hingab, tigerte Wolfe mit einer Schreibkladde über die Balustrade. Hin und her, hin und her. Er grübelte über den Bösewicht in seiner neuen Geschichte nach, den Mann, der den Zug entführen sollte.
Auf seiner inneren Bühne erschienen die Gesichter männlicher Schauspieler, die er kannte. Wolfe neigte dazu, die wichtigsten Gastrollen zu besetzen, bevor er das Drehbuch verfasste. Das Schreiben fiel ihm leichter, wenn er sich konkrete Gesichter vorstellen und eine Rolle einem ganz bestimmten Schauspieler auf den Leib schreiben konnte.
Irgendwann, nach dem zweiten Glas Sekt, kreisten seine Gedanken nur noch um ein Gesicht. Ein junges Gesicht - schmal, fast hohlwangig, mit einer Hakennase, und einem auffallend sinnlichen Mund. Auch die unruhigen, braunen Augen hatten sich ihm eingeprägt. Er hatte den Mann im vergangenen Winter zweimal auf der Bühne eines Off-Broadway-Theaters gesehen. Ein guter Schauspieler. Vermutlich ohne größere Berufserfahrung, aber ein guter Schauspieler. Und genau das richtige Gesicht für einen kriminellen Zugentführer.
Wolfe durchwühlte sein Gedächtnis nach dem Namen des Mannes. Als er ihn hatte, ging er ins Haus und griff zum Telefon. Er wählte die Nummer von Jonathan Kovac. Kovac war Leiter des >Actor's Studio<. Wolfe war sich ziemlich sicher, dass der Mann, dessen Gesicht er im Kopf hatte, noch die Schauspielschule in Greenwich Village besuchte.
Eine hohe Männerstimme meldete sich. Kovac und Wolfe hatten sich lange nicht gesprochen. Sie tauschen ein paar Freundlichkeiten aus, pflegten Small Talk, und Kovac gratulierte dem Drehbuchautoren zu seiner Serie. Wolfe bedankte sich. "Eine Frage, Jonny", sagte er dann. "Ich will einem deiner Schüler eine Rolle anbieten. Und zwar dachte ich an diesen Mickey Archer. Kannst du mir seine Nummer geben?"
Sekundenlanges Schweigen am anderen Ende der Leitung. Dann räusperte Kovac sich. "Der ist nicht mehr hier", sagte er mit Grabesstimme, "der ist durchgedreht."
"Durchgedreht? Was ist passiert."
"Der Mann hatte plötzlich Halluzinationen, sah Dämonen, und Aliens und solches Zeug. Von einem Tag auf den anderen. Armer Hund ...tja - und dann hat er einen unserer Lehrer getötet, Yoshiro Obaiyoshi, ich weiß nicht, ob du ihn kanntest ..."
"Das ist nicht wahr!" Wolfe war plötzlich wie elektrisiert. Haarklein ließ er sich den haarsträubenden Zwischenfall erzählen.
Nach dem Telefonat stand er mit einem Glas Sekt in der Hand an der Balustrade und blickte auf die Upper Bay hinab. Die Sonne stand mittlerweile am Zenit. Noch erstaunlich kräftig für die Jahreszeit brannte sie aus dem Mittagshimmel herab.
Wolfe merkte es kaum. Wie die Wespen auf dem Honigbrot klebten seine Gedanken an der Geschichte von dem durchgedrehten Schauspieler. Seine Idee für eine neue Folge von >Amtrak-Team< verblasste langsam.
"Ein Mann dreht durch, sieht plötzlich Dämonen und Aliens in ganz normalen Menschen und tötet sie ..." Er drehte sich um und betrachtete seine hübsche Freundin. Rachel blies ihre lackierten Fingernägel an. "Wär das nicht Stoff für eine gesalzene Story?"
"Weiß nicht." Rachel zog den linken Mundwinkel hoch. "Klingt irgendwie langweilig ..."
*
Los Angeles, 27. September, 1999
Andrew Page schloss Marguerita in die Arme. "Ich werde sterben ohne dich, Baby", seufzte er ihr ins Ohr.
Sie küsste ihn noch einmal und machte sich dann von ihm los. "Die zwei Wochen halten wir durch!" Sie stieg in ihren weißen Thunderbird. "Und danach wird geheiratet!"
Marguerita musste nach Arizona fahren. Dreharbeiten in der Wüste waren angesagt. An den Tafelbergen. Sie spielte eine Hauptrolle in einem Western.
Und danach wollte sie ihren jüngeren Bruder besuchen. Er war bei der Marine und zu der Zeit in der Twentynine Palms Marine Corps Base stationiert. Bei der Gelegenheit wollte sie in einem nahe gelegenen Hotel absteigen. Ein In-Hotel - Geheimtipp in Filmkreisen.
"Wir telefonieren heute Abend, Andy." Sie schlug die Fahrertür zu und senkte das Seitenfenster herunter.
Er beugte sich zu ihr ins Auto hinein. "Wir telefonieren jeden Tag", flüsterte er. "Und sobald ich den neuen Film unter Dach und Fach habe komme ich zu dir nach Twentynine Palms."
Noch ein letzter Kuss - Marguerita startete den Thunderbird und fuhr los. Andrew winkte ihr hinterher.
Er hatte noch etwas mehr als elf Tage Zeit. Marguerita etwas mehr als zehn Tage ...
*
Washington, D.C., 27. September 1999
Der Spätsommer wollte kein Ende nehmen. Strahlend blauer Himmel über Washington. Und noch immer fast zwanzig Grad. Die Passanten auf dem Bürgersteig trugen T-Shirts, die Kinder liefen noch in Shorts herum.
William Archer hatte keinen Blick für solche Nebensächlichkeiten. Er steuerte seinen dunkelgrauen Buick Park Avenue über die Connecticut Avenue Richtung Süden. Den halben Tag hatte er zu Hause in seinem Haus am Rock Creek Park verbracht. Heute Abend würde er mit seinem Wahlkampfteam nach Minneapolis, Minnesota fliegen.
Seine Sekretärin, Rita Narrow, hatte ihn angerufen. Akten stapelten sich auf seinem Schreibtisch. Er musste ins Büro, um wenigstens einen Teil davon abzuarbeiten. Die nächsten vier Wochen waren vollgepfropft mit Wahlkampfterminen. Doch deswegen konnte Archer sein Amt als Senator nicht einfach auf Eis legen.
Eine rote Ampel flammte auf. Archer trat auf die Bremse, der Buick stoppte mit schreienden Bremsen. Er bog die Halterung des Handy zu sich und tippte eine Nummer in die Tastatur. Eine kalifornische Nummer. Eine Frauenstimme mit spanischem Akzent meldete sich aus der Freisprechanlage. ">Twentynine Palms Inn<?"
Seit zwei Wochen hatte Archer seinen älteren Sohn Jefferson in dem Kalifornischen Hotel einquartiert. Das ehemalige Kurhotel für Kriegsveteranen lag zweieinhalb Autostunden östlich von Los Angeles. Kriegsveteranen stiegen allerdings schon lange nicht mehr im >29 Palms Inn< ab. In den letzten Jahren war das Hotel zum Insidertipp unter Schauspielern und Models geworden. William Archer hatte keine Ahnung davon.
"Geben Sie mir Mr. Starksboro, Haus Nummer vier." Der leitende Psychiater der Privatklinik in Georgetown hatte Archers Sohn für geheilt erklärt. Er wollte allerdings nicht dafür garantieren, dass Jefferson nie wieder von einem psychotischen Schub heimgesucht würde.
Archer wurde verbunden. Kurz darauf eine heisere Männerstimme. "Starksboro?"
"Billy Archer hier, alles klar bei euch, Dave?"
"Alles bestens, Sir - ich hab die Sache im Griff."
"Was macht Jefferson?"
"Mickey geht's gut, Sir. Er rudert fast jeden Tag auf den See hinaus, schwimmt sogar manchmal und angelt stundenlang. Gestern ist er bis spät in die Nacht in der Bibliothek rumgehangen."
Die Ampel sprang auf grün. Archer fuhr an und bog nach links in die Massachusetts Avenue ein. "Bibliothek?" Er runzelte die Stirn. "Früher gab's mal Tanzveranstaltungen in dem Hotel."
"In die Disco geht er auch - klar", knurrte der Mann am anderen Ende der Leitung. David Starksboro war seit fast acht Jahren Leibwächter des Senators. Archer vertraute ihm rückhaltlos. Deswegen hatte er ihn auch beauftragt seinen Sohn unter die Fittiche zu nehmen. "Und Frauen gibt's hier auch jede Menge." Starksboro feixte - der Senator hörte es seiner Stimme an.
"Hat er Kontakte zu Frauen?"
"Das will ich meinen, Sir." Die Antwort beruhigte Archer. Zerstreuung brauchte sein Sohn. Zerstreuung und wieder Zerstreuung, ganz egal durch was. Das hatte der Arzt William Archer und seiner Frau eingeschärft. Und das war die Strategie, die der Senator verfolgte. Alles, was Jefferson davon abhielt, seinen Wahnideen nachzuhängen, war gut. Und Sex hielt Archer für die beste Zerstreuung schlechthin.
"Nimmt er seine Medikamente?" Auch das hatte der Psychiater ihnen eingeschärft - solange Jefferson sein Neuroleptikum einnahm, hatte die Psychose keine Chance.
"Was denken Sie, Sir", knurrte Starksboro. "Ich hab schon kapiert, worauf's ankommt."
"Ich weiß doch, Dave, ich weiß - ich verlass mich auf dich."
"Das können Sie, Sir."
Archer beendete das Gespräch. Während der ersten Phase des Wahlkampfes wollte er seinen Sohn erst einmal im >29 Palms Inn< wohnen lassen. Dort, in der tiefsten Provinz und weit vom Schuss, war er sicher untergebracht. Sicherer sogar, als in der teuren Privatklinik. Und unverfänglicher war dieser Ort ebenfalls. Falls einer der Pressegeier ihn aufstöbern sollte. Bei den Medien musste man mit allem rechnen.
Archer machte sich keine Sorgen. David Starksboro war ein guter Mann. Er hatte Jefferson unter Kontrolle, ohne Frage. Und wenn im Frühling nächsten Jahres die heiße Phase des Wahlkampfes losging, würde sich etwas Neues finden. Archer spielte mit dem Gedanken, seinen Sohn in dieser Zeit bei Verwandten in Brasilien unterzubringen.
Ein paar Minuten später bog er in die Independence Avenue ein. Dort, in unmittelbarer Nähe des Capitols, lag sein Büro. Er parkte seinen Buick in der Tiefgarage und fuhr mit dem Aufzug in den vierten Stock hinauf.
Mit großen Schritten hastete er durchs Vorzimmer. "Liegen die Akten auf meinem Schreibtisch, Rita?"
Seine Sekretärin blickte ihn aus ihren dunkel geränderten Eulenaugen an. Vorwurfsvoller als sonst, wie Archer fand. "Ich hab alles vorbereitet, Sir", sagte sie spitz. Archer horchte auf. Etwas stimmte nicht. "Die Unterlagen warten in Ihrem Büro auf Sie. Und sie befinden sich in interessanter Gesellschaft."
Ihr giftiger Unterton war nicht zu überhören. "Was soll das heißen?" Archer belauerte sie aus schmalen Augen. Ihm schwante Übles. Seit Ende August hatte er sich nicht mehr bei Julia Rosen gemeldet.
"Dass nicht nur die Akten in Ihrem Büro auf Sie warten." Rita Narrow blitzte ihn an. "Die Lady ließ sich nicht abwimmeln. Sie behauptete, einen Termin mit Ihnen zu haben." Abrupt wandte sie sich ihrem Monitor zu und hämmerte auf ihre Tastatur ein.
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783738906813
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (März)
- Schlagworte
- blindwütiger wahn thriller