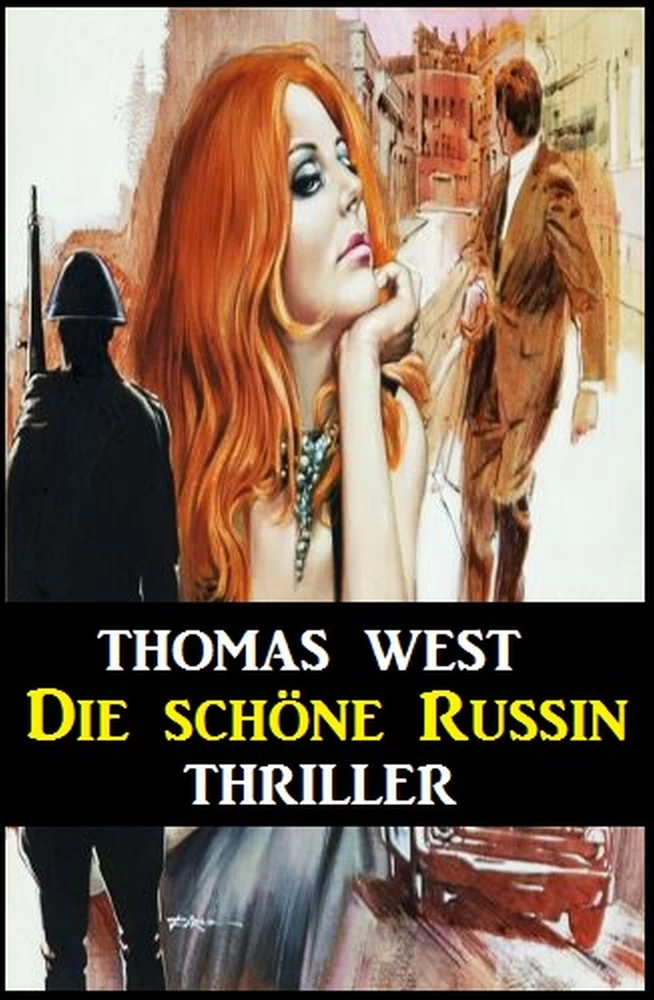Zusammenfassung
Jesse Trevellian und seine Kollegen setzen alles daran, den Fall zu lösen - während die schöne wie undurchsichtige Russin Saskia nicht nur dem Ermittler gefährlich nahe kommt ...
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Die schöne Russin
Thriller von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 235 Taschenbuchseiten.
Ein Österreicher hat als Informatiker Karriere im Silicon Valley gemacht. Seit er als Kind Zeuge eines Banküberfalls wurde, ist es sein Ziel, ein Sicherheitsprogramm für Banken zu entwickeln, das Überfälle verhindern soll. Bevor er seine geniale Software der >Transatlantic Traffic Bank< in New York anbieten kann, wird er beinahe Opfer eines Mordanschlags. Offenbar wollen nicht nur Gangster sein Computerprogramm stehlen, sondern auch ein Killer ist hinter ihm her.
Jesse Trevellian und seine Kollegen setzen alles daran, den Fall zu lösen - während die schöne wie undurchsichtige Russin Saskia nicht nur dem Ermittler gefährlich nahe kommt ...
Cover: Firuz Askin
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2016 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Prolog: Spittal, Österreich - Spätsommer 1984
Die Bank lag in einer kleinen Seitenstraße, nicht weit vom Fluss - ein hässlicher Flachbau mit grauer Eternitfassade und ein paar verblühten Azaleentöpfen in den beiden ansonsten schmucklosen Fenstern.
Auf dem Vordach über der einflügeligen Eingangstür leuchtete in roten Neonbuchstaben der Name der Bank: >Raiffeisenkasse<. In fast jedem Kuhdorf der Hohentauern fand man diese schlichten Bankfilialen mit dem roten Namenszug an der Fassade oder auf dem Vordach - zweckmäßig und nach rein praktischen Gesichtspunkten konzipiert.
Bergbauern, Handwerker und Sägewerksbetreiber legten keinen Wert auf Bankgebäude, deren Architektur an Kathedralen oder antike Tempel erinnerte. Kirchen hatten auszusehen wie Kirchen und Banken wie Banken: Büros mit einem Kassenschalter eben. Ordentlich und ein wenig wie staatliche Behörden.
Die Dreitausender um das kleine Kreisstädtchen waren aufregend genug. Genau wie der Fluss, der während der Schneeschmelze manchmal zu einem reißenden Strom anschwoll, oder die anstrengende Landwirtschaft auf dem oftmals steilen Äckern und Weiden. Da konnten die Gebäude der öffentlichen Institutionen ruhig ein wenig Langeweile ausstrahlen. Und das taten die meisten Filialen der Raiffeisenkasse.
Dem Halbwüchsigen, der an diesem Vormittag mit feuchten Händen die Milchglastür zum Schalterraum der Bank aufdrückte, klopfte trotzdem das Herz.
Nicht, weil mit dem Betreten der Bank sechs katastrophale Minuten für ihn anbrachen - sechs Minuten, die sein Leben entscheidend prägen sollten. Das wusste der Dreizehnjährige zu diesem Zeitpunkt, als sich die Eingangstür der Bank scharrend hinter ihm schloss, noch nicht. Wer merkt das schon, wenn sich die entscheidenden Weichenstellungen des Schicksals vollziehen. Im Rückblick dann, sicher, im Rückblick sagt man: Dann und dann ist es geschehen. Jahre später würde auch der junge Wolf Amann das sagen.
Aber jetzt war er nur aufgeregt, weil er zum ersten Mal in seinem Leben Geld abheben wollte. Und zwar Geld, das ihm niemand geschenkt hatte. Geld, das er sich selbst verdient hatte. Mit seinen Händen, mit seinem Schweiß, mit eigener Kraft. Wolf Amann hatte die Sommerferien über als Küchenhilfe in einem Hotel gearbeitet: Geschirrspülen, Putzen, Mülleimer leeren und Kartoffeln schälen - vier Wochen lang.
Zwei Leute standen vor ihm am Kassenschalter. Eine junge Frau und ein Mann in den Vierzigern. Die Frau kannte Wolf flüchtig. Eine Kollegin der ältesten seiner vier Schwestern. Sie war Verkäuferin in einer Bäckerei schräg gegenüber. Er beobachtete, wie sie einen großen Geldschein unter dem Schalterglas hindurchschob. Der Kassierer auf der anderen Seite des Glases, ein dicklicher Endfünfziger in grauem Anzug, legte ihr ein halbes Dutzend Münzrollen in die Schublade.
Den Mann, der jetzt direkt vor ihm stand, kannte Wolf ebenfalls. Hannes Gastein. Er war in den ersten vier Schuljahren sein Klassenlehrer gewesen. Und hatte sich bei Wolfs Vater dafür eingesetzt, dass der Junge das Gymnasium besuchen konnte.
»Na, Wolf - Bankgeschäfte?«, lächelte er.
Wolf murmelte einen Gruß und nickte. Bankgeschäfte - das klang gut. Das klang sogar sehr gut. In seiner Brust schwoll etwas an, und er musste tief durchatmen, damit der Stolz ihm nicht als breites Grinsen aufs Gesicht kroch. Achttausend Schilling abheben - wenn das kein Bankgeschäft war!
Sein ehemaliger Lehrer lächelte immer noch. Und zog dabei fragend die Brauen nach oben.
»Hab' gejobbt in den Ferien«, erklärte Wolf, »und jetzt hol' ich's Geld.«
»Gratuliere.« Gastein machte ein anerkennendes Gesicht. »Größere Anschaffung geplant?«
Noch einmal holte Wolf tief Luft. Stereoanlage, neue Abfahrtski, Moped und anderes schoss ihm für Momente durch den Kopf.
Doch dann sagte er die Wahrheit.
»Einen Computer.«
Er hielt den Atem an, während er die Gedanken seines ehemaligen Lehrers auf dessen Gesicht zu lesen versuchte. Überraschung mischte sich in das Lächeln des Mannes. »Das ist eine lohnende Investition«, sagte er schließlich.
Eine lohnende Investition - Wolf platzte fast vor Stolz. Sein Vater hatte anders reagiert, als er ihn vor einem halben Jahr um Geld für einen gebrauchten Commodore gebeten hatte.
»Schmarren«, hatte sein Vater gesagt, »kommt mir nicht ins Haus, so ein Schmarren!«
Er war Schreinermeister und hatte einen kleinen Betrieb von Wolfs Großvater übernommen. Sein Lebenstraum: dass sein einziger Sohn die Schreinerei eines Tages übernehmen würde.
Wolfs Onkel, der Bruder seines Vaters, hatte ein gutes Wort für den Filius eingelegt. Er war Techniker beim Schieferbergwerk in der Nachbarstadt.
»Dem Computer gehört die Zukunft«, hatte er seinem Bruder in langen, feuchten Nächten auseinandergesetzt.
Und irgendwann hatte der alte Amann gesagt: »Von mir aus. Aber ich zahle keinen Groschen für so einen Schmarren. Sieh zu, wie du an das Geld kommst!«
Das hatte Wolf getan.
Und jetzt lagen fast achttausend Schilling auf seinem Konto.
Zusammen mit seinem Ersparten konnte Wolf damit sogar einen neuen Rechner kaufen.
Und genau das wollte er tun.
Die Frau raffte ihre Münzrollen zusammen und wandte sich vom Kassenschalter ab. Gastein nickte Wolf noch einmal zu, zückte seine Brieftasche und drehte sich zu dem Bankangestellten hinter dem Schalter um.
Und dann ging alles sehr schnell.
Die Frau stieß einen unterdrückten Schrei aus. Wolf sah die Augen des Kassierers sich weiten. Gleichzeitig mit Gastein fuhr er herum.
Das Mädchen stand wie festgewurzelt zwei Schritte vor dem Ausgang, mit hochgezogenen Schultern und die Hände mit der Geldtasche gegen ihre Brust gepresst.
Vor ihr ein Maskierter - rote Turnschuhe, schwarze Zimmermannshose, schwarzes Blouson, schwarze Wollmütze mit Augen und Mundschlitzen bis über das Kinn gezogen.
In seiner Rechten eine Flinte mit abgesägtem Lauf.
»Überfall!«, schrie er und stieß die junge Frau zurück in den Raum. »Keiner rührt sich, sonst knallt's!«
Er richtete die Waffe auf Wolf und Gastein.
»Hinlegen! Auf den Bauch!«
Der Kassierer war aufgesprungen und streckte die Arme in die Luft, als wäre dort eine unsichtbare Stange, an der er sich festhalten konnte. Sein Mund stand weit offen, und Wolf sah für einen Moment eine Reihe von Goldkronen in seinem Unterkiefer.
»Du auch!«, fuhr der Mann die Frau an. Wolf warf sich neben seinen ehemaligen Lehrer auf den Boden.
Plötzlich ein donnerndes Krachen über ihm.
Wolf hob unwillkürlich den Kopf.
Der Maskierte holte zu einem weiteren Schlag mit einem kurzstieligen Vorschlaghammer aus - die Scheibe vor dem Kassenschalter zersplitterte. Die Bruchstücke sausten in den winzigen Kassenraum.
Von dem Kassierer sah Wolf nur das leichenblasse Gesicht mit den weit aufgerissenen, starren Augen und die hoch gestreckten Hände. Er hatte sich bis an die Rückwand des Schalterraums zurückgezogen.
Der Maskierte zog eine Plastiktüte aus der Jacke. »Rein mit dem Geld!«
Wolf konnte seinen Blick nicht von dem Bankräuber losreißen. Breitbeinig stand der Mann drei Schritte vor ihm, vor der zertrümmerten Schalterscheibe, und hielt die abgesägte Flinte auf den Kassierer gerichtet.
Plötzlich sah er sich um. Für einen Moment nur blickte Wolf in das maskierte Gesicht - weite Pupillen zwischen zusammengekniffenen Lidern, und über der Oberlippe glänzte ein feiner Schweißfilm.
»Glotz nicht!«, schrie der Mann. Mit zwei raschen Schritten war er neben dem Jungen und trat zu.
Wolf drückte die Stirn auf den kalten Steinboden, schlang die Arme über Kopf und Nacken. Die Tritte trafen seine Ohren, seine Rippen, seine Nieren ...
»Hören Sie auf!« Gasteins heisere Stimme neben ihm.
Aus den Augenwinkeln sah Wolf, wie der Lehrer das Hosenbein des Maskierten umklammerte, sah, wie der taumelte, sah den kurzen Lauf des Gewehrs senkrecht nach unten in sein Blickfeld stoßen und auf Gasteins Kopf zielen.
Wolf schloss die Augen. Sein Körper krampfte sich zusammen, als der Schuss fiel.
Panik raste seine Beine hinunter, dann hinauf bis in seine Kopfhaut und wieder zurück in die Zehenspitzen.
Der Junge spürte nichts mehr - nicht seine schmerzenden Rippen, nicht den kalten Stein an seiner Stirn, nicht, wie sich sein Darm und seine Blase leerten.
Er sah auch nicht, wie der Maskierte dem Kassierer fluchend die Plastiktüte mit Geld entriss und aus der Bank stürmte.
Endlose Minuten später drang das sich nähernde Signalhorn der Gendarmerie in sein Bewusstsein. Und das Schluchzen der jungen Frau über ihm. Zitternd hob Wolf den Kopf.
Die Frau stand direkt vor ihm, beide Hände auf den Mund gepresst. Ihre tränenverhangenen Augen blickten nicht zu Wolf herunter, sondern zu Gastein.
Der Kopf des Lehrers lag in einer Blutlache. Sein Mund öffnete sich alle vier, fünf Sekunden, und er schnappte nach Luft. Sein Körper bäumte sich immer leicht auf dabei.
Der Kassierer kniete neben ihm. »Heilige Mutter Gottes«, flüsterte er immer wieder. »Heilige Mutter Gottes ...«
Wolf hörte sein Herz durch seine Brust galoppieren, als hätte es sich losgerissen. Sein Unterkiefer schien sich ebenfalls zu verselbstständigen, denn seine Zähne schlugen klappernd aufeinander. Die Gestalt des sterbenden Lehrers verschwamm vor seinen Augen.
Die Intervalle zwischen den schnappenden Atemzügen des Angeschossenen dehnten sich mehr und mehr. Während draußen Bremsen quietschten und Autotüren knallten, zuckte Gasteins Körper zum letzten Mal ...
Spät am Abend brachte ihn ein Polizeiwagen aus der Klinik nach Hause. Seine Schwestern und seine Eltern warteten vor dem Eingang des hell erleuchteten Fachwerkhauses. Und fast zwei Dutzend andere Bewohner des kleinen Bergbauerndorfes.
Im Schein der Außenbeleuchtung erkannte Wolf die glitzernden Spuren zwischen den Bartstoppeln seines Vaters. Nie zuvor hatte er ihn weinen gesehen.
Sie umringten ihn wie eine schützende Eskorte und führten ihn ins Haus.
Drei Tage lang sprach der Junge kein Wort. Stumm hockte er auf der Bank des großen Kachelofens und starrte vor sich hin. Er fand keine Worte, um das zu beschreiben, was er mit hatte ansehen müssen - große Pupillen in den Sehschlitzen einer schwarzen Wollmütze, ein Schweißfilm auf einer Oberlippe, einen sich gierig öffnenden Mund, das letzte Aufbäumen eines Sterbenden ...
Als er nach drei Wochen zum ersten Mal wieder das Haus verließ, begleitete ihn seine älteste Schwester hinunter in die Stadt. Mit zwei großen Paketen kehrten sie Stunden später zurück. Wolfs Herz klopfte, als der >Commodore< endlich auf seinem Schreibtisch thronte.
Von diesem Tag an ging Wolf wieder zur Schule. Äußerlich nahm sein Leben den gewohnten Gang. Abgesehen davon, dass er fast seine gesamte Freizeit vor dem Computer verbrachte.
Oft stand sein Vater außen an seiner Zimmertür und lauschte dem Klappern der Tastatur.
»Weißt du eigentlich schon, was du später einmal beruflich machen willst?«, fragte ihn eines Tages der Psychiater, der ihn in den zwei Jahren nach dem Banküberfall behandeln musste.
»Ja, das weiß ich«, antwortete Wolf, »das weiß ich sogar ganz genau.«
Er blickte in die fragenden Augen des Arztes und schwieg.
1
Catskill Mountains, New York State, 20. September 1998
Etwa zwanzig Bootslängen vor mir huschte ein grauer Schatten über das flach abfallende Geröllfeld auf das Ufer des Flusses zu. Ich steuerte meinen Kajak näher an die gegenüberliegende Uferseite, legte das Doppelpaddel vor mir über mein Boot und beobachtete das Tier.
Es war ein Waschbär. Ein ziemlich fetter Bursche. Er trug einen länglichen Gegenstand in seiner spitzen Schnauze. Ich war noch zu weit entfernt, um seine Beute identifizieren zu können.
Am Ufer angelangt, griff sich der Waschbär das Ding in seinem Maul und tauchte es ins Wasser des Gebirgsflusses.
Langsam trieb mein Kajak näher.
Seit fünf Tagen hatte ich mich hier in der Wildnis der Catskill Mountains verkrochen. Fünf Tage ohne einen Menschen zu Gesicht zu bekommen, fünf Tage ohne Telefon, Hektik und die vierundzwanzig Stunden am Tag dröhnende Geräuschkulisse des Big Apple. Fünf Tage nur mit mir allein.
Ein ungeplanter Kurzurlaub. »Sie beide müssen mal eine Woche raus«, hatte unser Chef gesagt.
Die letzten Monate waren weiß Gott hart gewesen - wir hatten einen Waffenhändlerring gesprengt, einen Killer durch New York State verfolgt, der einen hochgefährlichen, bakteriologischen Kampfstoff aus Armybeständen geraubt hatte, und ein aufreibender Undercover-Einsatz an der Route 66 lag hinter uns.
Eine kleine Atempause war also angesagt.
Mit Streichhölzern hatten wir ausgeknobelt, wer zuerst fahren sollte. Ausnahmsweise hatte Milo mal den Kürzeren gezogen. Er würde seine Woche Urlaub nach mir antreten.
Mit beiden Pfoten drehte der Waschbär seine Beute im Wasser hin und her. Bis jetzt hatte er mich noch nicht entdeckt.
Er war nicht das erste Wildtier, dass mir in diesen Tagen über den Weg gelaufen war. Gestern hatte ich einen Rudel Rothirsche beobachtet. Und gleich in der ersten Nacht hatte ich tatsächlich einen ausgewachsenen Uhu gesehen.
Wie meistens in der ersten Nacht auf ungewohnter Matratze hatte ich nicht schlafen können. Am Flussufer hatte ich im Gras gelegen und fasziniert den glitzernden Sternenhimmel beobachtet. Im von Abermillionen Watt erleuchteten Manhattan kommt man selten in diesen Genuss.
Plötzlich war über mir die Silhouette der riesigen Eule aufgetaucht. Sie war lautlos über das Wasser gesegelt und dann wie ein Stein in die gegenüberliegende Uferböschung gefallen. Der Todesschrei einer Bisamratte oder eines Kaninchens, Flügelschlagen und das Rascheln fliehender Tiere im Unterholz. Fast eine halbe Stunde lang hatte ich beobachten können, wie der Uhu seine Beute kröpfte.
Bis auf etwa zehn Bootslängen kam ich nun an den Waschbären heran. Dann entdeckte er mich. Er stellte sich auf die Hinterbeine und beäugte mich kurz.
Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen, als ich die Beute zwischen seinen Vorderpfoten erkannte - ein knusprig braun gebratener Hühnerschlegel!
Im nächsten Augenblick schoss das Vieh die steinige Böschung hinauf und tauchte ins Unterholz des dichten Waldes ein.
Mir schwante Übles. Ich hatte keinen Camper, Angler öder Pfadfinder in der näheren Umgebung meiner Blockhütte gesehen. Also gab es nur eine mögliche Quelle für angebratene Hühnerbeine ...
Ich paddelte zum Ufer, zog den Kajak an Land und trug ihn hinauf an den Waldrand, wo ich ihn mit Ästen und Zweigen tarnte. Das Doppelpaddel nahm ich mit. Die Hütte lag keine zehn Minuten vom Fluss entfernt auf einer kleinen Waldlichtung. Sie gehörte Orry. Fast jeder aus unserem Team war hier schon einmal in Klausur gegangen. So manches Wochenende hatte ich auch zusammen mit Milo in dem urigen Holzhaus verbracht.
Schon von Weitem bestätigte sich mein Verdacht: Das Dachfenster stand offen. Eine Fichte streckte ihr Geäst bis dicht an das Ziegeldach der Hütte heran.
Als ich die Eingangstür aufstieß, gab es keinen Zweifel mehr: Der Tisch, auf dem ich das Mittagsgeschirr hatte stehen lassen, war leer gefegt. Auf dem Boden: zerbrochenes Glas, Scherben eines Tellers, Besteck und Essensreste, dazwischen angebissene Äpfel und zermanschte Bananen. Und vor dem Herd lag die Bratpfanne in einer fettglänzenden Soßenpfütze. Keine Spur mehr von dem Hühnerschlegel, den ich heute zum Abendbrot hatte essen wollen.
Ich trat wieder hinaus ins Freie.
»Mistvieh!«, brüllte ich in den Wald hinein.
Die nächste Stunde war ich mit Aufräumen und Putzen beschäftigt. Fluchend beseitigte ich das Chaos, das das räuberische Pelzvieh angerichtet hatte.
Danach hatte ich genug von der Einsamkeit. Nichts gegen Gebirgsflüsse, Naturromantik, Eulen und Rotwild - aber fünf Tage reichten. Ich musste mal wieder einen Menschen zu Gesicht bekommen, ein paar banale Sätze mit jemandem reden und mal wieder ein frisch gezapftes Bier trinken.
Der nächste Ort lag eine knappe Autostunde entfernt. Ich rasierte mich, wechselte Hosen und Hemd und holte meinen Sportwagen aus der Wellblechgarage neben der Hütte.
Ein paar Meilen ging es über holprige Waldwege, bevor ich endlich auf eine schmale asphaltierte Straße gelangte.
Links und rechts von mir zogen die Ahornbäume und Buchen vorbei. Erste orangene und ockerfarbene Flecken breiteten sich in ihrem grünen Laub aus. In spätestens drei Wochen würden sich die Wälder hier in ein atemberaubendes Farbenmeer verwandelt haben.
Nach über einer halben Stunde erreichte ich den Highway 28 und konnte endlich aufs Gaspedal treten. Und fünfundzwanzig Minuten später passierte ich den Ortseingang von Woodstock.
In der ortsansässigen Künstlerkolonie hatten hier vor dreißig Jahren einige Größen der Rockmusik gelebt. Jimmy Hendrix und Bob Dylan. Und wenn ich mich recht erinnerte auch Van Morrison.
Das legendäre Musikfestival, das den idyllischen Ort 1969 schlagartig berühmt machte, hatte allerdings sechzig Meilen südwestlich von hier stattgefunden. In Bethel. Ein paar alternative Wohngemeinschaften waren das einzige Überbleibsel dieser glorreichen Tage.
>Woodstock Pizza< verkündete der große Schriftzug auf einer der Holzfassaden eines großen Flachbaus. Genau das Richtige für mich. Ich stellte meinen Sportwagen auf dem Parkplatz ab.
Flüchtig glitt mein Blick über die Kennzeichen der parkenden Wagen: Connecticut, Maine, Ohio, Michigan - fast alle östlichen Bundesstaaten waren vertreten. Sogar texanische Kennzeichen entdeckte ich. Und ein Wohnmobil aus Kalifornien.
Vermutlich alles Altfreaks, die hierherkamen, um in Erinnerungen zu schwelgen.
Ich betrat das Restaurant. Der große Gastraum war nicht mal zur Hälfte gefüllt. Neben ein paar Waldarbeitern und Truckern schienen die meisten der Gäste tatsächlich Touristen zu sein. Genau wie ich.
Ich orderte eine Riesenpizza und Bier vom Fass. Auf einem leeren Stuhl lag die Sonntagsausgabe der >New York Times<. Ohne die Zeitung anzurühren, überflog ich die Schlagzeilen >Rechtsausschuss des Kongresses gibt die Videobänder des Präsidenten-Verhörs vor der Grand Jury zur Veröffentlichung frei< >Hurrikan George tobt auf der Karibik zu< ...
Das reichte mir. Ich beschloss, meine in den fünften Tag gehende Nachrichtenabstinenz noch ein Weilchen durchzuhalten. Die großen und kleinen Katastrophen konnten warten, bis ich mich übermorgen in der Federal Plaza zurückmelden würde. Als ich meine Lederjacke auszog und über die Stuhllehne hängte, fiel mein Blick auf das Handy. Es ragte aus der Innentasche heraus und schien mich vorwurfsvoll anzugucken. Ich hatte es auf Mailbox umgestellt und seit vier Tagen nicht mehr hineingehört. Trevellian in Urlaub - unerreichbar und nicht zu stören.
Ich zögerte.
Bis deine Pizza im Holzofen durchgebacken ist, kannst du ruhig mal in die Box hören, sagte ich mir. Um ehrlich zu sein: Es gab da eine gewisse Lady, über deren Anruf ich nicht ganz unglücklich gewesen wäre.
Also zog ich das lästige Gerät heraus und tippte die Nummer meiner Mailbox in die Tastatur.
Ich hätte es bleiben lassen sollen - wenigstens noch vierundzwanzig Stunden lang.
Drei Anrufe waren auf der Box gespeichert. Und einer tatsächlich von der gewissen Lady - Sarah Boyle. Ein paar Tage vor meinem Urlaub war ich zum ersten Mal mit der Nachrichtensprecherin von CBS essen gewesen. Leider wirklich nur essen. Jetzt teilte sie mir mit, dass sie vier Wochen an der Westküste zu tun hätte. Schade.
Der zweite Anruf von Orry Medina. »Ich hab' was vergessen, Jesse - du musst unbedingt darauf achten, die Fenster zu schließen. Ein Waschbär hat sich in der Nähe der Hütte angesiedelt. Ein verdammt frecher Bursche. Vor dem ist nichts sicher ...«
Ich verdrehte die Augen. »Vielen Dank, Kollege«, murmelte ich, »herzlichen Dank für die Warnung ...«
Der dritte Anruf schließlich von Mr McKee. Er hatte erst im Laufe des Vormittags versucht, mich zu erreichen. Im Telegrammstil bat mich unser Chef um Rückruf.
Es lag auf der Hand, was das zu bedeuten hatte: Mein Kurzurlaub war beendet!
Ich versuchte, meine Pizza und mein Bier zu genießen, so gut es eben ging. Danach rief ich die Zentrale in Manhattan an.
»FBI District Office New York, was kann ich für Sie tun?« Die Altstimme unserer Chef-Telefonistin. Nach fünf Tagen Einsamkeit in der Wildnis schien sie mir noch eine Spur erotischer zu klingen als sonst.
»Trevellian hier. Hi, Linda - wie geht's?«
»Hallo, Jesse! Hast du etwa Sehnsucht nach uns?«
So schlimm war es nicht. Aber ich konnte nicht leugnen, dass es mir guttat, eine vertraute Stimme zu hören. »Muss ich mal drüber nachdenken, Linda. Sicher ist aber, dass der Chef Sehnsucht nach mir hat. Er hat mir nämlich auf die Mailbox gesprochen. Kannst du mich mal eben mit ihm verbinden?«
»Mach' ich - bye, bye, Jesse!«
Ein paar Sekunden später die Stimme von Mr McKee. »Hallo, Jesse. Schön, dass Sie sich gleich melden. Tut mir wirklich leid, Sie im Urlaub stören zu müssen, aber ich hab' da ein Problem.«
Mein Verdacht schien sich also zu bestätigen. »Mein Urlaub ist zu Ende, stimmt's?«
»Na ja - so schnell noch nicht. Aber wenn Sie einen Tag früher zurückkommen könnten, wäre ich Ihnen dankbar. Ich habe keinen Agenten frei im Augenblick und brauche Sie dringend. Oder genauer gesagt: Norman Ruther braucht Sie.«
»Ruther? Was hat der denn für Sorgen?« Norman Ruther war Inspector der New York City Police und leitete die >Bank Robbery Task Force<. In dieser Spezialeinheit ermittelten Beamte der New York City Police und Agenten des FBI gemeinsam in Fällen von Bankraub. Insofern arbeiteten wir immer wieder eng mit Ruther zusammen. Ich kannte ihn gut.
»Das ist mit wenigen Worten am Telefon nicht zu sagen ...« Der Chef räusperte sich und legte eine Denkpause ein. »Vielleicht so viel: Es geht um einen jungen Informatiker, der eine brisante Software für Sicherheitssysteme in Banken entwickelt hat. Er hat sie verschiedenen Banken hier in Manhattan angeboten. Die >Transatlantic Traffic Bank< hat uns den Tipp gegeben. Der Mann läuft mit seiner Software in der Tasche herum, und die Bankleute glauben, man sollte ein Auge auf ihn haben. Norman und ich sehen das genauso.«
»Verstehe«, sagte ich, »und ich soll ihn observieren.«
»So ungefähr. Wenn die Software in falsche Hände gerät, wäre das fatal. Die Sache ist übrigens schon bis nach Washington vorgedrungen. Ich habe heute Morgen mit Director Sessions gesprochen. Es geht also um eine Chefsache, wenn ich das mal so formulieren darf.«
»Verstehe«, brummte ich. Obwohl ich nicht allzu viel verstand. »Wann soll ich zurückkommen?«
»Die >Transatlantic Traffic Bank< hat am Mittwochvormittag einen Termin mit dem Mann vereinbart. Wir sind gerade dabei, seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Morgen werden wir sicher wissen, in welchem Hotel er abgestiegen ist. Ruther will dann vorübergehend ein paar Kollegen von der New York City Police in seiner Nähe postieren. Wenn Sie ihn spätestens ab Dienstag unter ihre Fittiche nehmen könnten, wären wir alle sehr beruhigt, Jesse.«
»Das heißt, ich sollte spätestens morgen Nachmittag an der Federal Plaza sein.«
»Wenn sich das machen ließe, wäre es wirklich fein, Jesse.«
»Okay, Sir, bis morgen.«
Fast alles lässt sich machen. Es ließ sich ja auch machen, mich in einen ungeplanten Urlaub zu schicken. Warum sollte ich ihn nicht ungeplant beenden, wenn die Firma rief.
Sicher - ich wäre gern noch einen Tag geblieben. Schon, um den räuberischen Waschbären aufzustöbern und ein wenig zu ärgern. Aber der Gedanke, in weniger als vierundzwanzig Stunden wieder zu Hause in Manhattan zu sein, hatte auch etwas für sich.
Ich griff mir nun doch die Zeitung und vertiefte mich in den Bericht über den Hurrikan. Im Laufe des nächsten Tages würde George die Dominikanische Republik erreichen. Weit über tausend Meilen entfernt von Woodstock. Die Menschen auf den Inseln dort hatten keine Möglichkeit, vor ihm zu fliehen.
Der Sturm, der sich über mir zusammenbraute, war noch knapp hundertfünfzig Meilen entfernt. Und statt zu fliehen, würde ich ihm morgen entgegenfahren.
2
Moskau, 21. September 1998
Die Schulglocke schrillte, die Gesichter der Kinder hellten sich auf. Doch keiner der Schüler wagte es, seine Sachen zusammenzuräumen. Die Blicke der Jungen und Mädchen hingen erwartungsvoll an dem strengen Gesicht der hochgewachsenen jungen Frau vor der Tafel.
Saskia Borodin wandte sich um. »Notiert euch die Hausaufgaben.« Mit Kreide schrieb sie eine Seitenzahl an die Tafel und die Nummern der Aufgaben, die die Schüler bis zum nächsten Tag bearbeiten sollten. »Ich werde jedes Heft kontrollieren. Also - gebt euch Mühe! Auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen!«, erklang es im Chor. Und gleich darauf schwirrten an die dreißig Kinderstimmen durch das muffige Klassenzimmer. Lachen, Rufen, Stühlerücken, Klappern von Stiften, Mäppchen und Taschenschlössern. Innerhalb weniger Minuten leerte sich das Klassenzimmer.
Saskia setzte sich an das Pult und nahm die große Hornbrille ab.
Sofort milderte sich der herbe Zug in ihrem schmalen, schönen Gesicht. Mit einer müden Handbewegung strich sie sich eine Strähne ihres blondierten Haares aus der Stirn und steckte sie zurück in den Nackenknoten. Dunkle Ringe lagen unter ihren großen grünen Augen.
Sie zog das Kassenbuch heran, um die Unterrichtsstunde zu protokollieren.
Aus den Augenwinkeln nahm sie die schmächtige Gestalt eines Mädchens wahr. Schweigend wartete die Zwölfjährige, bis Saskia das Buch zuklappte.
»Was gibt es, Jelena?«, fragte die Lehrerin.
»Was ist, wenn ich die Hausaufgaben nicht machen kann?« Das Mädchen sprach mit dünner Stimme.
»Warum solltest du sie denn nicht machen können?« Saskia runzelte die Stirn und musterte aufmerksam das blasse Gesicht der Kleinen.
»Ich ... ich muss arbeiten gehen ...«
Saskia hob den Kopf und sah der Kleinen in ihre schmalen braunen Augen. Eine Mischung aus Ängstlichkeit und Trauer flackerte darin.
Ich muss arbeiten gehen ... Saskia wich dem Blick des Mädchens aus. Sie wusste, was das für sie selbst bedeutete - arbeiten gehen. Was es für Jelena hieß, konnte sie nur ahnen. Mit der Mutter auf dem Markt Eier aus eigener Produktion verkaufen. Mit dem Bruder vor dem Hauptbahnhof die Schuhe von Regierungsfunktionären und skandinavischen Touristen putzen. Mit dem Vater in irgendein ominöses Fotostudio gehen und sich ausziehen. Oder Schlimmeres.
Saskia strich sich fahrig mit den Fingerspitzen über die Stirn. Als wollte sie die bedrückenden Vorstellungen aus ihrem Kopf vertreiben. »Versuch, wenigstens die Hälfte der Aufgaben zu erledigen«, seufzte sie schließlich.
Das Mädchen verstand. Sie deutete ein Nicken an, wandte sich ab und huschte aus der offen stehenden Tür des Klassenzimmers.
»Scheiße«, murmelte Saskia. Jelena unterschied sich von der Hälfte ihrer Schüler nur dadurch, dass sie halbwegs ehrlich war. Die anderen sprachen nicht über die Dinge, die sie davon abhielten, die Schule für wichtig zu halten. Nur Jelena.
Und eigentlich war es auch nicht Ehrlichkeit, das dieses leicht unterernährte, scheue Mädchen nach dem Unterricht immer wieder an den Pult ihrer Lehrerin trieb. Es war ein Hilferuf. Schlicht und ergreifend ein Hilferuf und weiter nichts. Saskia hatte Antennen für so etwas. Sie spürte es genau. Aber sie wollte es nicht wissen.
Morgen würde sie einen flüchtigen Blick in das Mathematikheft des Mädchens werfen und die fehlenden Hausaufgaben einfach übersehen. Sie selbst schätzte es auch nicht, wenn man ihr allzu genau auf die Finger sah. Niemand in Moskau schätzte das.
Zu Fuß lief sie durch die Innenstadt zur Metro-Station. Während sie die breite Treppe zu den Bahnsteigen hinabging, fummelte sie den ständig klemmenden Reißverschluss ihrer Umhängetasche aus abgewetztem Kunstleder auf. Sie zog ihren Fahrschein heraus und tastete nach dem kühlen Metall ihrer kleinen Walther-Pistole. Seit sie die Waffe bei sich trug, betrat sie die Metro-Stationen wesentlich unbefangener als früher.
Sie hatte die Pistole vor einem halben Jahr einem britischen Diplomaten abgenommen. Keine schöne Erinnerung. Der Mann hatte sie angezeigt. Das taten viele, die das Pech hatten, an sie zu geraten - der Brite aber war so weit gegangen, dass er sich an die Zeitung gewandt hatte. Unter falschem Namen natürlich und als angeblicher Geschäftsmann. Trotzdem musste Saskia ein paar Tage nach dem Raub in der >Prawda< ihre Personenbeschreibung lesen.
Das war ihr zuvor noch nie passiert. Die Wochen danach war sie nachts brav im Haus geblieben, und die Nachtclubs an der Twerskaja hatte sie sogar vier Monate lang gemieden. Obwohl man dort, an der Prachtstraße Moskaus, die meisten bargeldschweren Fremden treffen konnte.
Glücklicherweise konnte eine Personenbeschreibung Saskia Borodins immer nur eines ihrer vielen Gesichter schildern. Und glücklicherweise wuchs in Moskau das Gras schneller über solche Dinge als anderswo. Man konnte nicht sämtliche Raubüberfälle, Diebstahlsdelikte und Morde im Gedächtnis behalten, die hier Tag für Tag den Weg in die Zeitungen fanden. Am allerwenigsten die Polizei konnte und wollte das.
Wie meistens stieg Saskia in den letzten Wagen der U-Bahn. In einer der hinteren Sitzreihen fand sie einen freien Platz. Von hier aus konnte man die zusteigenden Fahrgäste im Auge behalten. Und Leute, von denen Gefahr ausgehen könnte, frühzeitig erkennen. Kahlköpfige Jugendliche in schwarzen Lederjacken, Straßenräuber, Sittenstrolche, Polizisten in Zivil.
Nicht, dass Saskia übermäßig viele schlechte Erfahrungen in der U-Bahn gemacht hatte. In den drei Jahren, in denen sie in Moskau arbeitete, war sie erst zweimal im Zug überfallen worden. Beide Male allerdings nachts. Einmal hatte ihr eine dreiköpfige Gang mit gezückten Messern ihre Brieftasche abgenommen, und das andere Mal war sie haarscharf an einer Vergewaltigung vorbeigeschrammt.
Misstrauen und Vorsicht waren Saskia einfach in Fleisch und Blut übergegangen. So, wie anderen Leuten das Schalten beim Autofahren. Ihre Kindheit und Jugend auf den Straßen St. Petersburgs waren für sie eine Art Ausbildung gewesen.
Sie holte einen Stapel Schülerhefte aus ihrer Tasche und begann, das Diktat zu korrigieren, das sie heute hatte schreiben lassen. Rasch flog ihr roter Stift über die hingekritzelten Zeilen, strich an, verbesserte, strich durch. Wie immer arbeitete Saskia schnell und ziemlich flüchtig.
Ihre Stelle als Lehrerin war für sie nicht mehr als ein Nebenjob, für den sie nicht mehr Zeit aufzuwenden pflegte als unbedingt nötig. Die paar Rubel, die er abwarf, konnte man vergessen.
Immerhin bot er eine bürgerliche Fassade. Hinter ihr verborgen konnte die Siebenundzwanzigjährige ihrem eigentlichen Job nachgehen. Und der lag heute noch vor ihr.
Nach fünf Stationen stieg sie aus. Erschöpft nahm sie Stufe für Stufe der Treppe, die sie von dem Bahnsteig hinauf in die Stadtrandsiedlung führte - trostlose Betonfassaden sechsstöckiger Mietblocks, einer neben dem anderen.
Nach fünf Fußminuten erreichte sie den, in dem ihre Zweizimmerwohnung lag. Nach dem galoppierenden Verfall des Rubels hätte sie mit ihrem Lehrergehalt gerade noch die Kaltmiete bezahlen können. Wenn der Staat das Geld einigermaßen regelmäßig überwiesen hätte.
Sie stieg in den dritten Stock hinauf, betrat ihre kleine Wohnung und warf die Tasche auf die Bettcouch. Decke und Kissen noch zerwühlt von den drei Stunden unruhigen Schlafs heute Morgen, das schwarze Nachthemd über der Klinke der offen stehenden Badezimmertür, auf dem niedrigen Tisch vor der Bettcouch: ein Porzellanbecher, halb voll mit kaltem Kaffee, butterverschmiertes Besteck, ein Teller mit Eierschalen und einem halben Stück Brot.
Auf der Wand hinter der Couch eine Fototapete: die nächtliche Skyline Manhattans - Saskias Traumstadt. Sobald sie genug Dollars zusammengespart hatte, wollte sie dort hinfliegen. Am liebsten zu Silvester 2000.
Saskia schaltete das Fernsehgerät in dem Wandregal am Fußende der Couch ein und holte sich zwei Äpfel aus der Küche. Während sie das Obst schälte, behielt sie die in dunkle Anzüge gehüllten Männer auf der Mattscheibe im Auge. Der neue Ministerpräsident stellte seine Regierungsmannschaft vor. Und sein Krisenprogramm.
Saskia winkte verächtlich ab und konzentrierte sich auf ihre Äpfel. Nur noch mit halbem Ohr hörte sie den Nachrichten zu. Irgendwo in Nordafrika war ein Flugzeug abgestürzt, die NATO rasselte Richtung Belgrad mit den Säbeln, und seit gestern musste man zwölf Rubel für den Dollar hinlegen.
Das allerdings ließ sie hellhörig werden.
Also bekomm' ich auf dem Schwarzmarkt mindestens fünfzehn Rubel pro Dollar, dachte Saskia. Vielleicht sogar achtzehn.
Sie ließ die Jalousie herunter, um die Nachmittagssonne auszusperren. Bis auf das Höschen ausgezogen, verkroch sie sich unter die Decke.
Der Fernseher lief weiter. Wie meistens, wenn sie zu Bett ging. Dann brauchte sie keine Schlafmittel. Sie stellte den Wecker auf halb neun Uhr abends.
Irgendein Hurrikan tobte in der Karibik auf irgendwelche Inseln zu. Der Name drang in ihr schon schläfriges Bewusstsein. Was für Namen die Amis den Stürmen in ihrer Gegend der Welt verleihen ... George - wie ihr erster Präsident ... Mit diesem Gedanken schlief sie ein.
*
Das Klappern ihrer roten Pumps hallte von den Wänden der menschenleeren U-Bahn-Station, während sich das Rauschen des Zuges entfernte. Leichtfüßig sprang sie die Treppe hinauf. Wie immer wartete das Taxi schon vor der hell erleuchteten Fassade des Gagarin Krankenhauses.
Saskia ließ den Wagen nie vor ihrer Haustür warten. In den anonymen Mietblocks ihrer Wohnsiedlung kümmerte sich zwar kaum jemand um seinen Nachbarn - man grüßte sich ja nicht mal im Treppenhaus -, aber Saskia hielt es für besser, eine Station mit der Metro zu fahren, bevor sie ins Taxi stieg. Sie wollte vermeiden, dass sich am Ende doch noch jemand fragte, wie es sich eine Lehrerin leisten konnte, an zwei bis drei Abenden in der Woche mit dem Taxi zu fahren.
Der Taxifahrer stieg aus, ging um den Wagen herum und hielt ihr mit einer charmanten Geste die Beifahrertür auf. Bosiak, ein Jurastudent, der sich sein Studium mit Nachtdiensten hinterm Steuer verdiente.
Seine Augen glitten bewundernd über Saskias elegante Gestalt: Das weit über Schultern und Rücken wallende Blondhaar, kirschrot geschminkte Lippen in dem etwas trotzig wirkenden, ebenmäßigen Gesicht, schwarze Spitzenbluse, weit aufgeknöpft unter bordeauxrotem, kurzem Blazer, und enger Minirock in gleicher Farbe, der ihre unglaublich langen Beine enthüllte. Der Nachmittagsschlaf und geschickt aufgetragenes Make-up hatten die dunklen Schatten unter den Augen vertrieben, Kontaktlinsen die Hornbrille abgelöst - die Frau, die sich an Bosiak vorbei in den Volvo schwang, hatte kaum noch Ähnlichkeit mit der braven Lehrerin Saskia Borodin.
»Wie geht's, Bosiak?«
»Bestens, Saskia. Und selbst?«
Der etwas untersetzte, schwarzhaarige Mann startete den Wagen und steuerte die Innenstadt an. »Kann nicht klagen.«
Sie hielt ihm einen Hundert-Rubel-Schein hin, den er wortlos entgegennahm.
Die Fahrt verlief weitgehend schweigend. Die Bedingungen zwischen Bosiak und Saskia waren klar: Hundert Rubel für die Anfahrt und zehn Prozent der Beute am Ende der Nacht. Kein schlechtes Geschäft für den Studenten, zumal Saskia nicht die Einzige war, mit der er zusammenarbeitete.
Eine halbe Stunde später betrat Saskia das >Night Fever<. Gedämpftes Licht umfing sie. Die kehligen Klänge eines Saxophons schwirrten durch den Raum wie ein unsichtbarer Vogel. Auf der Tanzfläche drehten sich einige Paare. Blicke von der Theke, von den Tischen trafen Saskia, Gemurmel, Gläserklirren, vereinzeltes Gelächter hier und dort.
Der Nobelnachtclub an der Twerskaja-Straße war nur etwas mehr als halb voll. Völlig normal für diese Zeit, fast zwei Stunden vor Mitternacht. Erst nach zwölf würde sich hier Körper an Körper drängen.
Mit wiegenden Hüften schritt Saskia zur Theke, schaute dabei lächelnd nach rechts und links, taxierte die Männer, registrierte, wer Ausländer war und wer nicht, wer allein saß oder stand und wer sich schon im Bannkreis einer Frau aufhielt.
Ihr Rock gab das letzte Geheimnis ihrer Oberschenkel frei, als sie sich auf den Barhocker schwang. Jede Bewegung tausendfach geübt und ihre Wirkung unzählige Male erprobt Saskia musste sich nicht umschauen, um die Blicke zu bemerken, die gierig über ihre Beine, ihre Brüste, ihr Haar strichen. Saskia spürte solche Blicke.
Sie bestellte ein Glas trockenen Rotwein und eine Flasche Soda. Links und rechts und an den Tischen hinter ihr andere Frauen, ähnlich kostümiert, Studentinnen, Hausfrauen, Büroangestellte - man musste schon mit der Szene vertraut sein wie Saskia, um die Huren von denen zu unterscheiden, die zu ihrem Vergnügen hier waren. Äußerlich standen sich beide Gruppen in nichts nach.
Sie saß nicht lange allein. Links von ihr schob sich ein schwarzer Lockenkopf auf einen Barhocker, bestellte Wodka und musterte sie mit glühenden Augen.
Eiskalt der Blick, mit dem Saskia ihn abblitzen ließ - der junge Kerl war Kaukasier, Aserbaidschaner wahrscheinlich, niemand jedenfalls, der dumm und schwächlich genug war, in ihre Falle zu tappen. Und wenn Leute seines Schlages es doch taten, gaben sie keine Ruhe, bis sie einen gefunden hatten und sich rächen konnten.
Der Glatzkopf aber, der sich rechts von ihr aufpflanzte und mit linkischer Geste dem Barkeeper bedeutete, dass Saskias Getränke auf seine Rechnung gingen, der schien verheißungsvoll zu sein.
Sein Vollmondgesicht begann zu strahlen, als sie sein Lächeln erwiderte. Er gab sich sichtlich Mühe, den eingezogenen Bauch nicht wieder über den Hosenbund rollen zu lassen, und rückte näher. So nahe, dass sie seinen säuerlichen Schweiß und den Alkohol in seinem Atem riechen konnte.
Er trug einen braunen Allerweltsanzug, war gut zwanzig Jahre älter als Saskia und sah nach Bargeld aus.
»Jan«, stellte er sich vor und stammelte ein paar Brocken in Russisch, aus denen Saskia sich keinen Reim machen konnte. Immerhin verriet er sich durch seinen Akzent als Skandinavier, vermutlich ein Finne, vielleicht ein Holzhändler oder Ähnliches.
»Verena«, hauchte Saskia und sprach ihn auf Englisch an. Das funktionierte leidlich, und der Mann freute sich wie ein kleiner Junge, als sich Saskia von ihm die Hand küssen ließ.
Er bestellte eine Flasche Sekt.
Danach lief es wie immer - kleine Scherze, Näherrücken, grapschende Finger auf Rücken und Schenkel, viel Sekt und Schnaps, Küsschen auf die Wange, gierig tastende Zungen schließlich und noch mehr Sekt und noch mehr Schnaps. Jeder Job hat seine Routine.
Saskia überließ den Wodka Jan und nippte nur am Sektglas.
Später schob sie den einen halben Kopf kleineren Mann über die Tanzfläche, drückte ihre Hüften und Brüste an seinen schwitzenden Körper und signalisierte mit jedem Blick, mit jeder Geste: Ich bin zu kaufen.
Gegen ein Uhr konnte der gute Jan kaum noch stehen vor Schnaps, Sekt und Geilheit. Er war erntereif, wie Saskia das zu nennen pflegte. Während er mit zwei Hundert-Dollar-Noten bezahlte, tippte Saskia die Nummer des Studenten in ihr Handy.
Fünf Minuten später schob sie den torkelnden Mann in den Fond von Bosiaks Taxi. Sie ließ sich neben ihn fallen und versuchte, seine fordernden Umarmungen abzuwehren. »Nicht hier, mein kleiner dicker Jan!«, kicherte sie. »Warte noch ein paar Minuten, gleich sind wir in meinem Schlafzimmer.«
Der Mann war viel zu betrunken, um zu bemerken, dass der Taxifahrer zielstrebig durch die Gassen der Altstadt kurvte, ohne eine Adresse von Saskia gehört zu haben.
In einer spärlich beleuchteten Gasse hielt der Volvo. Saskia half dem Mann aus dem Taxi, zog ihn durch ein Hinterhoflabyrinth hinter sich her und schloss endlich die niedrige Tür einer Parterrewohnung auf.
Zusammen mit zwei Kolleginnen hatte sie die Einzimmerwohnung gemietet. Nur das nötigste Mobiliar befand sich darin: ein französisches Bett, zwei Stühle, ein Tisch, Sessel und Schrank und natürlich ein Bad. In der kahlen Küche gab es nicht mal einen Herd.
Saskia drückte den kichernden Mann aufs Bett und zog ihre Kostümjacke aus. »Das Bad ist dort drüben«, sagte sie mit rauchiger Stimme.
Er stand auf und wankte auf die Tür zu, auf die Saskia mit einer Kopfbewegung gedeutet hatte. Sie wartete, bis sie das Plätschern seines Urins hörte. Dann streifte sie ihre Pumps von den Füßen, und verschwand mit zielstrebigen Schritten in der Küche.
Zwei Wassergläser und eine Flasche Wodka in den Händen haltend, kehrte sie zurück. Sie füllte die Gläser mit dem Schnaps, das eine kaum fingerbreit, das andere halb.
Im Bad rauschte die Wasserspülung.
Saskias flinke Finger zogen ein Medizinfläschchen aus braunem Glas aus ihrer kleinen Handtasche. Sie schraubte es auf und träufelte zwanzig Tropfen einer farblosen Flüssigkeit in das halb volle Wodka-Glas.
Die Badezimmertür knarrte, erwartungsvoll grinsend wankte Jan zum Bett zurück. Mit offenem Hosenschlitz.
Saskia hielt ihm das Glas mit dem Wodka entgegen. »Erst noch ein Liebestrank, Süßer«, säuselte sie, »und dann ...«
»Und dann ...?« Sie begann, ihre schwarze Bluse aufzuknöpfen. Er ließ sich neben sie aufs Bett plumpsen. Ohne seine Augen von ihren sich langsam entblößenden Brüsten zu wenden, trank er den Wodka.
Saskia ließ die Bluse an sich heruntergleiten und griff nach ihrem Glas. »Auf dein Wohl, Jan.« Sie berührte den Schnaps nicht einmal mit den Lippen.
Mit zitternder Hand leerte er sein Glas, knallte es auf den Nachttisch, griff nach den Trägern ihres BHs.
Sie entzog sich ihm und stand auf. »Ich muss noch mal schnell für kleine Mädchen.«
Kichernd huschte sie ins Bad.
Sie drückte die Tür hinter sich zu, lehnte sich mit dem Rücken dagegen und lauschte.
Es vergingen keine drei Minuten, bis sie ihn schnarchen hörte.
Zurück bei dem tief schlafenden Mann, durchsuchte sie systematisch die Taschen seiner Hosen und seines Jacketts. Neben einigen Scheinen in finnischer Währung trug er sage und schreibe sechshundert Dollar mit sich herum.
Saskia lachte laut auf. Gerade so viel ließ sie in seiner Brieftasche, dass er noch das Taxi würde bezahlen können. Auch seine Uhr nahm sie ihm ab und seine silbernen Manschettenknöpfe.
Sie kippte den Wodka aus, spülte die Gläser und rauchte eine Zigarette.
Nach einer halben Stunde etwa begann sich ihre Beute zu räkeln. Die Wirkung des Betäubungsmittels ließ langsam nach.
Saskia tippte Bosiaks Nummer ins Handy. Danach beugte sie sich über den Mann und schüttelte ihn.
»Jan!«, zischte sie. »Aufwachen, Jan! Wach endlich auf, verdammt!«
Er riss die Augen auf und sah in ihr angstverzerrtes Gesicht.
»Schnell, Jan - du musst verschwinden!« Sie zog ihn hoch und drückte ihm seine Jacke gegen die Brust. »Mein Mann kommt jeden Augenblick zurück! Der schlägt uns tot!«
Sie schob ihn vor sich her durch die Wohnungstür hinaus auf die Straße. Dort stand schon Bosiaks Taxi am Straßenrand.
Saskia stieß den Mann auf den Beifahrersitz und schlug die Tür zu.
Sie sah den Rücklichtern des Volvos hinterher, bis sie sich im dunklen Labyrinth der Gassen verloren ...
3
Manhattan, 21. September 1998
Seine Rechte tastete nach dem schwarzen Lederrucksack neben dem Bett. Er hob ihn ein wenig an und ließ ihn auf den Teppichboden fallen.
Kunststoffhüllen schlugen aneinander. Das Geräusch beruhigte ihn.
Sein Notebook hatte Wolf Amann im Tresor an der Rezeption seines Hotels deponiert. Sich von den zwanzig CDs mit seiner Software zu trennen, hatte er nicht über sich gebracht. Niemand trennt sich freiwillig von seiner Zukunft.
Auf jede Toilette, in jedes Bad hatte er die CDs mitgenommen. Sogar in die Betten der Huren, mit denen er sich die Stunden zwischen den Bankbesuchen versüßt hatte.
Aus der Außentasche des Rucksacks angelte er eine Schachtel Chesterfield. Er stopfte sich das Kissen unter seinen stoppelhaarigen Quadratschädel. Seine für einen Mann ungewöhnlich vollen Lippen schlossen sich um eine Filterlose und zogen sie aus der Schachtel.
Das kleine Feuerzeug rutschte aus der Zigarettenpackung und fiel in das dunkle Gestrüpp seiner Brustbehaarung.
Er zündete sich die Zigarette an. Genüsslich inhalierte er den Rauch.
Seine Gedanken kehrten zu der Entscheidung zurück, die er nun schon den vierten Tag vor sich herschob.
Zurückfliegen und Dennis persönlich die schlechte Nachricht bringen? Oder hier in New York City bleiben, bis die Verhandlungen mit den Banken abgeschlossen waren?
Die Kosten für die Flüge an die Westküste und übermorgen, am Mittwoch, wieder zurück an die Ostküste waren nicht der Grund dafür, dass sich Wolf Amann noch immer in Manhattan aufhielt. Er war kein allzu guter Geschäftsmann. Wenn es darum ging, einem alten Freund und Weggefährten eine sehr persönliche Botschaft angemessen zu servieren - noch dazu eine für ihn sehr schmerzliche Botschaft -, dann durfte man nach Wolf Amanns Überzeugung weder Kosten noch Mühen scheuen.
Der Grund der ungeplanten Verlängerung seines New-York-Aufenthaltes hieß Sandy Miller, hatte kurzes schwarzes Haar und hübsche Grübchen in den Wangen. Sandy lachte nämlich meistens. Und der Weg von der Bethesda Fountain im Central Park, wo sie sich am Freitag kennen gelernt hatten, bis in das Bett ihres Apartments in der Westside, wo Sandy wohnte, war herrlich unkompliziert gewesen. Genau wie der Sex mit ihr.
Kurz und gut: Wolf und Sandy waren das ganze Wochenende nicht mehr aus dem Bett gekommen. Heiße Tage, ganz nach dem Geschmack des frauenhungrigen Österreichers.
Als er jetzt, am Montagnachmittag, mit schlechtem Gewissen an seinen Freund Dennis Tolby im Silicon Valley an der Westküste dachte, befand er, dass es sich nun doch nicht mehr lohnte, nach San Francisco zu fliegen.
Immerhin trennten ihn kaum noch sechsunddreißig Stunden von dem lang ersehnten Termin bei der >Transatlantic Traffic Bank<. Und damit, wie der Siebenundzwanzigjährige hoffte, von dem ersten Tag einer langen Reihe von fetten Jahren.
Wolf Amann blies den Rauch seiner Zigarette der Decke entgegen. Durch die offene Badezimmertür Wasserrauschen und der laute Gesang einer Frauenstimme: >Stand by me< - Sandy konnte nicht nur herrlich lachen, sondern auch herrlich singen.
Wolf drückte seine Zigarette aus und rieb sich mit seinen großen, kräftigen Händen die Wangen und das Kinn. Sein schwarzer Dreitagebart fühlte sich an wie die Oberfläche einer Drahtbürste.
Er kroch aus dem Bett. »Kann ich mal von deinem Apparat aus telefonieren?«, rief er durch die offene Badezimmertür. Sandy stand unter der Dusche.
»Klar!«
»Aber ich muss San Francisco anrufen!« Er ging ins Bad.
Sie stellte das Wasser ab und zog den Duschvorhang beiseite. »Kannst mich ja dafür morgen Abend zum Essen einladen. Gib mir mal das Handtuch!«
Er zog sie an sich und küsste ihr die Wassertropfen von den kleinen Brüsten.
»Das Handtuch!«
Sandy hatte es eilig - in zwei Stunden würde ihr Nachtdienst im Roosevelt Hospital Center beginnen. Die quirlige Frau arbeitete dort als Ärztin.
Wolf warf ihr das Handtuch zu und ging zurück zum Bett. Auf Sandys Nachttisch stand ihr Telefon. Daneben lag seine randlose Brille.
Er setzte sie auf und blickte auf die Uhr - halb fünf. Dann war es an der Westküste halb eins. Dennis müsste eigentlich noch im Büro sein. Vor eins ging er nie zum Mittagessen. Wolf Amann wählte eine Nummer in Palo Alto. Während das Freizeichen ertönte, räusperte er sich. Er hasste solche Gespräche.
»Tolby Watch Company.« Eine helle, geziert klingende Männerstimme meldete sich - Dennis Tolbys Stimme.
»Hi, Dennis. Ich bin's - Wolf.«
»Wo steckst du, zum Teufel?«
»Immer noch in New York City.«
Schweigen am anderen Ende der Leitung. Dennis Tolby schien genau zu wissen, was jetzt kam. Aber Wolf wartete vergeblich darauf, dass sein Freund und Chef ihm irgendeine Brücke bauen würde.
Wieder räusperte er sich. »Ich wollte es dir eigentlich persönlich sagen ... aber ... mir ist etwas dazwischengekommen ... ich konnte nicht weg hier ...«
Sandy verließ das Badezimmer - splitternackt und mit wippenden Brüsten stolzierte sie zu ihrem Kleiderschrank am Fußende des Betts.
Ihre Anwesenheit verunsicherte Wolf noch mehr. Er riss seine Augen von ihrem Körper und suchte nach Worten.
»Also ... es ist so ... ich hab's neulich ja schon mal angedeutet - ich steig' bei dir aus und mach' mich selbstständig.«
Jetzt war es heraus.
Für einige Sekunden hörte er nur den Atem des anderen.
Dann: »Zahl' ich dir nicht genug?«
»Ach, lass doch, Dennis!«, sagte Wolf heftiger, als er gewollt hatte. »Ich weiß doch, wie es um die Firma steht - keinen Dollar könntest du mir drauflegen!«
»Mit was willst du auf den Markt, Wolf? Du planst doch irgendein Projekt. Warum packen wir es nicht gemeinsam an?«
Der vorwurfsvolle Unterton in Tolbys Stimme war nicht zu überhören. Wusste er etwa Bescheid?
Wolf schlug einen entrüsteten Ton an. »Quatsch! Wie kommst du darauf? Ich will einfach auf eigenen Füßen stehen, weiter nichts!«
Das war nicht die Wahrheit, aber Wolf gehörte zu den Menschen, die selbst engsten Freunden gegenüber ihre Geheimnisse hatten.
»Mit unserer Software?« Jetzt klagte Tolby ihn ganz offen an.
»Hör zu, Dennis.« Sachlicher und leiser als zuvor klang Wolfs Stimme. »Erstens habe ich die meiste Software entwickelt, mit er du Geschäfte machst. Zweitens werde ich hier an der Ostküste auf den Markt gehen und mich hüten, dir deine Kundschaft in Russland abspenstig zu machen. Und drittens habe ich ein ganz eigenes Programm entwickelt, von dem du gar nichts weißt.«
Eine Zeitlang sagte keiner der beiden etwas.
Dann Tolbys belegte Stimme: »Dir ist klar, dass ich ohne dich den Laden zumachen kann!«
»Quatsch, Dennis! Du suchst dir einfach einen anderen Informatiker. Jeden Tag steigen irgendwelche Europäer mit neuen Ideen auf dem San Francisco International Airport aus dem Flugzeug! Die stehen doch Schlange im Silicon Valley!«
»Überleg's dir noch mal, alter Freund«, sagte Tolby.
»Es gibt nichts mehr zu überlegen, Dennis - mein Entschluss steht fest.«
Er murmelte einen Abschiedsgruß, den Tolby nicht erwiderte, und legte auf.
Er bemerkte, dass seine Hände schwitzten. Wochenlang hatte er diesen Bruch mit Dennis Tolby vor sich hergeschoben. Seit die Software serienreif war, die er in monatelanger Nachtarbeit entwickelt hatte.
Wolf war kein Mann, der einen Freund so ohne Weiteres im Stich ließ. Immerhin hatte ihm Tolby zwei Jahre lang die Möglichkeit gegeben, das zu tun, was er am besten konnte: Computerprogramme schreiben.
»Hey, Mann - was ist los?« Sandy musterte ihn mit gerunzelter Stirn, während sie in ihre weißen Jeans stieg. »Hast du deinem Chef den Laufpass gegeben?«
»So ungefähr.« Wolf sah durch sie hindurch.
»Kannst du dir das erlauben? Ich meine - man braucht doch einen Job. Und außerdem gibt es Verträge.«
»Wir haben fast ein Jahr lang in Dennis' Kellerbar herumgetüftelt, und als es dann nur so hagelte von Aufträgen, waren wir viel zu beschäftigt, um an Verträge zu denken.«
»Was habt ihr denn verkauft?« Sandy streifte sich ein weißes T-Shirt über den nackten Oberkörper und ließ sich neben Wolf aufs Bett fallen, um ihre Tennisschuhe anzuziehen.
»Software für Betriebsorganisation.«
»Versteh' nicht, wieso du so einen Job aufgibst, wenn es doch gut läuft.«
»Es lief in letzter Zeit nicht mehr so gut.« Wolf blieb wortkarg.
Dass er Dennis in Verdacht hatte, einen Teil des Firmenkapitals in seinen teuren Fuhrpark gesteckt zu haben, erzählte er nicht. Und auch, dass er das Gefühl gehabt hatte, von dem älteren und geschäftstüchtigen Tolby zunehmend ausgenutzt zu werden, behielt er für sich.
Sandy und er hatten fast drei Tage lang bis zur Besinnungslosigkeit gevögelt. Na und? Mit einem besonderen Vertrauensverhältnis hatte das nach Wolfs Auffassung nicht unbedingt was zu tun. Und schon gar nicht mit dem, was alle Welt >Liebe< nannte.
Obwohl ... Wolf betrachtete das schmale Frauengesicht neben sich - der energische Mund, die kleine Stupsnase, die braunen, hellwachen Augen, die ihn aufmerksam musterten ... Wenn er nicht auf der Hut war, würde ihm die fünf Jahre ältere Frau doch noch gefährlich werden.
»Du bist ein verdammt kluger Kopf, Wolf«, sagte Sandy. »Erzähl mir nicht, dass du einen Job aufgibst, ohne etwas Besseres in Aussicht zu haben.« Sie küsste ihn auf den Mund.
Dann sprang sie auf und zog ihre Jeansjacke von der Stuhllehne.
»Davon erzählst du mir morgen Nachmittag, wenn ich aus der Klinik komme. Okay?«
Wolf schwieg. Eigentlich hatte er mit dem Gedanken gespielt, das Kapitel Sandy abzuhaken. Das prickelnde Gefühl für sie, das sich fast schmerzhaft in seiner Brust regte, beunruhigte ihn.
Nichts fürchtete er mehr als eine Beziehung mit einer Frau. Eine Beziehung, die über Sex und Fun hinausging.
»Du wirst doch bleiben, oder?« Für einen Moment lag ein ängstlicher Schatten auf Sandys schönem Gesicht. Doch als sie sich noch einmal zu ihm herabbeugte und ihm zärtlich zwischen die nackten Beine griff, lachte sie schon wieder. »Oder?«
Wolf riss sie an sich. »Klar werd' ich bleiben«, flüsterte er.
Sie machte sich los, winkte, und verschwand im Flur. Kurz darauf hörte Wolf die Wohnungstür.
Er stand auf und ging an die Fensterfront des Apartments. Eine Stimme in seinem Bauch beglückwünschte ihn. Eine andere in seinem Kopf behauptete, er wäre gerade im Begriff, einen Fehler zu begehen.
Wolf öffnete das Fenster und beugte sich hinaus. Zwei Minuten später sah er Sandy zehn Stockwerke tiefer die Straße Richtung Amsterdam Avenue überqueren. Die U-Bahn-Station, in der sie einsteigen würde, lag zwei Blöcke weiter nördlich an der 72nd Street. Dort waren sie auch am Freitag ausgestiegen, als sie vom Central Park gekommen waren.
Den Mann in dem schwarzen Golf auf der anderen Straßenseite sah Wolf nicht. Dabei blickte der neugierig zu dem Fenster hoch, von dem aus Wolf mit einem unguten Gefühl hinter Sandy hersah.
*
»Feierabend!« Ginger Jackson stieß die Schwungtür zu den Büroräumen des 20. Polizeireviers auf. »Und morgen ist frei!« Er schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch von Miriam Anderson. »Da geht es zum Angeln ins Hudson-Tal!«
Die mollige Beamtin sah ihren Kollegen mit ihrem traurigen Hundeblick an, der ihr im Revier den Spitznamen >Doggy< eingebrockt hatte. »Sorry, Ginger - wir beide müssen morgen Streife fahren.«
Der riesige Afroamerikaner stemmte die Fäuste in die Hüften und richtete sich in voller Körpergröße vor Miriam Andersons Arbeitsplatz auf. Die New York City Police musste die Uniform für ihn bei einem Schneider nach Maß anfertigen lassen. Der Schwarze war so groß, dass er sich vor jedem Türrahmen bücken musste.
»Du spinnst, Doggy«, sagte er mit tonloser Stimme. »Sag, dass das nicht wahr ist.«
Die Frau zuckte mit den Schultern und strich sich nervös ihr rotes Kraushaar aus der Stirn. »Kann ich nicht, Ginger. Ist nämlich wahr. Nelson und Koch müssen in Albany bei dem Prozess gegen den Kidnapper von Tarry Town aussagen. Und wir übernehmen ihren Dienst.«
»Bullshit!«, brüllte Ginger. »Bullshit! Bullshit! Bullshit!« Er bearbeitete mit beiden Fäusten Miriams Schreibtisch.
Sie betrachtete ihn mit einer Mischung aus Respekt und Abscheu. Jeder im Revier kannte Gingers Temperamentsausbrüche. Und etliche Kollegen fürchteten sie mehr als die frostigen Launen des Dienststellenleiters. Miriam Anderson fürchtete nicht nur Gingers hitzigen Charakter, sondern auch seinen Spott - der große schwarze Cop hatte etwas gegen Frauen in Uniform. Besonders wenn sie dick, rothaarig und etwas tolpatschig waren wie Miriam.
Ginger beugte sich weit über Miriams Schreibtisch. »Warum ich?«, jammerte er. »Warum immer ich?« Anklagend ballte er die Fäuste vor ihrem großen Busen. »Kannst du mir das sagen, Doggy - he? Kannst du mir das sagen?«
Sie stieß sich mit ihren kurzen, dicken Beinen vom Tisch ab und ließ so ihren Stuhl aus dem Wirkungskreis von Gingers Knoblauchatem rollen. »Ich mach' die Dienstpläne nicht. Der Chef hat das angeordnet. Wahrscheinlich sucht er nach Gründen, dich eines Tages doch noch zu befördern.«
»Baxter, dieses Arschloch ...«, knurrte Ginger.
In diesem Moment schwang die Tür auf. »Was ist denn das für ein Lärm hier?« Captain Baxter, der Leiter des 20. Reviers, betrat das Büro. Mit einer steilen Falte zwischen den buschigen grauen Augenbrauen fixierte er seine beiden Officers.
»Oh - gar nichts, Captain, gar nichts.« Ginger zwang sich zu einem Grinsen. »Ich hab' nur gerade ... also, mein Bruder rief gerade von der Pferderennbahn an - ich hab' hundert Dollar verloren ...«
»Legen Sie Ihr Geld vernünftiger an, Jackson.« Baxter wandte sich wieder zur Tür, doch dann drehte er sich noch einmal um. »Sie müssen morgen einspringen, Jackson. Geht das okay?«
»Klar, Captain - kein Problem!«
»Hab' ich mir gedacht«, brummte Baxter und verschwand.
Ginger und Miriam starrten auf die hin- und herschwingenden Türflügel.
»Also doch kein Problem.« Miriam konnte sich ein verächtliches Grinsen nicht verkneifen.
»Dienst am freien Tag - Bullshit«, flüsterte Ginger. Langsam drehte er seinen riesigen Schädel seiner Kollegin zu. »Und noch dazu mit so einem Rollmops wie dir ...«
*
»Er ist österreichischer Staatsbürger.« Mr McKee reichte mir ein Foto. Es zeigte einen nicht ganz dreißigjährigen Mann, unrasiert, mit schwarzen Stoppelhaaren und sinnlichen Lippen. Die runde Brille vor seinen etwas misstrauisch dreinblickenden Augen wollte nicht recht zu dem Schwarzenegger-Gesicht passen.
»Seit wann in den Staaten?«, fragte ich.
»Knapp zweieinhalb Jahre«, brummte Norman Ruther. Der Chef der >Bank Robbery Task Force< kaute auf einem Kaugummi herum. Vermutlich versuchte er mal wieder, sich das Rauchen abzugewöhnen. Wie immer trug er einen reichlich zerknitterten Anzug. Einen dunkelbraunen, bei dessen Anblick einem Modefreak wie Orry Medina die Haare zu Berge gestanden hätten. Klein, untersetzt und mit Doppelkinn und Tränensäcken sah er ein paar Jahre älter aus, als er war - nämlich zweiundfünfzig.
»Und er ist Computerfachmann?«, fragte ich.
»Informatiker, um es ganz genau zu sagen.« Norman beugte sich über den Papierstapel, der vor ihm auf dem Konferenztisch lag. »Die Kollegen aus Washington haben uns seine Vita zusammengestellt.« Er zog ein Blatt Papier heraus und reichte es mir. »Hat sein Studium im Schnelldurchgang absolviert. In Salzburg. Und dann bei einer Softwarefirma in San Francisco gearbeitet.«
»Ganz erfolgreich, wie es scheint«, warf Mr McKee ein.
»Einer von den vielen europäischen Senkrechtstartern, denen es zu Hause nicht schnell genug geht mit der Karriere.« Norman nahm einen Schluck von Mandys Kaffee. »Wenn man den Bankfritzen glauben darf, scheint Amann so eine Art Genie zu sein.«
Ich überflog das Papier mit den Personalien des Österreichers. Siebenundzwanzig Jahre alt, in einem kleinen Bergdorf auf gewachsen, als Sechzehnjähriger einen Preis für eine Sicherheitssoftware erhalten, Mathematik und Informatikstudium, ein halbes Jahr bei einem namhaften Software-Unternehmen im Silicon Valley beschäftigt. Klang alles nach einem ziemlich glatten Karrieretypen. »Was weiß man über die Software, die er anbietet?«
»Na ja, ziemlich wenig, wenn Sie mich fragen, Jesse.« Wieder beugte sich Norman über seine Unterlagen. »Ich hab' hier ein Protokoll von dem Gespräch mit den Informatikern der >Transatlantic Traffic Bank<.« Wieder bekam ich einen Bogen Papier über den Tisch geschoben. »Sie werden nicht allzu viel damit anfangen können, reinstes Fachchinesisch.«
»>IntelliSec<«, las ich laut.
»Das steht für >Intelligente Security System<«, erklärte Mr McKee. »Es handelt sich dabei um ein computergesteuertes Sicherheitssystem, das alle denkbaren sicherheitsrelevanten Faktoren in einer Bank erfassen und ihre Messungen kombiniert auswerten kann.«
»Aha«, machte ich. Die Erklärung von Mr McKee erschien mir reichlich abstrakt.
»Anders ausgedrückt«, brummte Norman Ruther, »das Programm sorgt dafür, dass ein Computer ständig mit Metalldetektoren, Videokameras, Mikrofonen, Tresoren und weiß der Himmel mit was noch allem in Verbindung steht.« Die leichte Röte, die das fleischige Gesicht des Inspectors überflog, bewies, dass er die Sache spannend fand. »Und aus den Daten, die ihm all diese sensorischen Stellen übermitteln, errechnet er ständig das aktuelle Gefahrenpotential innerhalb einer Bank.«
»Klingt interessant.«
»Der Meinung ist das Hauptquartier in Washington auch«, sagte Mr McKee.
»Und natürlich die Banken«, fügte Ruther hinzu. »Die >Transatlantic Traffic Bank< ist nicht die einzige Firma, der dieser Amann sein Programm angeboten hat.«
»Die haben uns auch alarmiert.« Mr McKee faltete seine schmalen Künstlerhände und stützte die Ellenbogen auf den Konferenztisch auf. »Ich glaube, ich habe es schon angedeutet, Jesse. So ein Programm - vorausgesetzt, es ist wirklich so vielversprechend, wie es das schriftliche Angebot dieses Amanns erscheinen lässt -, so ein Programm darf auf keinen Fall in die falschen Hände geraten.«
Allmählich nahm die Sache Konturen für mich an. Ein wirksames Sicherheitssystem gegen Banküberfälle war natürlich eine Sache, die uns zu interessieren hatte. Die >Transatlantic Traffic Bank< hatte uns zur Begutachtung der Software eingeladen. Klar - die Banken waren auf eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei erpicht.
Hinzu kam: Ein Sicherheitssystem in den Händen von Leuten, die es aus >beruflichen< Gründen überwinden wollten, war nicht mehr viel wert. Und wenn ich Ruther und Mr McKee richtig verstanden hatte, lief der junge Österreicher mit seiner Software in Manhattan herum und bot sie an jeder Straßenecke feil.
Offenbar hockte der Bursche nur noch vor Monitoren und hatte den Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Gut möglich, dass schon irgendeiner unserer hochkarätigen Kunden in der Unterwelt ein Auge auf den Informatiker geworfen hatte.
»Mein Auftrag ist es also, den Mann zu schützen.«
»Sie sind ein Schnellmerker, Jesse - Kompliment.« Norman reichte mir ein weiteres Papier. »Hier die Adresse seines Hotels. Versuchen Sie, in seiner Nähe zu bleiben.«
»Verdeckt oder offen?«
»Das bleibt Ihnen überlassen, Jesse.« Norman schob seine Unterlagen zusammen. »Vielleicht wäre es nicht schlecht, Sie würden sich ihm zu erkennen geben. Am Mittwoch, wenn er sein Programm in der >Transatlantic Traffic Bank< präsentiert, werden Sie ihn sowieso kennen lernen.«
»Ach ...«
Mein Chef nickte bestätigend. »Ich möchte, dass Sie sich das Programm zusammen mit Norman und einem Spezialisten aus Washington ansehen.«
»Okay, warum nicht.« Ich trank meinen Kaffee aus und stand auf. »Wo steckt eigentlich mein Partner?«
»Milo ist mit Clive und Orry in der Bronx«, erzählte Mr McKee. »Wir sind dort einer Gruppe militanter Fundamentalisten auf die Schliche gekommen. Der Einsatz wird wohl noch die ganze Nacht dauern.«
Es wurde also nichts aus dem erhofften gemeinsamen Kneipenbesuch mit meinem Partner. Trotzdem fuhr ich von der Federal Plaza direkt zu unserer Stammpizzeria in der Spring Street. Nach fast einer Woche Einsamkeit brauchte ich ein paar vertraute Gesichter um mich.
Luigi, der Ober des >Mezzogiorno< begrüßte mich wie einen alten Freund. Ich bestellte Tortellini mit Pesto und Knoblauch und einen trockenen Rotwein. Am ersten Arbeitstag sollte man sich etwas Gutes tun.
Während ich auf das Essen wartete, schaute ich mir noch einmal die Papiere an, die Norman Ruther mir überlassen hatte. Das Hotel, in dem der Österreicher abgestiegen war, kannte ich - >Iroquois<. Ein Billigschuppen mit weit über hundert Zimmern. Mein Computerfreak schien seine besten Geschäfte noch vor sich zu haben.
Das Hotel lag im Theatre District, irgendwo in der fünfundvierzigsten Straße, wenn ich mich recht erinnerte. Ich nahm mir vor, nach dem Essen direkt dorthin zu fahren.
»Ist schlimm«, sagte Luigi, während er mir den Wein servierte.
»Was?«, fragte ich.
Mit einer Kopfbewegung deutete er auf den Fernsehapparat neben der Eingangstür. Die Sechs-Uhr-Abendnachrichten sendeten Bilder aus der Dominikanischen Republik: Palmen, die sich fast bis zur Erde bogen, dichte Staubwolken gespickt mit Ziegeln, Holzstücken und Müll, durch die Luft wirbelnde Autos - der Hurrikan George hatte die Insel erreicht.
Die Menschen seien auf der Flucht vor dem Sturm, sagte der Nachrichtensprecher. Ich fragte mich, wohin man vor einem Hurrikan fliehen kann, wenn man auf einer Insel lebt …
*
Mit angelegten Flügeln stürzte die Möwe fast senkrecht in das gischtige Wellenspiel. Für Bruchteile von Sekunden verschwand sie aus dem runden, durch zwei Kreise und ein Kreuz in acht Segmente aufgeteilten Bild. Für Bruchteile von Sekunden nur noch die hin und her schwappenden Wellen des Atlantik und der graublaue Abendhimmel.
Dann tauchte der Vogel wieder aus dem Wasser auf. Flügelschlagend riss er sich von der Gischt los und stemmte sich in die Luft. Ein schwerer Fisch zappelte in seinen Fängen.
Höher und höher schraubte sich die Möwe - und blieb dennoch im Mittelpunkt des kreisrunden Bildes. Fast unbeweglich ruhte der Schnittpunkt der sich überkreuzenden Linien auf dem grauweißen Vogelkörper.
Und dann erzitterte das Bild - der kraftvolle Steigflug der Möwe brach jäh ab. Federn stoben auseinander, der Vogelkörper wurde aus der Flugbahn geschleudert und trudelte schlaff den Wellen entgegen. Der Fisch stürzte zurück ins Wasser und war gerettet.
Der Mann nahm das Zielfernrohr erst vom Auge, als die zerschossene Möwe auf dem Meer aufklatschte. Sein Unterkiefer schob sich nach vorn, die Unterlippe schob sich ein wenig über die kurze, wulstige Oberlippe, und seine dunklen Augen verengten sich zu Schlitzen. Mit viel gutem Willen hätte man diese Verzerrung des knochigen braunen Gesichtes als zufriedenes Grinsen deuten können.
Rosario de Serenas nahm das Gewehr von der Schulter und stemmte den schwarzen Leichtmetallschaft auf seinen rechten Oberschenkel. Das Boot, in dem er kniete, schwankte leicht.
De Serenas liebte diese Körperhaltung - das rechte Knie am Boden, das linke Bein angewinkelt vor sich, den Rücken kerzengerade und dann die erregenden Formen des Gewehres in den Händen.
Bei den Rebellen von Costa Rica hatte er das gelernt. Damals, vor vierzehn Jahren, als halbwüchsiger Guerillero. Der Commandante hatte ihn grinsend angesehen, wenn er mal wieder Freiwillige für eine Exekution suchte. Der dürre, für einen indianischen Mischling relativ hoch gewachsene Junge hatte sich immer als Erster gemeldet.
De Serenas setzte sich auf das Querholz in der Mitte des Bootes und begann, seine Waffe zu zerlegen. Er wickelte die drei Einzelteile in den weichen Stoff eines alten Baumwollhemdes und verstaute sie in einer schmalen dunkelgrünen Kunstlederhülle, wie man sie zum Transport von Teleskop-Angelruten verwendet.
Danach wandte sich der knochige, ausgemergelt wirkende Mann zum Heck seines Bootes und warf den Außenbordmotor an. Die Maschine knatterte los, der Bug des Schiffes hob sich, de Serenas steuerte die eine knappe Meile entfernte Küste an.
Eine leichte Abendbrise blies sein graues Shirt auf.
Der Stoff seiner weiten, dunklen Leinenhose flatterte um seine Beine.
Seit nicht ganz einer Woche hielt er sich in New York City auf und wartete auf den Anruf, der die heiße Phase seines Auftrages einleiten würde.
Seitdem war er nicht untätig geblieben. De Serenas hatte das Objekt observiert und mit einem Peilsender versehen. Und fast täglich war er abends hinaus nach Babylon gefahren. Vom Fischerhafen der Kleinstadt am südlichen Küstenstreifen Long Islands aus war er wie viele Freizeitangler hinaus auf den Atlantik gefahren. Allerdings nicht, um seine Tiefkühltruhe aufzufüllen. Etwa dreißig Möwen hatten im Fadenkreuz de Serenas ihren letzten Flügelschlag getan. Auch ein Spezialist blieb nur durch hartnäckige Übung ein Spezialist.
Eine halbe Stunde später steuerte er seinen Mietwagen - einen schwarzen Golf - Richtung Westen zurück nach New York City. Die Metropole lag etwa fünfzehn Meilen von Babylon entfernt. Das Handy hatte er neben sich auf den Beifahrersitz gelegt. Es konnte nur noch Stunden dauern, bis der entscheidende Anruf einging. Vorausgesetzt, sein Auftraggeber hielt sich an die Vereinbarungen. Aber daran zweifelte de Serenas nicht. Immerhin hatte er die erste Hälfte seines Honorars bereits kassiert. Und wer verschenkt schon zwölftausend Dollar.
Die ersten Vororte Brooklyns zogen an ihm vorbei. De Serenas ging vom Gas und schaltete herunter. Autos gehörten neben Dollars und Waffen zu den wenigen Dingen, für die sich der Fünfundzwanzigjährige begeistern konnte. Der PS-starke Golf hatte es ihm angetan.
Bilder aus der Zeit, in der er noch nicht einmal wusste, wie man einen solchen Wagen startete, schwirrten durch seinen Kopf. Aus der Zeit, in der er im lateinamerikanischen Urwald lebte, Konvois der Regierungstruppen angriff, Dörfer überfiel und Waffendepots ausraubte.
Wehmut erfüllte ihn jedes Mal, wenn er an diese Zeit dachte. Die Rebellen hatten den elternlosen Jungen aus einem Erdloch gezogen, in dem er sich vor massakrierenden Regierungssoldaten versteckt hatte. Sie waren seine Familie geworden. Kämpfen, schießen, töten - sein Leben.
Aber die Revolution war ausgeblieben, und die Flucht vor den Regierungstruppen hatte ihn in die Staaten verschlagen. In Los Angeles hatte ihn ein Zuhälter entdeckt, dem die Konkurrenz über den Kopf gewachsen war. Genug Arbeit für einen Neunzehnjährigen, der gut schießen konnte. Und der nicht die geringsten Hemmungen hatte, jemanden zu töten.
Inzwischen war er in vielen amerikanischen Großstädten bekannt - San Francisco, Houston, New Orleans, St. Louis, Washington, Detroit, Cleveland: Wer einen Mann von der Bildfläche verschwinden lassen wollte und dazu einen Spezialisten von außen brauchte, musste nicht lange herumfragen, bis man ihm eine Connection zum >Jaguar< anbot. So nannten sie ihn.
Rosario de Serenas fuhr über die Williamsburg Bridge in die Lower Eastside hinein. Hinter dem Hamilton Fish Park, in der Attorney Street, hielt er vor einem mexikanischen Restaurant.
Die Dämmerung begann bereits das Tageslicht aus dem Big Apple zu vertreiben. Trotzdem hatten sich ein paar Leute an die Tische auf dem Bürgersteig gesetzt. Einer der letzten milden Abende des Jahres.
De Serenas setzte sich an einen freien Tisch. Von hier aus konnte er den Golf im Auge behalten. Immerhin lag seine Existenzgrundlage im Kofferraum.
Er bestellte eine Flasche Wasser, Maisfladen und ein Steak.
Weil es mit der Zeit kühler wurde, ging er zum Auto zurück, um seine Lederjacke zu holen. Er zog sie über und wandte sich wieder den Tischen auf dem Bürgersteig zu. Um einen scharten sich sieben, acht Leute. Männer, Frauen, sogar zwei Kinder sah de Serenas. Sie beugten ihre Köpfe über den Tisch und tuschelten miteinander.
So vorsichtig sich de Serenas zu bewegen pflegte, so neugierig war er auch. Er näherte sich der ständig größer werdenden Menschentraube um den kleinen runden Tisch.
»Fünf Dollar«, hörte er eine Stimme krächzen. Dann das Klimpern einiger Münzen auf dem Metall der Tischplatte.
De Serenas drängte sich durch zwei schwarzhäutige Burschen, von denen jeder um einen Kopf größer war als er. Sie schielten unwillig auf den drahtigen Mann mit den pomadig zurückgekämmten, nackenlangen Haaren herab. Irgendetwas an ihm veranlasste sie, die Flüche hinunterzuschlucken, die sie schon auf der Zunge gehabt hatten. Sie vermieden sogar jede Berührung mit ihm.
Die einzige Person, die an dem Tisch saß - eine alte Frau: nachlässig geflochtener grauer Zopf, lehmfarbenes, zerfurchtes Gesicht, bunt bestickte, wattierte Jacke und hellblauer Rock aus grobem Stoff. Eine Indianerin. Zwischen ihren dünnen Lippen eine Meerschaumpfeife. Vom Stamm der Sioux? Oder eine Apachin? De Serenas konnte es nicht sagen. Jedenfalls eine Indianerin. Mit flinken Fingern breitete sie Karten vor sich aus. Direkt vor ihr stützte sich ein etwa elfjähriger Junge auf den Tisch und fixierte die länger werdende Reihe der Karten. Die anderen Zuschauer beugten sich von allen Seiten über Tisch und Schultern der Alten, reckten die Hälse und rissen Münder und Augen auf. Nur de Serenas schien von einem unsichtbaren Schutzschirm umgeben zu sein: Nicht einmal die Schuhspitzen der anderen berührten ihn.
Das leise Gemurmel der Leute verstummte, als die Indianerin von den rätselhaften Bildern ihrer Karten aufblickte und den Jungen vor sich anschaute. »Eltern geschieden?«, krächzte sie.