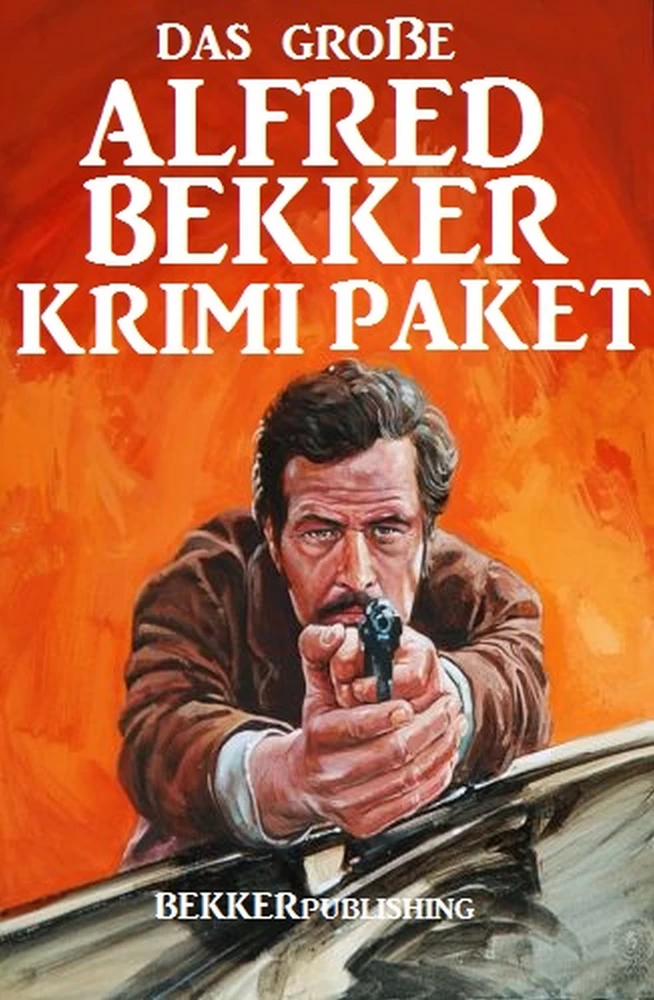Zusammenfassung
von Alfred Bekker
Der Umfang dieses Buchs entspricht 931 Taschenbuchseiten.
Dieses Buch enthält 6 Romane und 42 Kurzgeschichten:
Eis in den Bergen
Tod in Tanger
Abendessen mit Konversation
Ein Profi gibt nicht auf
Das linke Bein
Zum Dessert: Ein Mord!
Tödliche Tropfen
Der Kopf-Abhacker
Ungebetene Gäste
Die Konkurrenten
Der einzige Mordzeuge
Kalt wie Eis
Unter Mordverdacht
Die Tote am Strand
Eine böse Überraschung
Saras Flucht
Der Verräter
Millys erster Mord
Ein Freund des Inspektors
Der Killer in den Bergen
Mörder mit Hut
Der Name des Mörders
Eine Kugel für den Kurier
Die Frau, die zuviel wusste
Sie fanden eine Leiche
Der Hollywood-Killer
Der Mörder irrte
Todesfahrt
Der Leibwächter
Der Fall Rosener
Irischer Mord
Eine Leiche im Kofferraum
Tod im See
Tot und teuer
Den Tod vor Augen
Der Klinik-Mörder
Blumen auf das Grab
Tuch und Tod
Dunkler Reiter
Krähen
Ahnengeister
Der Satansbraten
Ein Mann für besondere Aufträge
Kein Grund zum Feiern!
Der perfekte Coup
Der Juwelen-Coup
In der Falle
Robbies Coup
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Das große Alfred Bekker Krimi-Paket
von Alfred Bekker
Der Umfang dieses Buchs entspricht 931 Taschenbuchseiten.
Dieses Buch enthält 6 Romane und 42 Kurzgeschichten:
Eis in den Bergen
Tod in Tanger
Abendessen mit Konversation
Ein Profi gibt nicht auf
Das linke Bein
Zum Dessert: Ein Mord!
Tödliche Tropfen
Der Kopf-Abhacker
Ungebetene Gäste
Die Konkurrenten
Der einzige Mordzeuge
Kalt wie Eis
Unter Mordverdacht
Die Tote am Strand
Eine böse Überraschung
Saras Flucht
Der Verräter
Millys erster Mord
Ein Freund des Inspektors
Der Killer in den Bergen
Mörder mit Hut
Der Name des Mörders
Eine Kugel für den Kurier
Die Frau, die zuviel wusste
Sie fanden eine Leiche
Der Hollywood-Killer
Der Mörder irrte
Todesfahrt
Der Leibwächter
Der Fall Rosener
Irischer Mord
Eine Leiche im Kofferraum
Tod im See
Tot und teuer
Den Tod vor Augen
Der Klinik-Mörder
Blumen auf das Grab
Tuch und Tod
Dunkler Reiter
Krähen
Ahnengeister
Der Satansbraten
Ein Mann für besondere Aufträge
Kein Grund zum Feiern!
Der perfekte Coup
Der Juwelen-Coup
In der Falle
Robbies Coup
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author /Cover: Firuz Askin
© dieser Ausgabe 2015 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Eis in den Bergen
Eine Villa in der Münchener Rauheckstraße, ein Ferienhaus mit Aussicht auf einen idyllischen Bergsee, nur eine halbe Stunde von der Großstadt entfernt... Dr. Anton F. Seidl fand, dass er es in den letzten Jahren zu einigem Wohlstand gebracht hatte. Und das, obwohl er keinesfalls Schönheitschirurg oder Zahnarzt war - sondern Tiermediziner. Und die standen normalerweise vom Einkommen her an unterster Stelle der medizinischen Zunft, es sei denn, sie hatten sich auf das Kurieren kleinerer Wehwehchen von millionenschweren Rennpferden spezialisiert. Aber zu diesen Kreisen hatten Seidl die Beziehungen gefehlt.
Er atmete tief durch, blickte über den mustergültig gepflegten Garten seiner Villa.
Hier war kein Grashalm an der falschen Stelle. Ein Gärtner kam regelmäßig dreimal die Woche, um alles in Ordnung zu halten und darüber hinaus die zahlreichen und häufig wechselnden gärtnerischen Sonderwünsche von Frau Seidl zu erfüllen.
Alles, was du hier siehst, wird dir vielleicht schon bald buchstäblich unter den Fingern zerrinnen!, ging es Seidl grimmig durch den Kopf. Der Puls schlug ihm bis zum Hals. Nein, du hast einfach zu lange dafür gekämpft, um jetzt aufzugeben! Jetzt musst du dir etwas überlegen, dich vielleicht sogar mit sehr harten Bandagen durchzukämpfen.
Seidl zuckte zusammen, als ihn von hinten eine Hand an der Schulter berührte.
"Was ist?", drang die Stimme seiner zweiten Ehefrau Veronika in sein Bewusstsein.
Seidl drehte sich ruckartig zu ihr herum. Sie war Anfang dreißig, er Anfang fünfzig. Ihr Gesicht war feingeschnitten mit hohen Wangenknochen. Das dunkle Haar fiel ihr bis weit über die Schultern. Zwei feste Brüste pressten sich gegen den enganliegenden Stoff ihres Pullovers. Manchmal musste er aufpassen, um sie nicht mit 'Franziska' anzureden - dem Namen seiner ersten Frau. Im Grunde war Veronika eine Art verjüngte Ausgabe seiner ersten Frau.
"Es ist nichts", behauptete Seidl.
"Du schwitzt ja!"
"Ja, mein Gott..."
"Mei, du siehst ja ganz blass aus!"
Eine der wenigen Dinge, die Seidl an seiner zweiten Frau störten war, dass sie unentwegt "mei" zu sagen pflegte. Während er selbst sich den niederbayrischen Dialekt, mit dem er aufgewachsen war, mühsam abgewöhnt hatte und spätestens seit seinem Studium in Hamburg nur noch 'nach der Schrift' redete, konnte Veronika ihre sprachliche Herkunft einfach nicht verleugnen.
"Mei, warum sagst denn nix? Hängt das vielleicht mit dem Reporter zusammen, der vorhin hier war?"
Seidl lächelte breit. "Das war nur ein Wichtigtuer!", meinte er. "Der ist nur auf Skandale aus."
"Skandale? Mei, was will er denn dann von dir?"
"Ach, du kennst das doch. Da ist irgendwo mal wieder hormonverseuchtes Fleisch aufgetaucht und jetzt wollte dieser Kerl meine Meinung dazu wissen."
"Das war alles?"
"Ja, verdammt nochmal."
"Geh, Anton! Nun hab dich doch net so! Man wird ja wohl mal nachfragen dürfen."
Seidl atmete tief durch. "Mir geht es heute nicht besonders gut. Muss wohl am Fön liegen. Ich glaube, ich lege mich ein bisschen hin. Nachher habe ich nämlich noch einen wichtigen Termin..."
"Wollten wir heut' Abend net in die Oper?"
"Ja schon, aber..."
"Das wird also nix!"
"Nicht traurig sein. Geh ruhig allein hin oder nimm deine Freundin Karin mit, damit die Karte nicht verfällt!"
Seidl ging an ihr vorbei, trat dann durch die Terrassentür ins Haus.
In seinem Hirn arbeitete es fieberhaft.
Ich lasse mir meine Existenz nicht zerstören!, hämmerte es in ihm. Um keinen Preis...
*
Zwei Stunden später wählte Seidl vom Anschluss im Schlafzimmer aus eine Handynummer, die er von einer Visitenkarte ablas.
Es war die Karte des Journalisten.
"Hier Tom Dremmler", meldete sich eine sonore Stimme.
Tom Dremmler, freier Mitarbeiter verschiedener Boulevardblätter und neuerdings Erpresser, so ging es Seidl zynisch durch den Kopf. Aber in dem Job bist du ein Anfänger, Dremmler! Also sieh dich vor!
"Ich bin's, Dr. Seidl", meldete sich der Veterinär.
"Sie haben sich die Sache also überlegt!", stellte Dremmler fest. Er lachte heiser. Seine Stimme war rau vom übermäßigen Alkoholgenuss. Auf den Parties, die er besuchte, nahm er beinahe jedes volle Glas mit, das ihm hingehalten wurde. Seine Leberwerte mussten entsprechend sein. Und die Zahl der abgestorbenen Hirnzellen hatte mit Sicherheit jenen Wert überschritten, der ihn noch hätte hoffen lassen können, dass aus ihm eines Tages doch noch ein seriöser Feuilletonist wurde.
"Hören Sie, Dremmler..."
"Ich will eine Million! Darüber lasse ich auch nicht mit mir handeln. Andernfalls können Sie auf den Titelseiten Ihren Namen und Ihr Bild sehen. Vielleicht mit folgender Überschrift: DER HORMON-DOKTOR ENTLARVT! NEUER SKANDAL IN DER SCHWEINEMAST!"
"Woher soll ich eine Million nehmen?"
"Beleihen Sie Ihre Villa oder verkaufen Sie Ihr Ferienhaus in den Bergen..."
"Sie sind gut informiert."
"Vergessen Sie das nie, Dr. Seidl. Vergessen Sie das nie...."
"Angenommen ich zahle Ihnen eine Million. Wer garantiert mir, dass Sie nicht weitere Forderungen stellen."
"Was haben Sie nur für eine schlechte Meinung von mir."
"Ja wohl nicht ganz unbegründet, oder?"
"Seidl, Sie können von Glück sagen, wenn Sie aus dieser Sache mit einigermaßen heiler Haut herauskommen. Jahrelang sind Sie von Bauernhof zu Bauernhof gereist und haben Ihre illegalen Medikamentencocktails verkauft. Eine Art Dealer für Junkie-Schweine..." Er kicherte. "Ich kann alles belegen. Ich habe Unterlagen, Fotos, Proben..."
"Ich muss dieses Beweismaterial haben, wenn ich Ihnen eine derart große Summe zahle."
"Dann legen Sie noch eine halbe Million drauf und wir sind handelseinig."
"Sie sind unverschämt."
"Ich kann rechnen, Dr. Seidl. Sie haben mit Ihren Wundermitteln in den letzten Jahren ein Mehrfaches davon eingenommen. Alles, was ich verlange ist ein gerechter Anteil."
Innerlich kochte Seidl.
Alles in ihm krampfte sich zusammen. Er bemerkte, dass seine Hand zu zittern begann. Wenn er jetzt vor mir stünde!, durchzuckte es ihn. Er hätte dann für nichts garantieren können... Durch regelmäßiges Atmen versuchte er, sich wieder zu beruhigen.
Er musste einen kühlen Kopf bewahren.
Eiskalt reagieren.
Nur dann hatte er eine Chance, den Hals aus der Schlinge zu ziehen.
"Ich bin mit Ihren Bedingungen einverstanden", brachte er schließlich über die Lippen.
"Freut mich, das zu hören."
"Aber Sie dürfen mich nie wieder in meiner Villa an der Rauheckstraße besuchen! Haben Sie gehört?"
"Sorry, Doc." Tom Dremmler lachte heiser, hustete dann. Vermutlich Raucherhusten, diagnostizierte Seidl.
"Wir müssen uns treffen. Sie bringen die Beweismittel mit und ich..."
"Die anderthalb Millionen", schnitt Dremmler ihm das Wort ab.
"In bar, nehme ich an."
"Wäre mir lieb."
"Samstag in einer Woche. Vorher kriege ich das mit meiner Bank nicht zurecht."
"Gut. Aber keinen Tag länger."
"Nun zum Treffpunkt. Mein Ferienhaus in Kayserstein kennen Sie ja bereits."
"Ja."
"Kommen Sie nächsten Samstag gegen 17.00 Uhr dort hin. Dort sind wir ungestört."
"Einverstanden."
*
Dr. Anton Seidl fuhr die schmale, in Serpentinen den Berghang hinaufführende Straße mit geradezu halsbrecherischem Tempo entlang. Es war Samstag Mittag. Veronika hatte etwas herumgemeckert, als er ihr offenbart hatte, dass er das Wochenende im Ferienhaus verbringen wollte. Schließlich war er sogar das Risiko eingegangen, ihr anzubieten, ihn doch zu begleiten. Das hatte sie während ihrer bislang vierjährigen Ehe nur ein einziges Mal getan und sich dabei schrecklich gelangweilt. Bergwandern und die stundenlange Angelei im nahegelegenen See - das war alles nicht ihr Fall. Ihrer dialektbeladenen, sich eher erdverbunden anhörenden Sprache zum Trotz war sie doch ganz eindeutig eine Stadtpflanze und kein Landei.
Aber Anton Seidl brauchte ab und zu diese Einsamkeit und Ruhe hier oben.
Er erinnerte sich noch ganz genau, wie er das Haus zum ersten Mal gesehen hatte. Er war auf dem Weg zu einem Kunden gewesen, dessen Viehbestand er mit einem Koffer voller wachstumsfördernder Mittel versorgt hatte. Für viele der Bergbauern war die Situation prekär. Mit den großen Agrarfabriken andernorts konnten sie nicht mithalten, weder im Preis noch in der Menge. So mussten die Tiere eben schneller wachsen und dabei immer noch nach Möglichkeit den Eindruck machen, als ob sie unter glücklichen Umständen ihr kurzes leben gefristet hatten. Verluste waren tabu. Es wurde gespritzt, was das Zeug hielt, beziehungsweise der Koffer des Hormon-Dealers hergab.
Von einem seiner Kunden, dem Wendinger-Klaus, dem einer der größten Höfe in der Umgebung gehörte, hatte Seidl seinerzeit den Tipp bekommen, sich das Haus mal anzusehen. Es hatte kurz vor der Zwangsversteigerung gestanden. Den Preis, den Seidl dafür hatte ausgeben müssen, war geradezu lächerlich, wenn man bedachte, dass die Gegend touristisch gut erschlossen war.
Seidl hing seinen Gedanken nach, blickte zwischendurch immer wieder nervös auf die Uhr.
Er hatte einen Plan.
Einen Plan, der mit Tom Dremmlers Tod enden würde. Aber bevor er das Ferienhaus erreichte, gab es noch einiges, was Seidl vorzubereiten hatte.
Plötzlich musste Seidl mit aller Gewalt in die Bremse seines champagnerfarbenen Mercedes SLK treten. Die Reifen quietschten. Von der Seite ergoss sich ein Strom von hunderten von Schafleibern auf die Fahrbahn. Sie blökten durcheinander. Einige wichen vor dem SLK erschrocken zurück und stießen dabei ihre Artgenossen um. Ein Chaos entstand. Mittendrin, wie ein Fels in der Brandung stand der Schäfer mit hochrotem Kopf und wütendem Gesicht.
Er nahm seinen Filzhut ab, knitterte ihn in der Faust zusammen und brüllte Seidl wütend an. Da der Tierarzt das Verdeck seines SLK auf Grund des sonnigen Frühlingswetters zurückgeklappt hatte, konnte er jedes Wort verstehen. Und das, obwohl ein Hirtenhund andauernd dazwischen bellte.
"Mei, was fällt Ihnen ein! Kruzifix noch einmal! Wie kann einer nur so narrisch sein und net aufpassen, was über die Straße herüberkommt!"
"Hätten Sie nicht aufpassen können!", rief Seidl zurück.
Er kannte den Hirten.
Corbinian Anzengruber hieß er und war in der gesamten Gegend als eine Art Faktotum bekannt. Allerdings auch als Verbreiter von Neuigkeiten und Gerüchten.
Das hat mir gerade noch gefehlt, dass mir der über den Weg läuft!, ging es Seidl ärgerlich durch den Kopf. Dieser Quasselkopf würde überall herumerzählen, dass der allseits bekannte Tierarzt mal wieder in der Gegend war und das Wochenende in seinem Ferienhaus verbrachte.
Einige Sekunden lang dachte Seidl darüber nach, ob er das ganze Unternehmen nicht abblasen sollte.
Er dachte an die Polizei, an die Fragen, die sich zwangsläufig ergeben, wenn...
Nein, du stehst das jetzt durch!, forderte er sich dann selbst auf. So etwas wie absolute Sicherheit gibt es nicht, Anton Seidl! Auch für dich nicht! Du musst das Risiko eingehen, wenn du nicht sehenden Auges in den Abgrund springen willst!
"Geht das nicht ein bisschen schneller?", schrie Seidl dem Hirten dann entgegen.
Dann hupte er, worauf die Schafe aufgeregt blökten und der Hirtenhund sich in seiner bis dahin unumstrittenen Autorität bedroht fühlte.
"Ja, ist dieser großkopferte Herr Veterinär jetzt vielleicht vollkommen narrisch geworden?", brüllte der Anzengruber jetzt zurück. "Macht mir die Tiere auch noch verrückt!"
"Ich hab's eilig!"
"Mei, das dauert halt ein bisserl!"
Fast eine Viertelstunde dauerte es, bis alle Tiere endlich über die Straße gelangt waren.
Seidl ließ den Motor des SLK aufheulen und brauste davon. Wenig später erreichte er das schmucke Holzblockhaus. Er parkte den SLK und stieg aus.
Tief sog er die klare Bergluft in sich auf. Man hatte eine fantastische Aussicht von hier aus. Reste des Morgennebels hingen noch über dem leuchtend blauen See, auf den man von hier aus eine vollkommen freie Sicht hatte.
Ein Ort wie aus dem Paradies, dachte Seidl. Aus meinem Paradies. Und davon wird mir niemand etwas wegnehmen.
Er sah kurz auf die Uhr (er wusste selbst nicht mehr, zum wievielten Mal an diesem Tag schon) und griff dann zum Handy.
*
"Wo soll ich das Zeug hinbringen?", fragte der Eismann, der seinen Lieferwagen etwa eine Stunde später vor Seidls Ferienhaus geparkt hatte. Er wollte sich schon mit einer Eisstange in der Hand an Seidl vorbei zum Haus hinbewegen, aber Seidl schüttelte den Kopf.
Im Haus konnte er das Eis nicht gebrauchen.
"Dort hinein!", forderte er und deutete dabei auf den Kofferraum seines SLK.
Der Eismann sah ihn ziemlich verdutzt an.
"Ist das Ihr Ernst?"
"Mein voller!"
Zur Bekräftigung öffnete Seidl den Kofferraum. Der Eismann kam herbei und lud die Stange dort ab. Er wischte sich anschließend mit dem Ärmel über die Stirn. "Die anderen auch in den Kofferraum?", vergewisserte er sich.
Seidl nickte kühl.
"Ja."
Insgesamt drei, dicke, quaderförmige Stangen Eis brachte der Eismann dann noch in den Kofferraum des SLK.
"Sie werden sich den Wagen damit verderben", prophezeite der Eismann.
"Das lassen Sie mal meine Sorge sein", erwiderte Seidl kühl.
Der Eismann hob beschwichtigend die Hände. "Ist ja schon gut, ich wollte Ihnen wirklich net reinreden, Herr Doktor..."
"Dann lassen Sie es bitte auch!"
"Mei, muss man denn da gleich so grantelig werden? Ich hab's ja nur gut gemeint."
Seidl schloss den Kofferraum und bezahlte dann. Der Eismann blickte nachdenklich auf den SLK. "Sie haben 'ne Riesenparty vor sich, was?"
Seidls Lächeln war dünn. Sein Mund wirkte in diesem Moment fast wie ein Strich. "Ja, so könnte man es bezeichnen..."
"Warum haben Sie keine Getränke bei uns bestellt? Sie hätten dann Rabatt gekriegt."
"Auf Wiedersehen."
Augenblicke später fuhr der Eismann davon. Seidl sah dem Lieferwagen nach, bis er so weit die Serpentinen hinuntergefahren war, dass man ihn vorübergehend nicht mehr sehen konnte. Später, das wusste Seidl, würde er wieder auftauchen und man konnte seinen Weg dann noch eine ganze Weile beobachten.
Seidl griff zum Handy.
Er wählte die Nummer von Tom Dremmler.
"Hier ist Seidl."
"Nanu, wir waren doch erst später verabredet", wunderte sich der Journalist.
"Ich weiß. Aber es hat sich einiges geändert. Wir müssen den Termin etwas vorverlegen. Und der Treffpunkt ist auch nicht mehr derselbe."
"Wenn Sie glauben, Sie können mit mir irgendwelche Tricks versuchen, dann..."
"Das würde ich mir nie erlauben!", versuchte Seidl den Erpresser zu beschwichtigen.
"Sie wissen, was dann passiert."
"Natürlich."
"Also?"
"Sie fahren nicht erst heute Abend um fünf zu mir in die Berge, sondern jetzt. Kurz vor Kayserstein befindet sich ein Parkplatz mit hervorragender Aussicht. Liegt etwas abseits. Aber wenn Sie nach dem Hinweisschild 'Kayserstein 7 Kilometer' die nächste links nehmen, kommen Sie direkt dort hin."
"Gibt es kein Hinweisschild?"
"Nein."
"Ich glaube nicht, dass ich schonmal dort war."
"Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Weg haben, rufen Sie meine Handynummer an. Fragen Sie auf keinen Fall irgend jemanden. Ich bin in der Gegend bekannt wie ein bunter Hund."
Dremmler lachte.
"Ich weiß."
"Kommen Sie zum Treffpunkt. Ich werde Ihnen die anderthalb Millionen übergeben, sofern Sie das belastende Material bei sich haben. Aber beeilen Sie sich!"
"Gut", kam es nach einigem Zögern von der anderen Seite der Leitung.
Seidl triumphierte innerlich.
*
Anton Seidl war als erster auf dem Parkplatz. Er sah ungeduldig auf die Uhr. Das Eis machte ihm sorgen. Wenn Dremmler zu spät kam, wäre es geschmolzen. Aber das Eis spielte in dem Mordplan, den er sich zurechtgelegt hatte, eine entscheidende Rolle. Es gibt keinen anderen Weg, sagte er zu sich selbst. Du hast es oft genug hin und her überlegt. Du oder er, das ist die Alternative. Nein, die Sache musste beendet werden. Ein für allemal. Seidl zog sich seine dünnen Lederhandschuhe an. Ein Motorengeräusch brauste auf. Das war Dremmler. Er parkte seinen roten Ford und stieg aus. Dremmler strich sich das etwas zu lange, fettig wirkende Haar zurück. Der Fotoapparat baumelte ihm am Hals. Er ging auf Seidl zu und kam gleich zur Sache. "Wo ist das Geld?", fragte Dremmler.
Seidl ging ein paar Schritte auf ihn zu. "Hören Sie, Dremmler...", begann er. Er hatte Dremmler fast erreicht, da erstarrte der Tierarzt mitten in der Bewegung. Er blickte abwärts in Höhe seines Bauches und bemerkte den blanken Lauf eines Kleinkaliber-Revolvers in Dremmlers rechter Hand. Der Reporter hatte die Waffe blitzschnell unter seiner Jacke hervorgezogen.
Offenbar war er misstrauisch geworden.
"Bleiben Sie, wo Sie sind", sagte der Reporter.
"Dremmler, was soll das? Wir wollten uns doch einigen!"
"Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, Herr Dr. Seidl!" erklärte er mit hochrotem Kopf, wobei er das 'Herr Dr. Seidl' eigenartig betonte. "Ich weiß, dass Sie mit allen Wassern gewaschen sind und Ihnen kein Trick zu schmutzig wäre..."
Seidl lächelte schwach. "Dremmler..."
"Keine Tricks! Ich will das Geld."
"Es ist im Wagen!"
"Dann holen wir es jetzt..." Dremmler bedeutete Seidl mit einem Handzeichen, sich umzudrehen. Mit Dremmlers Waffe im Rücken ging er dann vor dem Reporter her und fragte sich, was er tun konnte. Seidl hatte kein Geld für Dremmler und außerdem drohte sein ganzer Plan den Bach hinunter zu gehen. Seidl öffnete den Kofferraum seines Wagens. Dremmler stand hinter ihm und sah auf die Eisstangen.
"Was soll das?", murmelte er.
Jetzt oder nie!, dachte Seidl. Diesen Moment der Überraschung nutzte er und wirbelte herum. Der Handkantenschlag traf Dremmlers Kehle und ließ ihn augenblicklich in sich zusammensacken. Die Waffe hielt Dremmler fest umklammert, aber er kam nicht mehr dazu, sie abzudrücken. Seidl sah zufrieden auf den Reporter herab. Er war tot. Ein zynisches Lächeln umspielte Seidls Lippen. Einer wie er, der sich seit Jahren mit Karate fit hielt, brauchte keine Waffe. Zumindest nicht, wenn er nahe genug an seinen Gegner herankam.
Jetzt durfte er keine Zeit verlieren.
Er durchsuchte den Wagen, fand eine Tasche, in der sich Fotomaterial und andere Unterlagen befanden.
Seidl sah es kurz durch.
Dremmler muss mich geradezu beschattet haben, durchfuhr es ihn dabei.
In Zukunft musste er vorsichtiger sein, um etwas Ähnliches zu verhindern.
Seidl nahm das Material an sich, verstaute es im Handschuhfach seines SLK.
Und wenn der Hund noch mehr gesammelt und irgendwo anders deponiert hat?, überlegte er. Er musste davon ausgehen. Aber er würde deswegen nichts unternehmen. Mochte das Zeug irgendwo in Frieden auf einer Festplatte schlummern. Wenn Seidl anfing, danach zu suchen, würde er sich nur in Verdacht bringen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Strafverteidiger!, dachte Seidl.
Es gab jetzt kein Zurück mehr.
Und das Risiko, dass das doch etwas von dem belastenden Datenmaterial an die Oberfläche gespült wurde, war vertretbar.
Wenig später packte Seidl Dremmlers Leiche und trug sie zu dessen Wagen.
Dann setzte er den Toten ans Steuer. Nun schob er den Ford an den Rand des Parkplatzes. Dort ging ein Hang recht steil hinab. Seidl schob den Wagen so weit es ging dorthin und zog die Bremse. Anschließend holte Seidl aus seinem Wagen die erste Eisstange. Er legte sie so unter die Vorderräder von Dremmlers Sportwagen, dass das Eis wie ein Bremsklotz wirkte. Die beiden anderen Stangen platzierte er ähnlich. Dann löste er sehr vorsichtig die Handbremse und lächelte. Das Eis würde schmelzen und der Wagen in die Tiefe rasen. Etwas weiter unterhalb kam ein Plateau und dann ging die Felswand fast senkrecht in die Tiefe. Der Wagen würde vielleicht explodieren und wenn nicht, dann würde man die Verletzung an Dremmlers Kehle als Unfallfolge deuten. Schließlich konnte die Kehle auch durch das Lenkrad eingedrückt worden sein.
Wahrscheinlich konnte man in der Umgebung den Aufprall weithin hören.
Gut so, dachte Seidl.
Denn wenn es so weit war, würde er sich viele Kilometer entfernt befinden und dafür sorgen, dass sich genügend Zeugen an ihn erinnerten... Seidl stieg in den Wagen und brauste davon.
*
Seidl überlegte, was er tun sollte. Vielleicht war es das Beste, jetzt einfach nach Hause zu fahren. Nach München. Warum sich länger als unbedingt notwendig in der Gegend aufhalten, zumal er in seinem Ferienhaus kein richtiges Alibi hatte.
Er war innerlich stark aufgewühlt, überlegte hundertmal, ob er nicht irgendeinen Fehler gemacht, irgend etwas übersehen hatte.
Ganz ruhig bleiben!, forderte er sich selbst auf. Du kannst jetzt nichts weiter tun, als abwarten, dass es irgendwo einen lauten Knall gibt. Nichts wird in deine Richtung deuten. Fahr nach München. Veronika wird fragen, warum ich so früh zurückkehre, sie wird sich etwas wundern und ich werde irgendeine Ausrede erfinden. Es wäre das erste Mal, dass sie an irgend etwas zweifelt.
Seidl drehte leise das Radio an, während er mit - wie üblich überhöhter Geschwindigkeit - die schmale Bergstraße entlangbrauste.
Er blickte kurz in Richtung des Sees. Das Sonnenlicht spiegelte sich darin, ließ ihn leuchtend blau erscheinen. Dahinter die schneebedeckten Gipfel. Eine Postkartenkulisse.
Dann erreichte er die Tankstelle vom Krainacher. Eine kleine, freie Tankstelle, die sowohl von ihrer tatsächlichen Lage als auch von ihrer wirtschaftlichen Situation her nahe am Abgrund stand.
Die Tankanzeige zeigte an, dass der SLK eigentlich noch nicht wieder neuen Kraftstoff brauchte, aber Seidl kam der Gedanke, dass ein Besuch beim Krainacher eine gute Gelegenheit war, sich in Erinnerung zu bringen.
Für den Fall, dass es doch Ermittlungen gab, die ihn in den Kreis der Verdächtigen mit einbezogen.
Er fuhr vor die Zapfsäule, stieg aus, tankte den SLK bis oben hin voll.
Dann ging er zum Krainacher herein, der mit ölverschmierter Latzhose hinter der Kasse stand. Seidl nahm noch eine Zeitung, damit die Rechnung nicht so lächerlich gering blieb.
"Servus, Herr Doktor!", sagte der Krainacher. "Sie sind schon wieder auf dem Rückweg?"
Natürlich hatte der Krainacher mitbekommen, in welcher Fahrtrichtung Seidl unterwegs war. Schließlich bestand seine Hauptbeschäftigung darin, aus dem Tankstellenfenster auf die Straße zu blicken.
"Ja, ja", murmelte Seidl.
"Aber am Wetter kanns net liegen! Das ist doch heute ausgezeichnet für die Jahreszeit!"
"Ich brauche den Sonntag noch, um meine Steuersachen zu ordnen."
"Mei, da woaß i, wovon Sie red'n!", nickte der Krainacher mitfühlend. "Wenn Sie mich fragen, dann nimmt die Bürokratie auch wirklich überhand! Finden's net auch?"
"Sicher."
In diesem Moment fuhr ein Traktor vor eine der Zapfsäulen. Der Fahrer stieg ab, tankte nach.
Seidl verabschiedete sich vom Krainacher und ging hinaus.
Den Traktorfahrer kannte er. Es war der Bernrieder-Bauer.
"Servus! Gut, dass ich Sie treffe!", rief der Bernrieder und kam auf ihn zu. "Meine Mathilda steht kurz vom Kalben und ich hab das Gefühl, da stimmt was net..."
"Sie wissen, dass ich..."
"Ja, i woaß! Sie sind mehr für den medikamentösen Aspekt der Tiermedizin zuständig!" Seidl zuckte zusammen. Der Krainacher sprach das aus, als handelte sich um eine ganz normale Dienstleistung. Schon Jahrelang sorgte Seidl dafür, dass das Vieh des Krainachers etwas schneller wuchs, als die Natur das eigentlich vorgesehen hatte.
"Ich würde Sie net fragen, wenn der Huber da wär!"
'Der Huber', das war der hiesige Tierarzt. Ein Mann mit Prinzipien und ein Tierarzt im klassischen Sinn. Dafür aber auch ein vergleichsweise armer Hund!, ging es Seidl durch den Kopf.
"Ich sehe mir Ihre Mathilda an!", versprach Seidl.
Warum nicht?, überlegte er. Eigentlich müsste ich dem Krainacher dankbar sein - bietet er mir doch ein perfektes Alibi an.
*
Seidl blieb den ganzen Nachmittag auf dem Krainacher-Hof. Mit der Kuh Mathilda war alles in Ordnung - es waren die Nerven des Bauern, die blank lagen. Aber Seidl sorgte dafür, das sein Aufenthalt auf dem Hof sich etwas in die Länge zog.
Zwischendurch war in der Ferne ein lauter Knall zu hören. Dann, kurze Zeit später ein weiterer.
Seidl horchte auf.
Einige der Kühe wurden unruhig.
"Was war das denn?", fragte Seidl.
"Mei, das muss aus dem Nachbartal kommen. Da wird seit kurzem nämlich Basalt abgebaut! Wir haben alle dagegen protestiert und sogar beim Landrat vorgesprochen, aber da war nix zu machen!"
"Auch am Samstag?"
"Die holen sich einfach eine Sondergenehmigung!"
Seidl nickte verständnisvoll.
Hauptsache, er erinnert sich später noch an die Explosion, denn der Tierarzt war sicher, dass dieser Knall nichts mit dem Basaltabbau in der Nähe zu tun hatte.
Später saß Seidl noch bei einer Brotzeit in der guten Stube des Krainachers. Ich habe es geschafft!, dachte der Tierarzt. Das Alibi ist perfekt.
*
Es wurde spät und Seidl entschied sich dafür, doch nicht nach München zurückzukehren. Wozu auch? Ihm konnte nichts passieren, die gesamte Familie des Krainachers konnte bezeugen, dass er zu dem Zeitpunkt, da Dremmlers Ford in die Tiefe gestürzt war, sich auf dem Hof befunden hatte. Jetzt wollte er in der Nähe bleiben, um besser beobachten zu können, was sich tat...
Auf dem Rückweg zum Ferienhaus fror Seidl ganz erbärmlich, obwohl er sich den Mantel angezogen hatte.
Es war verflucht kalt geworden.
Schon während seines Auenthalts auf dem Krainacher Hof war ihm der eisige Wind aufgefallen, der plötzlich von den Bergen blies.
Er kehrte erst spät in sein Haus in den Bergen zurück und war ziemlich überrascht, als jemand vor der Haustür auf ihn wartete. "Ich bin Kriminalhauptkommissar Niedermayer ", sagte der etwas beleibte Mann und zeigte Seidl seine Marke. "Ich habe es schon einmal versucht, aber da waren Sie nicht zu Hause..."
"Kommen Sie herein", sagte Seidl und rieb sich die Hände. Es war ziemlich kalt geworden. "Was ist denn passiert?"
"Kennen Sie Herrn Tom Dremmler?"
"Warten Sie, ich mache die Heizung an..."
"Er ist hier in der Nähe ermordet worden."
"Ermordet?", fragte Seidl. Etwas musste schief gelaufen sein und er fragte sich verzweifelt, was es wohl war. Der Kommissar nickte. "Von Ihnen, Herr Seidl. Sie hatten einen genialen Plan. Eigentlich hätte man von dem Eis keinerlei Spuren finden dürfen und wir hätten dann auch niemals bei den Eislieferanten der Umgebung nachgefragt, wer sich heute vier große Stangen hat liefern lassen... Wir wären nie auf Sie gekommen, Herr Seidl, wenn Sie das Wetter hier in den Bergen in Ihre Überlegungen mit einbezogen hätten. Drastische Temperaturschwankungen sind hier nichts Ungewöhnliches und heute hat es so einen Temperatursturz gegeben. Das Eis ist noch immer nicht geschmolzen... Sie sind übrigens verhaftet!"
ENDE
Tod in Tanger
Die deutsche Studentin Elsa reist nach der für sie schmerzlichen elterlichen Scheidung nach Tanger, um Abstand zu gewinnen. Dort lernt sie den 38jährigen Robert kennen, einen attraktiven, indes einigermaßen undurchsichtigen Mann scheinbar dänischer Herkunft, in den sie sich verliebt und in dessen Villa sie bald darauf einzieht. Zunächst glaubt sie ihm bedingungslos und vertraut ihm etliches aus ihrer bedrückenden Vergangenheit an, doch als sie bemerkt, dass Robert Schminkutensilien benutzt und über mehrere Pässe verfügt, beginnt sie, sich über den Charakter von Roberts sogenannte Geschäften Gedanken zu machen. Wenig später begibt sich Robert auf eine seiner sogenannten Geschäftsreisen nach Spanien und Frankreich, und Elsa bleibt zusammen mit dem arabischen Hausdiener in der Villa zurück.
Es stellt sich heraus, dass Robert als professioneller Auftragsmörder tätig ist - eine unangenehme Entdeckung, die auch Elsa nicht erspart bleibt. Robert kann sie nun nicht mehr am Leben lassen...
1.
Das erste Mal traf Elsa mit Robert Jensen im Postamt von Tanger zusammen.
Alles in allem war es nur eine sehr kurze Begegnung. Robert hatte sie fast umgerannt und schien sehr in Eile zu sein.
„Pardon!“, zischte es zwischen seinen dünnen Lippen hindurch.
„Macht nichts“, erwiderte Elsa. Sie sagte das instinktiv und ohne viel nachzudenken auf Deutsch, obwohl sie ja eigentlich nicht so ohne weiteres davon ausgehen konnte, dass ihr Gegenüber sie auch verstand.
Dann wechselten sie einen kurzen Blick miteinander. Elsa sah in hellblaue Augen.
Der Mann war blond, und sein Haar lichtete sich an manchen Stellen bereits. Dennoch, sein Alter war schwer zu schätzen. Zwischen 25 und 40 schien alles möglich.
Aber da waren diese Augen, die einfach zu einem älteren Mann besser zu passen schienen.
Bei dem Zusammenprall war ihm der Pass heruntergefallen. Er bückte sich, um das Dokument wieder an sich zu nehmen; aber es gelang Elsa noch, einen Blick darauf zu werfen. Es war ein dänischer Pass, soviel konnte sie sehen.
Er nahm das Dokument und steckte es sofort in die Innentasche seines hellbraunen Sommerjacketts. Dann ging er an Elsa vorbei. Sie sah ihm nach, aber er drehte sich nicht zu ihr um, sondern wandte sich geradewegs zu einem der Schalter.
Dort hörte sie ihn in - soweit sie das beurteilen konnte - ziemlich fließendem Französisch reden. Sie verstand kaum etwas davon. Nur einzelne Wörter, die keinen Sinn ergaben. Das nächste Mal, dass sie ihm begegnete, war am darauffolgenden Abend.
Der Muezzin hatte sein Abendgebet bereits per Lautsprecher über die Stadt gerufen und es war dunkel. Vom Meer her stiegen Nebel auf. Es wurde feucht und auch ziemlich kalt.
Sie zog sich ihre dünne Jacke enger um die Schultern und schlug den Kragen etwas hoch, aber diese feuchte Kühle ging durch alles hindurch. Es schien kein Mittel dagegen zu geben.
Sie wusste, dass es kaum wärmer sein würde, wenn sie sich in ihrem Hotel in die Decke rollte. Die Heizung war außer Betrieb. Da stand noch ein Elektro-Heizkörper - aber das schwache Stromnetz im Haus hatte schon Mühe, einen Haarföhn zu verkraften.
Elsa ließ sich in dem abendlichen Tanger treiben und sah den Menschen zu, die durch die Straßen drängten.
Wenn man mit dem Schiff hierher kam, dann sah die Stadt von weitem fast wie ein Ameisenhaufen aus. Ein Ameisenhaufen, der an einem Hang klebte.
Und sie war jetzt mitten drin. Inzwischen wusste sie, dass sie die aggressiven Straßenhändler und angeblichen Fremdenführer nicht beachten durfte.
„Voulez-vous visiter ma shop?“
Sie schüttelte sie ab, wie lästige Fliegen. Sie wollte nichts kaufen. Weder eine Lederjacke, noch einen Teppich oder eine 'original-marokkanische Handarbeit'.
Vielleicht sogar 'Made in Taiwan', dachte sie.
Aber wie dem auch immer war, sie hatte kein Geld für so etwas. Sie schlenderte an der Strandpromenade entlang. Eine Weile blieb ihr Blick an einem Mann hängen, der einen Eselskarren lenkte.
Das Meer war ruhig. Nebelschwaden hingen tief über der schier endlosen Wasserfläche.
Eine Filmkulisse!, dachte sie plötzlich. Es ist wie in einem Film.
Kurz entschlossen ging sie noch etwas an den Strand. Sie zog sich die Schuhe aus und ließ das kalte Salzwasser um ihre Füße herumspielen. Sie lief ein Stück über den nassen Sand und träumte vor sich hin. Das Meer rauschte. Die Straße etwas weiter oberhalb rauschte auch, aber hier unten am Strand war das Meer lauter. Sie sah sich um.
Kein Mensch war um diese Zeit noch hier. Sie sah nur Dunkelheit und Nebel und das Meer... Und etwas weiter entfernt, als schwarze, düstere Schemen, die Verkaufsbuden und Strandrestaurants, die aber um diese Jahreszeit noch allesamt geschlossen waren. Auch tagsüber. Es waren einfach noch nicht genug Touristen da, als dass es sich gelohnt hätte, sie zu öffnen.
Das Mondlicht kam jetzt fahl durch den Nebel und tauchte alles in ein seltsames Licht. Plötzlich mischte sich das Meeresrauschen mit Stimmen, die bald näherkamen. Im ersten Moment erschrak Elsa, dann lauschte sie. Es waren arabische Stimmen. Männerstimmen.
Sie stand wie erstarrt da, als die Gestalten aus der Dunkelheit ins fahle Mondlicht traten. Sie hörte sie reden, aber natürlich verstand sie kein Wort.
Sie hatte keine Ahnung, wie sie sich verhalten sollte.
Es waren drei junge Männer. Vielleicht 20, vielleicht 25 Jahre alt. Von der traditionellen Kleidung der Marokkaner schienen sie wenig zu halten. Sie trugen Jeans und dunkle Lederjacken. Und wäre da nicht der dunkle Teint ihrer Haut gewesen, man hätte sie nicht von Gleichaltrigen irgendwo in Westeuropa unterscheiden können.
Elsa erinnerte sich an den Eseltreiber, den sie kurz zuvor noch gesehen hatte. Alles das im selben Land zur selben Zeit...
Die Männer musterten sie auf eine Art und Weise, die ihr unangenehm war.
Sie blickte sich um. Aber da schien nirgendwo eine Menschenseele zu sein. Niemand außer diesen drei Typen.
Die Männer lachten.
Elsa hatte die instinktive Ahnung, dass es in ihrem Gespräch um sie ging. Mochte sein, dass sich ihr Gefühl manchmal täuschte, hier war sie sich ziemlich sicher.
Sie wollte gehen.
Einfach weg.
Sie fühlte sich in dieser Lage nicht wohl, wandte sich um und lief ein paar Schritte. Dann geschah das, was sie die ganze Zeit über schon befürchtet hatte. Sie sprachen sie an. Erst auf Französisch, dann kurz danach auf Englisch. Schließlich auf Deutsch.
„Woher kommst du?“, fragte einer von ihnen.
Sie blieb stehen und wandte sich zu ihnen um. Die drei kamen näher.
„Deutschland? Germany? Holland? Woher?“
„Deutschland“, sagte sie. Und ihre eigene Stimme klang ihr fremd.
„Deutschland - gut. Mein Bruder lebt dort. In Düsseldorf. Kennst du Düsseldorf?“
„Ja.“
„Ich war auch schon in Deutschland. In Hamburg. Und in Stuttgart. Mein Vater war beim Zirkus.“
Sie wandte sich erneut zum Gehen. Aber sie kam nicht weit. Ein paar Schritte nur.
„Hey, bleib hier!“
Sie sah in ein etwas ärgerliches Gesicht.
„Ich kann etwas Deutsch. Ich will mich nur unterhalten“, erklärte er. Die beiden anderen sahen gespannt zu. Einer grinste ziemlich frech.
„Nur etwas unterhalten“, meinte er. „Nichts verkaufen!“
„Das sagen alle!“, entfuhr es ihr - eine Spur unfreundlicher, als sie geplant hatte. Aber nun war es einmal heraus.
„Deutschland gut“, sagte er davon unbeeindruckt. „Gut im Fußball und gute Autos.“ Er schien gut Wetter machen zu wollen. Dann veränderte sich sein Gesicht ein wenig. „Bist du allein hier?“
Sie zögerte mit der Antwort.
Sie öffnete zwar den Mund, aber es kam nichts über ihre Lippen. Sie wollte keinen Fehler machen. Auf keinen Fall.
„Es ist niemand hier“, stellte er fest. „Hast du einen Mann?“
Daher wehte also der Wind. Er wollte die Besitzverhältnisse abklären und von ihr wissen, ob er bei ihr landen konnte - ohne dabei in die Rechte eines anderen einzugreifen.
„Nein“, sagte sie. „Ich meine, also...“ Sie stammelte etwas zusammen und wusste sofort, dass ihre Antwort ein Fehler gewesen war. Sie hatte es einfach so gesagt, ohne darüber nachzudenken.
Er lächelte, aber sie erwiderte sein Lächeln nicht.
Der junge Mann kam einen Schritt näher.
„Nicht verheiratet?“, fragte er.
Es schien sehr wichtig für ihn zu sein, sonst hätte er sich nicht noch einmal vergewissert.
Er trat einen weiteren Schritt an sie heran, und ehe sie zurückweichen konnte, hatte er sie am Arm gepackt.
„Du brauchst keine Angst zu haben“, sagte er. Aber sie hatte Angst. Sie zitterte sogar. Sie machte ihren Arm frei und wich erneut ein paar Schritte zurück. Die drei folgten ihr.
„Nur etwas reden...“
„Lasst mich in Ruhe!“
„Wir sind ein gastfreundliches Land! Und wir sind zu jedem freundlich, der zu uns freundlich ist...“
Das war schon eine Art Drohung
„Ihr sollt mich zufrieden lassen!“
Sie begann zu laufen. Keuchend hetzte sie vorwärts, während die drei ihr folgten.
Sie spielten mit ihr. Mit ihr und ihrer Furcht. Sie ließ die Schuhe fallen, die sie in der Hand gehalten hatte, und setzte zu einem Spurt an. Sie rannte, so schnell ihre Beine sie zu tragen vermochten.
Die Männer lachten und kamen hinter ihr her.
Elsa wusste kaum, wohin sie rannte. Sie lief einfach in die Dunkelheit hinein, weg vom Meer, weg vom Strand, dorthin, wo Menschen waren.
Möglichst viele Menschen. In der Masse wäre sie vielleicht sicher.
In dem weichen Sand stolperte sie über etwas. Treibholz vielleicht, dass die Flut herangespült und die Ebbe nicht wieder mitgenommen hatte. Es lag einiges davon hier am Strand. Sie fiel zu Boden.
Sie fühlte den Sand, der in ihre Kleider drang.
Hinter ihr waren die drei Verfolger zu hören. Sie trugen Turnschuhe und kamen schnell heran. Verzweifelt versuchte sie, wieder auf die Beine zu kommen.
Sie betrachten mich als Freiwild!, schoss es ihr durch den Kopf.
Die Kerle schienen sich vollkommen sicher zu fühlen. Hier am Strand, wo es dunkel war und wo kein Mensch wartete...
Das Rauschen des Meeres und der Lärm der Straße, die am Meer entlangführte, betäubten gemeinsam die Ohren. Auf der Strandpromenade würde niemand etwas hören, wenn die drei jetzt über sie herfielen.
Da sah Elsa eine Gestalt aus der Dunkelheit treten. Sie kam aus genau der Richtung, in die sie wollte. Sie kam von der Straße; dorther, wo das Leben war und die Menschen...
Zuerst erschrak sie, aber dann fiel das Mondlicht so, dass sie ein Gesicht sehen konnte. Es war der Däne, der sie auf der Post fast umgerannt hatte.
Er stand da und schien die Situation sofort zu erfassen. Seine Züge waren ruhig und gelassen. Sie waren sogar kalt. Völlig kalt.
Sie blickte zu ihm auf, dann zurück zum Wasser, dorthin, wo die drei Männer waren.
Dann stand sie auf. Sie stand wie angewurzelt da - und dasselbe galt für die drei, die hinter ihr hergelaufen waren.
Sie blickten stirnrunzelnd auf den Mann, der aus der Dunkelheit getreten war und dessen Absicht es ganz offensichtlich zu sein schien, ihnen den Weg zu verstellen.
Elsa setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, bis sie hinter dem Dänen stand. Sie atmete tief durch.
Die drei versuchten es mit dem Dänen auf Englisch, schließlich war nicht zu übersehen, dass er Europäer war. Aber der Mann antwortete auf Arabisch.
Elsa verstand kein Wort. Aber es schien nicht gerade freundlich zu ein, was er ihnen zu sagen hatte. In Augen der drei Marokkaner blitzte es giftig.
Der Däne blieb so kalt wie zu Anfang. Aber er war aufmerksam. Kein Detail in den Bewegungen seiner Gegner schien ihm zu entgehen. Er durchbohrte sie förmlich mit seinem Blick.
Ein paarmal ging der Wortwechsel hin und her.
Und dann blitzte plötzlich ein Messer im Mondlicht. Die Typen grinsten. Ein zweites Messer wurde gezogen. Ein Springmesser. Gefährlich schnellte die Klinge aus dem Griff heraus, so wie die lange Zunge eines Leguans, der seine Beute blitzschnell erlegt und verspeist.
Leichte Beute - dafür schienen die drei den Dänen auch zu halten. Das Zahlenverhältnis sprach für sie, außerdem wirkte der Däne in seinem eleganten Jackett nicht wie ein geübter Straßenkämpfer, der bereit war, sich mit seinen Gegnern im Dreck zu wälzen.
Das erste Messer schnellte drohend vor, die beiden anderen Männer hielten sich noch zurück. Sie schienen erst einmal abwarten zu wollen. Aber in ihren Gesichter stand ein zuversichtliches Grinsen.
Der Däne packte den rechten Arm seines Gegenübers und drehte ihn brutal herum. Mit einem Schrei ließ er das Messer in den Sand fallen.
Schon Sekundenbruchteile später befand sich der Marokkaner im Würgegriff des Dänen.
Die beiden anderen drängte er mit ein paar unfreundlichen Sätzen auf Arabisch zurück. Sie zögerten, und schienen erst etwas verunsichert und nicht recht schlüssig darüber, wie sie sich verhalten sollten, aber dann entfernten sie sich schnell.
Mit einem rauen Stoß beförderte der Däne den Angreifer dann in den Sand. Mit ungläubigen, weit aufgerissenen Augen machte er sich davon.
Das Messer blieb im Sand liegen.
Elsa hatte die ganze Zeit über wie angewurzelt dagestanden.
„Mein Gott!“, entfuhr es ihr.
Der Däne sah sie an.
Sein Gesicht wirkte entspannt und gelassen. Immer noch schien er ein wenig unterkühlt zu sein.
„Alles in Ordnung?“, fragte er.
Sie nickte.
„Ja.“
„Dann ist es ja gut...“
„Ja... Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn Sie nicht gewesen wären!“
Sie wussten beide, was geschehen wäre.
Aber das war im Moment nicht so wichtig.
Es dauerte eine Weile, bis sie begriff, dass er akzentfreies Deutsch gesprochen hatte. Bestes Hochdeutsch. Keinerlei landschaftlicher Einschlag festzustellen. Jedenfalls nicht für Elsa.
Sein Pass war der eines Dänen, aber er hätte auch als Deutscher durchgehen können. Ohne weiteres. Er wäre nirgends als Fremder aufgefallen.
Sie dachte daran, dass sie ihn auch Arabisch und Französisch hatte sprechen hören. Er musste sehr sprachbegabt sein.
„Kommen Sie mit?“
Er runzelte die Stirn.
„Wohin?“
„Zur Polizei.“
„Was wollen Sie dort?“
Sie blickte ihn verständnislos an.
„Aber... Ich meine, diese Typen...“
„Glauben Sie mir, Sie werden mehr Probleme bekommen, als die.“
„Aber es geht doch um... Gerechtigkeit. Ich meine, da kann doch nicht einfach jemand hergehen und einen... „
Er zuckte mit den Schultern und schien ziemlich ungerührt zu sein.
„Hat irgend jemand behauptet, dass es in der Welt gerecht zugeht?“
„Nein, natürlich nicht...“
„Sie können selbstverständlich tun und lassen, was Sie wollen, aber ich gebe Ihnen den Rat, nicht zur Polizei zu gehen. Fehlt Ihnen denn was?“
„Nein...“
„Sind Sie verletzt? Ist irgend etwas Ernsthaftes passiert?“
„Nein, Sie sind ja gerade noch rechtzeitig dazwischen gekommen!“
„Dann sollten sie die Sache auf sich beruhen lassen! Glauben Sie mir. Ich lebe schon eine ganze Weile hier...“
„Aber Sie haben doch alles gesehen! Wenn Ihre Aussage...“
„Sie stellen sich das falsch vor!“, meinte er. „Dies ist ein sehr bürokratisches Land. Und eines, in dem Beziehungen eine wichtige Rolle spielen. Vor allem verwandtschaftliche. Wissen Sie was passiert, wenn Sie einen Polizisten nach dem Weg fragen?“
„Nein.“
„Er wird Sie an einen Fremdenführer vermitteln. An irgendeinen entfernten Vetter. Dieser Fremdenführer macht das natürlich nicht umsonst. Er gibt dem Polizisten was, der die Sache vermittelt, hat und bringt Sie dann an Ihr Ziel. Aber nicht auf direktem Wege. Er geht davon aus, dass Sie sich hier nicht auskennen und wird Sie erst einmal an ein paar Geschäften vorbeibringen, mit deren Besitzern er entweder verwandt oder befreundet ist und von denen er vermutlich auch etwas dafür bekommt, dass er Touristen zu ihnen ins Geschäft lockt.“ Er lächelte jetzt ein wenig. „So funktioniert das Leben hier. Das gilt für alle Bereiche. Begreifen Sie jetzt, weshalb ich es nicht für sinnvoll halte, zur Polizei zu gehen?“
„Ich weiß nicht...“
„Eine ordnungsliebende Deutsche, die es gewohnt ist, dass alle Beamten unbestechlich sind und alles gut organisiert ist!“
„Machen Sie sich nicht über mich lustig!“
„Das tue ich nicht. Ganz bestimmt nicht.“
„Wie heißen Sie?“ Es interessierte Elsa auf einmal, was das für ein Mann war, der hier vor ihr stand. Es hatte sie schon gestern in der Post interessiert, aber da war es ihr nicht so bewusst gewesen.
„Ich heiße...“ Er schien einen Moment zu zögern, bevor er weitersprach. Elsa konnte sich dieses Zögern nicht erklären. Sie dachte auch nicht weiter darüber nach. Später, viel später sollte es ihr verständlich werden.
„Jensen“, sagte er. „Robert Jensen.“
Er war Däne, sie hatte seinen Pass gesehen. Und sein Name klang wie ein dänischer Name jedenfalls soweit sie das beurteilen konnte. Es war ein Allerweltsname. Dieser Name konnte ebenso gut einem Deutschen, einem Holländer oder einem Belgier flämischer Zunge gehören. Nicht zu vergessen die anderen skandinavischen Länder.
Sie maß dieser Tatsache kaum eine Bedeutung bei, sie dachte einfach so darüber nach.
„Und Sie?“, fragte er dann. „Wie ist Ihr Name?“
Man konnte wirklich keinen Akzent hören. Nicht einmal eine gewisse Unsicherheit in der Auswahl von Wörtern.
„Elsa“, sagte sie. „Elsa Karrendorf.“
„Woher kommen Sie in Deutschland?“
„Osnabrück.“
„Nicht gerade eine Weltstadt. Aber ich war schon einmal dort.“
„Sie sprechen gut Deutsch.“
„Danke.“
„Sie scheinen überhaupt recht sprachbegabt zu sein... Französisch, Arabisch...“
„Ja, es ist besser, man versteht, was die Leute sagen. Sie bescheißen einen dann nicht so leicht. Jedenfalls ist das meine Erfahrung.“
„Fremdsprachen waren mir immer ein Gräuel.“
„Das ist schade.“
„Ein bisschen Englisch in der Schule. Es ist gerade genug hängengeblieben, dass ich mich durchschlagen kann...“
„Na ja, es gibt so viele deutsche Touristen... Man liest jetzt auch hier Schilder mit der Aufschrift 'Man spricht Deutsch' und 'Dortmunder Kronen'!“
„Ja!“ Sie lachte. „Und 'Wiener Schnitzel'!“
Er lachte jetzt auch und entblößte dabei zwei Reihen makelloser Zähne.
Dann fragte Sie: „Woher kommen Sie - in Dänemark?“
Er runzelte etwas die Stirn. Dann schmunzelte er etwas.
„Mein Deutsch scheint doch nicht so gut zu sein, wenn man gleich hört...“
„Nein, ich habe gestern auf der Post Ihren Pass gesehen.“
„Ich verstehe...“
„Also, woher?“
„Kleines Nest. Kennen Sie bestimmt nicht. Und ich war auch schon lange nicht mehr dort. Schon sehr lange... Wahrscheinlich würde ich es gar nicht wiedererkennen.“
Sie stand vor ihm und fühlte sich plötzlich etwas verlegen. Ein paar Augenblicke lang hielt das unangenehme Schweigen an.
Dann meinte er plötzlich: „Soll ich Sie zu Ihrem Hotel bringen?“
Sie nickte. Er vermittelte ihr das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit; ein Gefühl, nachdem sie gerade jetzt, nach diesem unangenehmen Vorfall, ein großes Verlangen hatte.
Also sagte sie: „Ja.“
Sie sagte es schnell und ohne auch nur einen Moment zu zögern, denn sie hatte das Gefühl, dass sie diesem Mann vertrauen konnte.
„Gut, dann gehen wir.“
„Ja, aber ich will erst noch zum Wasser zurück.“
„Warum?“
„Meine Schuhe - ich habe sie verloren, als ich vor den Dreien davongerannt bin...“
„Sehen wir mal nach. Aber ich glaube nicht, dass wir sie wiederfinden.“
Sie fanden sie doch wieder. Gegen alle Wahrscheinlichkeit. Sie lagen im Sand, und Elsa hob sie auf, schüttelte sie aus und streifte sie über ihre nackten Füße.
Es waren billige Textilschuhe. Einer hatte bereits ein Loch an der Seite.
Unwillkürlich kamen ihr die Schuhe ins Blickfeld, die Robert Jensen trug. Es waren Leder-Slipper. Und wie alles andere, was er trug, nur vom Besten.
Er trug diese Dinge wie selbstverständlich. Sie waren nichts Besonderes für ihn.
Jensen machte den Eindruck, Geld zu besitzen. Genug jedenfalls, um ein gutes Leben führen zu können.
„Was machen Sie beruflich?“, fragte sie plötzlich.
„Lass das 'Sie' weg“, meinte er. „Ich bin Robert. Okay?“
„Gut, wie du willst...Robert.“
Sie gingen durch den weichen, feinen Sand, und sie hoffte, dass er noch ihre Frage beantwortete, aber er kam nicht mehr darauf zurück. Und sie wollte nicht aufdringlich sein und nachhaken.
Sie hatte schließlich kein Recht, ihn in ein Kreuzverhör zu ziehen. Er musste selbst wissen, auf welche Fragen er ihr antwortete und auf welche nicht. Vielleicht wollte er es ihr nicht sagen, vielleicht hatte er auch nur nicht mehr daran gedacht...
Sie kamen zur Straße, die an der Küste entlangführte. Palmen wuchsen zu beiden Seiten. Viele von ihnen waren höher als die Häuser, die auf der dem Meer abgewandten Seite standen. Hupende Autos drängten sich auf dem Asphalt. Hier und da gab es Eselskarren, die den Betrieb aufhielten.
„In welchem Hotel wohnst du?“, fragte er.
„Hotel Massilia.“
„Kenne ich nicht.“
„Es ist halt sehr preiswert.“
„Verstehe...“
„Die Dusche ist zwar kalt, aber sonst ist es ganz nett. Ich bin nicht sehr anspruchsvoll...“
Sie gingen jetzt durch enge, leere Seitengassen. Die Kinder, die sonst in schwärmen umherliefen und sich unweigerlich auf jeden Touristen stürzten, um ihn anzubetteln und ihm die Kasbah, die Altstadt zu zeigen, waren jetzt wohl schon im Bett.
Schließlich erreichten sie das Hotel.
„Nochmals vielen Dank!“, sagte sie ein wenig unbeholfen.
„Keine Ursache“, meinte er.
„Robert...“, sie öffnete den Mund, aber sie schien nach den richtigen Wörtern zu suchen.
„Ja?“
„Vielleicht sehen wir uns mal wieder.“
„Warum nicht!“
Sie nickte und lächelte.
„Schön.“
„Ich werde dich morgen abholen“, sagte er.
Sie schaute ihn überrascht an. Aber dann nickte sie erfreut.
„Gut.“
Sie fühlte ein eigenartiges Prickeln. Robert Jensen drehte sich von ihr fort und ging die Straße hinunter. Sie sah ihm nach, aber er blickte nicht zurück.
Sie musste ihre Gefühle erst ordnen. Alles, was an diesem Abend geschehen war, schien ihr auf einmal seltsam nebulös. Wie aus einem Traum, aus dem sie gerade erwachte und den sie nun langsam vergessen konnte.
Ihr gesamtes Inneres schien durcheinandergewirbelt zu sein. Sie wusste nur, dass dieser Mann sie interessierte. Sie konnte nicht sagen weshalb. Es war einfach so. Und sie hatte nicht die Absicht, sich dieser Regung entgegenzustellen. Nein, ganz im Gegenteil. Sie freute sich darauf, ihn wiederzusehen.
2.
Robert hielt sein Versprechen und tauchte im Frühstücksraum des Hotel Massilia auf, als sie vor ihrem Milchkaffee und dem Weißbrot saß. Sie war gerade damit beschäftigt, sich die Marmelade auf das Brot zu streichen.
Es war Kakteenmarmelade, und sie empfand sie als ziemlich bitter. Aber es gab hier nichts anderes.
Er setzte sich zu ihr an den Tisch.
„Guten Morgen, Elsa.“
„Guten Morgen...“
„Gut geschlafen?“
„Es ging.“
„Na ja, verständlich - nach dem, was gestern Abend geschehen ist. Du solltest die Sache so schnell wie möglich vergessen.“
„Ich versuche es. Ehrlich. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ich habe einen ziemlichen Schrecken gekriegt...“
„Wenn wundert's?“
„Ich meine, man hat solche Dinge so oft im Kino oder im Fernsehen gesehen, aber wenn es einem dann selbst passiert. Das ist dann doch etwas ganz anderes.“
„Natürlich.“
„Möchtest du auch etwas frühstücken, Robert?“
„Nein, danke. Ich habe schon.“
Sie musterte sein Gesicht, während sie sich das Brot in den Mund schob und abbiss. In seiner Gegenwart fühlte sie sich sicher, vielleicht war das ihre wichtigste Empfindung ihm gegenüber.
Sie fand ihn auch sonst als anziehend, aber dieses Gefühl war beherrschend.
Bei einem Mann war für sie schon immer das Wichtigste gewesen, dass er ihr ein Gefühl von Sicherheit gab. Und dass er wusste, was er wollte und was zu tun war. Ein Mann, der vorausblickte, der Gefahren kommen sah, lange vor allen anderen.
Sie sah in sein Gesicht und dachte: Ja, er weiß was er will. Dies war das Gesicht eines entschlossenen Charakters, der keinen Moment zweifelt. Jedenfalls nicht an sich. Am Rest der Welt vielleicht, aber nie an sich selbst und seiner Kraft, seiner Intelligenz und seiner Überlegenheit.
Elsa war ganz anders.
Sie zweifelte ständig an sich, an ihrem Aussehen, ihrer Figur, ihrem Charakter, ihren Fähigkeiten, ihrer Intelligenz..., an allem, was sie betraf. Alles schien perfekt und schön und gut und überlegen zu sein, nur sie nicht.
Sie wusste nicht, woher das kam, und sie mochte auch nicht darüber nachdenken. Schon gar nicht in diesem Augenblick. Nein, in diesem Augenblick, als sie Robert gegenübersaß schon gar nicht.
„Was machst du?“, fragte er plötzlich.
Seine tiefe, ruhige Stimme... Ja, es war nicht nur das Gesicht, das ihr Sicherheit vermittelte. Es war auch diese Stimme. Ein Mann, der eine solche Stimme hatte, die kein bisschen unsicher klang, der musste sich seiner Sache einfach sicher sein, der konnte keine Zweifel haben.
Diese zersetzenden Zweifel. Sie verscheuchte diesen Gedanken erst einmal erfolgreich. Sie wusste ohnehin, wohin das führte. Geradewegs in eine Depression hinein.
Sie wusste es, weil sie es schon so oft erlebt hatte. Und sie war dumm genug, es immer wieder mitzumachen.
Ihr Arzt hatte ihr geraten, in eine psychologische Beratung zu gehen, aber sie hatte das empört von sich gewiesen.
Roberts Stimme drang wie ein blitzendes Messer durch ihre trüben Gedanken und durchtrennte den Nebel, der in ihrem Inneren herrschte.
„Was ich mache? Wie meinst du das?“
„Beruflich meine ich.“
„Ach so.“
„Also?“
„Ich studiere.“
„Was?“
„Germanistik und Kunst.“
„Interessant.“
Der Klang seiner Stimme hätte jedem anderen verraten, dass er es nicht besonders interessant fand. Aber sie hörte das nicht. Sie hatte einfach keine Ohren dafür.
„Auf Lehramt?“, fragte er.
„Ja. Erst habe ich ein Magisterstudium begonnen, aber jetzt bin ich umgestiegen.“
„Warum?“
„Man muss ja schließlich irgendwann auch einmal damit anfangen, sein eigenes Geld zu verdienen.“
„Ja, das ist richtig.“
„Und was machst du, Robert?“
Sie hörte ihre Stimme seinen Namen sagen, und auf einmal klang das, was über ihre Lippen kam, ihr selbst fremd. Sie blickte auf, direkt in seine hellblauen Augen. Und sie dachte: stell ihn dir mit grauen Haaren vor, dann könnte er dein Vater sein.
Aber er hatte keine grauen Haare.
Und er war auch nicht ihr Vater. Es war einfach ein Gedanke gewesen, der sie angeflogen und nicht wieder losgelassen hatte. Dieser Gedanke sollte sie noch eine ganze Weile lang verfolgen.
„Na?“, fragte sie. Er hatte nicht sofort geantwortet. Und an seinem unbewegten Gesicht war nicht zu erkennen, worin der Grund dafür lag.
Vielleicht war es auch nur Einbildung.
Vielleicht war sie einfach zu ungeduldig.
„Geschäfte“, sagte er unverbindlich.
„Müssen ganz gut laufen, deine Geschäfte“, meinte sie und er runzelte unwillkürlich die Stirn.
„Wie kommst du darauf?“
„Nun, die Sachen, die du trägst, sind nicht gerade billig. Die Uhr da an deinem Handgelenk... Ich vermute es einfach. Du siehst aus wie jemand, der Erfolg hat und der nicht jeden Pfennig umdrehen muss, bevor er ihn ausgibt.“
Er lächelte.
„Ja, das trifft es wohl...“, murmelte er nachdenklich. Sie hoffte, dass er noch etwas Näheres dazu sagen würde.
Aber es kam nichts mehr.
Stattdessen fragte er, als er sah, dass Elsa aufgegessen hatte: „Was machen wir heute?“
„Ich weiß nicht...“
„Mein Auto steht vor der Tür. Wir können etwas in der Umgebung herumfahren!“
Sie zuckte erst mit den Schultern. Dann nickte sie.
„Okay.“
Er lächelte und zeigte dabei seine Zähne.
„Gut, dann los!“ Robert fuhr einen Landrover.
„Wow!“, staunte Elsa. „Ich habe schon immer davon geträumt, mal in so einem Ding zu sitzen!“
„Na, nun sitzt du ja drin!“
„Gehört er dir? Oder ist der Wagen geliehen?“
Schon als es über ihre Lippen gekommen war, wusste sie die Antwort. Es war eine dumme Frage. Eine, die sich im Grunde erübrigte. Sein Gesichtsausdruck in diesem Moment sagte ihr genau das.
Jemand wie Robert brauchte sich keinen Wagen zu leihen. Es war zumindest mehr als unwahrscheinlich.
„Er gehört mir“, sagte er.
Sie fuhren los.
„Wohin geht's?“
Sie hatten nicht darüber gesprochen.
Und Elsa wunderte sich über sich selbst.
Da stieg sie zu einem Mann ins Auto, den sie kaum kannte und ließ sich von ihm irgendwohin fahren.
Es zeigte, wie sehr sie ihm vertraute. Von Anfang an, ohne einen wirklich fassbaren Grund dafür zu haben. Und dann kam es ihr erneut in den Sinn: Wenn er graue Haare hätte, könnte er mein Vater sein...
Vielleicht war das der Grund.
Sie dachte nur ganz kurz darüber nach. Einen Sekundenbruchteil lang vielleicht. Dann scheuchte sie den Gedanken beiseite. Sie wollte hier nicht weitergrübeln.
Sie wusste, wohin das führte. Ihr Vater... Nein, das war ein eigenes Kapitel, und sie hatte jetzt einfach keine Lust, darin zu lesen.
„Also wohin, Robert?“, hörte sie sich selbst sagen.
„Einfach ein bisschen in der Gegend herum, dachte ich. Einverstanden?“
„Meinetwegen.“
„Seit wann bist du in Tanger?“
„Seit vorgestern.“
„Bist du schon aus der Stadt heraus gewesen?“
„Nein.“
„Hab ich mir gedacht...“
„Ich war in der Kasbah und auf dem Markt.“
„Natürlich, da führen sie einen immer zuerst hin.“
„Ich hatte einen offiziellen Führer. Einen mit Ausweis. Die sind gleich am Hafen gewesen.“
„Ja, wie die Hyänen stürzen die sich auf neu angekommene Touristen. Trotzdem: Wenn du an einen offiziellen Führer gerätst, ist das Risiko nicht so groß, an einen Halsabschneider zu geraten.“
„Meiner war ganz nett. Und es war ein offizieller Führer. Er hat mich auch zum Hotel gebracht. Ich habe ihm gesagt, was ich mir leisten kann, und er hat mich hingebracht.“
„Hat er dir auch ein Taxi besorgt?“
„Ja, hat er.“
„Und dir den Geldumtausch besorgt?“
„Ja, hat er auch. Aber woher...?“
„Vielleicht waren das alles seine Cousins: Der Hotelbesitzer, der Taxifahrer...“
„Und wenn schon!“
Sie lachten beide.
„Was suchst du hier in Marokko?“
„Ich habe keine Ahnung.“
Robert gegenüber war sie völlig offen. Es schien, als könnte sie nichts vor ihm verbergen, als würde sich alles in ihr ihm gegenüber von selbst öffnen. Es beängstigte sie ein wenig. Aber sie fühlte sich gut dabei. Und das war doch alles, worauf es im Moment ankam.
Nein, sie beschloss, keine Zweifel zuzulassen, nicht an sich selbst und schon gar nicht an dem Mann, der neben ihr saß.
„Ich wollte mal was anderes sehen“, sagte sie. „Einfach mal was anderes. Sonne, verstehst du?“
„Ich weiß nicht...“
„Bei uns zu Hause gibt es zu dieser Jahreszeit oft noch Schneeschauer... Das ist so trostlos. Irgendwie...“ Sie suchte nach Wörtern, nach Wörtern, die passten und das ausdrückten, was sie empfand. Und dabei stellte sie fest, dass sie selbst sich darüber kaum im klaren war. Im Grunde genommen hatte sie nur sehr oberflächlich darüber nachgedacht. Und dann war es auf einmal heraus: „Abstand...“, murmelte sie.
Sie sah zu ihm hinüber.
Er saß ruhig am Steuer. Seine Stirn hatte sich ein klein wenig in Falten gelegt. Er hob die Augenbrauen.
„Abstand?“ fragte er.
„Ja.“
„Abstand wovon?“
„Ich weiß nicht, ob dich das interessiert...“
„Doch, es interessiert mich, Elsa. Weil du mich interessierst.“
Das hatte er nett gesagt, fand sie. Und es ging ihr ganz warm den Rücken hinunter.
„Es ist eine sehr persönliche Sache“, sagte sie. „Und sehr unangenehm...“
Sie wurde sich schnell darüber klar, dass er daraus nicht schlau werden konnte. Sie redete einfach so, wie ihre Gedanken kamen, aber wie sollte er das verstehen.
Er sah kurz zu ihr hinüber.
„Eine Liebesgeschichte?“
„Nein.“
„Was dann?“
„Meine Eltern...“
Sie schluckte.
„Was ist mit ihnen?“
„Sie haben sich gerade scheiden lassen. Jetzt, nach so vielen Jahren...“
Sie sah es ihm an, was er dachte. So etwas passiert doch jeden Tag. Jeden Tag dutzendmal, hundertmal, tausendmal... Kein Mensch regte sich über so etwas auf.
„Es hat mich sehr mitgenommen“, fügte sie hinzu, als müsste sie etwas erklären.
„Ich verstehe...“
Er verstand es nicht, davon war sie überzeugt. Aber er tat immerhin so, und das war nett.
„Ich habe immer gedacht, das zwischen meinen Eltern alles in Ordnung wäre“, sprudelte es aus ihr heraus. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie sich früher viel gestritten haben. Ich meine, in anderen Ehen gibt es Gewalt und Alkohol und so etwas - und die werden nicht geschieden...“
„Wie alt bist du?“, fragte er.
„22. Warum?“
„Du bist eine erwachsene Frau.“
Sie glaubte zu verstehen, was er meinte.
„Ja schon, aber...“
„Und deine Eltern sind ebenfalls erwachsene Menschen, nicht wahr?“
„Ich weiß. Mein Verstand weiß das. Mein Gefühl glaubt es nicht. Verstehst du das, Robert? Dass die eine Hälfte von dir etwas weiß, die andere es aber nicht wahrhaben will?“
„Ja.“
Mein Gott, dachte sie. Ich kenne ihn seit gestern Abend, und schon erzähle ich ihm meine ganze Familiengeschichte. Sie hätte noch weiter gesprochen, wenn sie sich nicht plötzlich gebremst hätte.
Sie musste an ihren Arzt denken.
Elsa hatte immer wieder unter psychosomatischen Beschwerden gelitten. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Hautausschläge und anderes.
Und dann hatte sie dem Arzt plötzlich Dinge erzählt, die ihn eigentlich nichts angingen. Und die auch gar nicht in den Bereich eines Arztes fielen. Von ihren Problemen mit Männern und ihren Eltern und tausend anderen Dingen. Ihrer Angst, das Studium eines Tages ohne Prüfung aufgeben zu müssen.
Sie hatte diese Angst, die Prüfung nicht zu schaffen, schon gehabt, als sie gerade das Abitur hinter sich gebracht hatte. Und vor dem Abitur hatte sie auch Riesenangst gehabt - seit sie das Gymnasium besuchte.
Im Grunde genommen hatte sie ihr ganzes Leben lang Angst davor gehabt, dieses und jenes nicht zu schaffen.
Der Arzt hatte ihr gesagt, dass sie jemanden brauchte, bei dem sie sich aussprechen konnte. Einen Psychotherapeuten. Einer, der dafür ausgebildet war.
„Ich bin doch nicht verrückt!“, hatte sie dem Arzt empört geantwortet. Aber vielleicht hatte der Arzt recht gehabt.
Vielleicht brauchte sie so jemanden. Eine Art Pfarrer, der ihr die Beichte abnahm.
Plötzlich hörte sie Roberts ruhige Stimme. Sie klang warm in ihren Ohren. Warm und sicher.
„Vielleicht war es gar keine schlechte Idee, erst einmal eine Reise zu unternehmen“, meinte er. „Das lenkt einen etwas ab, nicht wahr?“
„Ja, das stimmt.“
Robert jagte den Landrover die schmale Küstenstraße entlang. Eine Weile schwiegen sie beide.
Dann fragte Elsa plötzlich: „Wie alt bist du eigentlich?“
In diesem Moment kam ein Wagen von vorne. Er schoss um eine unübersichtliche Kurve herum und kam dabei ziemlich weit auf die andere Fahrbahn. Robert musste im letzten Moment ausweichen.
„Idiot!“, schimpfte er vor sich hin.
Auf ihre Frage kam er nicht mehr zurück. Sie fuhren weiter in der Umgebung herum, und auf diese Weise sah Elsa etwas vom Land. Einmal stiegen sie an einer schönen Stelle aus. Ein Steilhang ging zum Meer hinab. Weiter oberhalb lagen grüne Hügel.
„Man denkt immer an Wüste, wenn von Nordafrika die Rede ist“, meinte sie. „Unwillkürlich denkt man an Wüste. Aber wenn man mit dem Schiff von Algeciras hier ankommt, dann sieht man schon diese grünen Flächen auf den Hügeln...“
Er lachte.
„Ja.“
„Seit wann bist du hier, Robert?“
„Schon ein paar Jahre.“
„Du lebst hier?“
„Ja.“
Ihr fiel ein, dass er Arabisch sprach. Ja, er schien wirklich hier zu Hause zu sein.
„Ich habe ein Haus unweit von Tanger“, meinte er. „Es liegt direkt am Meer.“
„Und du kannst deine Geschäfte von hier aus abwickeln?“, fragte sie. Sie wollte nicht zu neugierig erscheinen, aber jetzt interessierte es sie doch ziemlich stark, womit er sein Geld verdiente. Was mochten das für Geschäfte sein, die man von einem Ort wie Tanger aus erledigen konnte?
Wie ein Teppichhändler sah er jedenfalls nicht aus.
Er blickte sie an und strich ihr über das Haar, das sie zu einem Knoten zusammengesteckt hatte.
„Manchmal muss ich für einige Zeit verreisen“, sagte er. „Aber das meiste geht von zu Hause aus... Möchtest du mein Haus mal sehen?“
Sie schob sein Jackett beiseite und legte ihren Arm um seine Hüften. Sie nickte.
„Ja, warum nicht?“
Sie fühlte seinen Arm um ihre Schultern und war wie elektrisiert. Es ist wie in einem Traum, dachte sie. Ein Traum...
Sie gingen zum Auto zurück, und Robert ließ den Motor an. Dann brauste der Landrover los.
Es geht alles so schnell, dachte sie. Aber sie hatte ein gutes Gefühl.
Sie fühlte sich so wohl wie schon lange nicht mehr, schon sehr lange. All die trüben Nebel schienen aus ihrem Bewusstsein hinausgefegt worden zu sein.
Robert drehte die Stereo-Anlage an. Kühle, abgedämpfte Trompetentöne, die aus dem Nichts zu kommen schienen...
„Was ist das für Musik?“, fragte sie.
„Miles Davis. Ein Jazztrompeter.“
Der Name sagte ihr nichts. Aber sie mochte diese Musik nicht.
3.
Das Haus war weiß. Schneeweiß und genau so, wie man sich ein orientalisches Haus vorstellt. Eine Villa, umgeben von einer hohen Mauer, auf der ein gusseisernes Gitter aufgesetzt war. Es schien ziemlich einsam zu liegen und von einem großen Grundstück mit Garten umgeben zu sein.
Elsa hörte das Meeresrauschen bereits, als Robert das Tor passierte und den Wagen vor der Haustür abstellte.
„Macht ein solches Anwesen nicht unwahrscheinlich viel Arbeit?“, fragte sie unwillkürlich.
Er lächelte.
„Es geht...“
Ihr zweiter Gedanke betraf das Geld, das ein solches Anwesen kosten musste. Mein Gott, dachte sie, mit was für einem Mann habe ich es hier zu tun? Solche Villen besaßen in den Fernsehkrimis immer die großen Drogenbosse und Mafia-Chefs.
Es war ein dummer, abwegiger Gedanke und sie schalt sich einen Narren. Elsa öffnete die Tür des Landrovers auf und stieg hinaus.
Robert beobachtete sie lächelnd. Ihr stand eine ganze Weile lang der Mund offen. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, meinte sie schließlich.
„Dann sag eben nichts“, lachte er.
Sie liefen zusammen zur Haustür. Er öffnete, und dann gingen sie hinein.
„Fühl dich wie zu Hause“, meinte er.
„Gut.“
„Ich schätze, du bist durstig. Ich jedenfalls bin es.“
„Ja, ich auch.“
„Einen Drink?“
„Nein, nichts Alkoholisches.“
„Eine Frage der Überzeugung?“
„Nicht direkt, nein. Aber wenn ich ehrlich bin, dann trinke ich kaum Alkohol. Manchmal etwas Wein. Aber nicht zu süß.“
„Ich habe auch Wein...“
„Nein, nicht schon um diese Tageszeit. Lieber eine Cola.“
„Auch okay.“
Sie standen in einem großen Wohnzimmer, hell eingerichtet mit bequemen Möbeln. Robert ging nach nebenan und holte die Getränke aus dem Kühlschrank.
Elsa nahm die Cola-Büchse, riss sie auf und setzte sie an den Mund. Sie war eiskalt.
Elsa trat an die helle Fensterfront, die nach hinten hinaus, zum Garten ging. Hohe Fenster mit einer Glastür. Dahinter war eine überdachte Terrasse. Und dahinter Rasen. Er schien frisch gemäht zu sein.
Wie in einem Park, dachte Elsa. Und dann sah sie den Swimmingpool.
„Sollen wir hinausgehen?“, fragte Robert.
„Gerne.“
„Dann komm!“
Er öffnete die Tür und sie traten hinaus. Sie liefen zum zum Pool. Elsa beugte sich nieder und tauchte die Hand in das klare Wasser.
„Warm genug?“, erkundigte sich Robert schmunzelnd.
Sie blickte zu ihm auf und schien im ersten Moment etwas irritiert.
Dann lächelte sie. Ein wenig Verlegenheit lag in diesem Lächeln.
„Ja, sicher.“
„Wollen wir baden, Elsa?“
Sie sah seinen festen Blick, in dem eine Mischung aus Begehren und Entschlossenheit stand.
„Baden?“
„Ja.“
Sie wollte Zeit gewinnen, obwohl ihr nicht klar war wozu eigentlich. In Wahrheit hatte sie sich längst entschieden.
„Ich habe keinen Badeanzug dabei“, wandte sie ein.
Ein schwacher Einwand. Und sie trug ihn auch nicht besonders entschlossen vor.
Um seine Lippen spielte ein provokativer, etwas spitzbübischer Zug.
„Macht das etwas?“
„Ich weiß nicht...“
„Wir baden so!“, entschied er. „Wer sollte uns hier schon beobachten können?“
Das Herausfordernde in seinem Blick gefiel ihr. Sie begann sich auszuziehen.
„Also los!“ Wenig später schwammen sie zusammen in dem glasklaren Wasser. Elsa fühlte sich wunderbar, und eine schreckliche Sekunde lang fragte sie sich, wo all ihre Ängste geblieben waren.
Robert schwamm hinter ihr her und holte sie rasch ein. Elsa strich sich das nasse Haar aus dem Gesicht. Sie fühlte seine Arme, die sich um ihre Schultern legten und schmiegte sich an ihn.
Sie küssten sich, erst zärtlich und sehr vorsichtig, dann immer heftiger und leidenschaftlicher. Schließlich stiegen sie gemeinsam aus dem Pool. Das Wasser tropfte von ihren Körpern.
Sie gingen ins Haus.
In dem großzügigen Wohnzimmer bedeckte kalter Stein den Fußboden. Aber da lag auch ein großer Teppich, und auf ihm sanken sie gemeinsam nieder und liebten sich.
Es war ein Rausch, der stark genug war, sie beide vollkommen zu erfassen und mit sich zu reißen.
Später dann, als Elsa hinaus an den Pool trat, um ihre Sachen aufzusammeln, fiel ihr Blick auf Roberts Jackett. Er hatte es einfach hingeworfen, bevor sie zusammen ins Wasser gegangen waren. Sie hob es auf und blickte sich um. Robert war noch nicht hinausgetreten.
Blitzschnell schoss ihre Hand in die Innentasche und zog den Pass heraus. Sie blätterte in dem Dokument herum und fand schließlich, was sie suchte: Das Geburtsdatum.
Sie rechnete. 38 Jahre!, dachte sie. Er war 38 und sie selbst 22. 16 Jahre lagen zwischen ihnen. 22 Jahre lagen zwischen ihr und ihrem Vater...
Sie dachte an ihren ersten Freund, den ersten, mit dem sie intim geworden war. Sie konnte sich nicht mehr genau erinnern, wie alt er gewesen war. Irgend etwas zwischen 40 und 45. Aber sie wusste noch genau, wie alt sie gewesen war: 17.
Er war einer ihrer Lehrer gewesen und sie hatte ihn abgöttisch geliebt. Aber für ihn war sie nicht mehr als ein Abenteuer gewesen.
Wie hätte es auch anders sein können. Ein verheirateter Mann mit Kindern, der sehr auf seinen Ruf bedacht war! Für jeden, der bei klarem Verstand war, lag die Sache auf der Hand.
Aber sie war nicht bei klarem Verstand gewesen. Damals nicht. Ein paar Wochen hatte es gedauert, dann war alles zu Ende gewesen. Als Robert hinaustrat und ebenfalls seine Sachen zusammen sammelte, steckte sie den Pass zurück ins Jackett und gab es ihm.
„Du bist 38“, stellte sie fest.
Er murmelte etwas.
„Ich weiß fast nichts über dich, Robert!“
Er nahm die Jacke und schien ein klein wenig ratlos zu sein. Dann meinte er: „Ist denn das so schlimm? Kommt es auf das an, was gewesen ist?“
„Nein, aber...“
„Das einzige, was zählt, ist die Gegenwart, Elsa. Der Augenblick, sonst nichts. Jeder von uns kommt aus dem Nichts und verschwindet dort eines Tages auch wieder.“
Sie sah ihn an und schüttelte ganz energisch den Kopf.
„Nein!“, sagte sie. „Das stimmt nicht!“
„Nein?“
Eine Spur von Spott war jetzt in seiner Stimme. Eine winzige Spur nur und nicht stark genug, um Elsa zu verletzen.
„Jeder von uns hat seine Geschichte. Und niemand kann aus seiner eigenen Geschichte heraus“, erklärte sie bestimmt.
Robert verzog das Gesicht.
„Klingt beängstigend.“
„Schon möglich. Aber ich finde, dass es stimmt!“
„Ich ziehe mein Weltbild vor.“
„Und ich möchte etwas mehr von deiner Geschichte erfahren, Robert!“
Er zuckte mit den Schultern.
„Wenn es weiter nichts ist...“ Das sollte leicht dahergesagt klingen, aber die Leichtigkeit blieb aufgesetzt. Er zuckte erneut mit den Schultern.
„Was hast du diese ganzen 38 Jahre lang gemacht, Robert! Ich liebe dich, und ich möchte jede Minute davon kennenlernen! Hörst du, jede Minute! So wie ich jeden Zentimeter deines Körpers kennengelernt habe!“
Er runzelte die Stirn, als wollte er sagen: Das kannst du doch nicht ernst meinen, Elsa! Aber er sagte es nicht. Er stand einfach da und schaute sie unschlüssig an.
„Gehen wir erst einmal 'rein“, murmelte er dann und legte den Arm um ihre Schulter.
Sie zogen sich an.
Zusammen sanken sie auf eine weiche Couch. Elsa legte den Kopf an Roberts Schulter.
„Erzähl mir etwas über deinen Vater!“, forderte sie.
„Meinst du das ernst?“
„Ja.“
„Also gut. Er war Pfarrer.“
„Ehrlich?“
„Ja, sicher, weshalb sollte ich nicht ehrlich sein?“
„Und deine Mutter? Was kannst du über sie sagen?“
„Sie war die Frau eines Pfarrers. Was soll ich sonst noch über sie sagen? Ich glaube, dass sie das hinreichend charakterisiert.“
„Glaubst du an Gott?“
In seinem Gesicht stand Verwirrung.
„Ein seltsamer Fragenkatalog ist das, findest du nicht auch, Elsa?“
„Nein, finde ich nicht. Ich finde es sogar sehr naheliegend, danach zu fragen. Dein Vater ist Pfarrer...“
„...war Pfarrer. Er lebt nicht mehr.“
„Das tut mir leid.“
„Braucht es nicht. Er ist alt genug geworden.“
„Trotzdem: Es interessiert mich, wie du über die Sache denkst!“
„Gott? Religion? Christentum?“
„Ja, alles das, was für deinen Vater doch schrecklich wichtig gewesen sein muss.“
Robert atmete tief durch. Einen Augenblick lang schien er zu überlegen. Dann erklärte er: „Ich glaube an mich selbst.“
„An sonst nichts?“
„Nein.“
„Das kann doch nicht alles sein!“
„Warum nicht?“
„Ich meine, man muss ja nicht gleich an ein höheres Wesen glauben. Aber irgendwelche Werte vielleicht...“
„Nein.“
„Das überrascht mich!“
„Mein Vater war ein Mann mit strengen Grundsätzen...“
„Und du, Robert?“
„Ich habe die Nase voll von solchen Dingen. Gestrichen voll.“ Es klang etwas bitter. Elsa runzelte die Stirn.
„Wie ist das gekommen?“
Er strich ihr das Haar glatt.
„Vielleicht bin ich damit überfüttert worden.“ Und dann, nach kurzer Pause: „Hast du Hunger?“
„Ein bisschen, ja.“
„Sollen wir in die Stadt fahren?“
„Nach Tanger?“
Er lachte kurz.
„Natürlich, wohin sonst!“
Sie überlegte einen Augenblick. Dann sagte sie: „Nein, ich möchte lieber hier bleiben.“
Er nickte.
„Auch gut. Dann werde ich mal sehen, was noch im Kühlschrank ist!“
Am nächsten Morgen erwachte Elsa in einem Bett, das nicht das ihre war. Sie war nicht in ihr Hotel zurückgekehrt, sondern hatte die Nacht mit Robert verbracht.
Sie wunderte sich ein wenig über sich selbst und ihren Mut, und jetzt, im Rückblick, erschien ihr immer noch alles als sehr ungewöhnlich.
Es war wie beim Anschauen eines Films, der einen zwar berührt, aber bei dem man doch Zuschauer bleibt - ohne Einfluss auf den Gang der Ereignisse.
Elsa dachte an die vergangene Nacht und lächelte still, ohne dabei die Augen zu öffnen. Ihre Hand ging zur Seite, aber da war nichts.
Robert war wohl schon aufgestanden. Sie setzte sich auf und rieb sich die Augen. Dann gähnte sie.
Draußen war es sonnig.
Sie schlug die Decke zur Seite, stand auf und trat ans Fenster, von wo aus sie einige Augenblicke lang die Aussicht auf das Meer genoss. Es war ein wunderbares Panorama.
Dann zog sie sich dann ein Hemd über und verließ das Schlafzimmer. Barfuß ging sie die Treppe hinab. Sie hörte Roberts Stimme, diese Stimme, nach deren Klang sie geradezu süchtig geworden war. Da gab es keine Entzugstherapie, die etwas dagegen tun konnte. Sie hätte es auch gar nicht gewollt.
Er telefonierte gerade.
Sie liebte den Klang dieser Stimme, so wie sie Robert liebte. Darin war sie sich absolut sicher.
Sie hörte ihn sprechen.
„Nein, das geht in Ordnung.“
Sie hatte nicht die geringste Ahnung, worum es ging.
„Bitte rufen Sie mich nicht mehr unter dieser Nummer an. Haben wir uns verstanden?“
Auf dem Treppenabsatz blieb sie stehen. Sie konnte der Versuchung, zu lauschen, einfach nicht widerstehen.
Ein wenig nur, dachte sie und hörte weiter zu.
„Bilden Sie sich nur nichts ein!“, sagte Robert eisig, und sie erschrak, als seine Stimme diesen Klang bekam.
Alles, was sie dann noch mitbekam, waren ein paar Fetzen, Wörter, die für Elsa nichts bedeuteten. Dann legte Robert auf.
Er hatte mit seinem Gesprächspartner Deutsch gesprochen, das fiel ihr noch auf.
Als sie weiter die Treppe hinunterkam, wirbelte er etwas überrascht - und wohl auch ärgerlich - herum.
„Was machst du da?“
„Nichts, ich...“
Sein Gesicht entspannte sich wieder.
„Schon gut“, meinte er.
Einen Augenblick lang zweifelte sie daran, dass wirklich alles in Ordnung war.
Robert war bereits vollständig angezogen und wohl auch schon geduscht. Er musste schon vor einer ganzen Weile aufgestanden sein, um... Ja, um was eigentlich?
Vielleicht seine Geschäfte...
Er nahm sie in den Arm.
„Ich habe gar nicht bemerkt, dass du aufgestanden bist“, meinte sie.
Er versuchte ein dünnes Lächeln.
„Du hast noch so fest geschlafen“, meinte er. „Wie ein Murmeltier! Ich wollte dich nicht wecken!“
„Das ist nett, aber du hättest es ruhig tun können!“
„Weißt du, wie spät es ist, Elsa?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Nein.“
„Fast zwölf.“
„Oh...“
„Was soll's! Du machst Urlaub hier, du hast das Recht, lange zu schlafen! Aber ich muss für meinen Lebensunterhalt sorgen!“
„Verstehe.“
Sie verstand es nicht, aber das schien ihr im Moment nicht weiter wichtig zu sein.
Plötzlich schlug er vor: „Wie wär's, wenn du deine Sachen aus dem Hotel holst! Oder willst du lieber weiter in diesem kalten, feuchten Zimmer ohne heißes Wasser wohnen?“
„Nein“, murmelte sie nachdenklich.
„Wenn du willst, kannst du eine Weile hier bleiben.“
„Gut.“
„Nachher fahren wir in die Stadt, um deine Sachen zu holen. Einverstanden?“
Sie war einverstanden.
„Ich weiß, es ist schon etwas spät dafür, aber... Soll ich uns etwas zum Frühstück machen?“
„Danke, mir nicht! Geh in die Küche, da steht alles schon fertig auf dem Tisch. Kaffee ist auch noch da.“
Bevor sie ging, war ein Mann eingetreten. Er war von draußen über die Terrasse gekommen, durch die Glastür, Es war ein Araber, so um die 50 und grauhaarig. Über den Lippen trug er einen buschigen, ebenfalls ergrauten Schnurrbart.
Elsa erschrak im ersten Moment. Sie hatte den Mann nicht kommen hören, und nun war er auf einmal da, als wäre er aus dem Nichts aufgetaucht.
„Das ist Aziz“, sagte Robert, als würde das irgend etwas erklären.
Für Elsa erklärte es nicht allzuviel. Aber immerhin wusste sie jetzt, dass der Mann auf irgendeine Art und Weise hierher, in dieses Haus gehörte.
Robert wechselte mit ihm ein paar Worte auf Arabisch. Dann verschwand Aziz auf demselben Weg, auf dem er so plötzlich ins Haus gekommen war.
„Was macht er hier?“, fragte Elsa.
„Aziz?“
„Ja.“
„Er kümmert sich um alles im Haus. Garten, Swimmingpool, Haushalt und so weiter. Seine Frau und seine beiden älteren Töchter kommen einmal die Woche zum Putzen.“
Elsa schien wirklich erstaunt.
„Du lebst hier wie ein Prinz“, meinte sie, und er lachte. Dann lachten sie beide.
„Manche Dinge, die anderswo sehr teuer sind, sind hier ausgesprochen günstig“, sagte er. „Zum Beispiel die menschliche Arbeitskraft.“
Nachdem Elsa etwas gefrühstückt hatte, nahmen sie den Landrover und fuhren nach Tanger, um Elsas Sachen aus dem Hotel Massilia zu holen.
Es war nicht viel. Soviel, wie in eine Reisetasche eben passt.
Sie verstauten die Sachen in den Landrover und schlenderten noch durch die Straßen.
Jetzt fühlte Elsa sich fiel sicherer. Sie hakte sich bei Robert unter und wusste, dass ihr nichts geschehen konnte. Sie erinnerte sich an das, was eine Freundin ihr einmal gesagt hatte, die drei Semester Psychologie hinter sich gebracht hatte, bevor sie auf Theologie umgestiegen war. „Du hast eine klassische Angstneurose, Elsa“, hatte sie ihr gesagt. Wenn ihr jemand mit solchen Dingen kam, war sie sehr schnell taub, und sie konnte sich auch kaum noch an Einzelheiten aus dem Redeschwall erinnern, der dann gefolgt war.
Eine graue Masse aus Fachwörtern. Hörte sich alles sehr gut an, war aber letztlich nur angelesen. Angstneurose...
Elsa musste unwillkürlich lächeln, als sie daran dachte. Jetzt, in diesem Augenblick und an Roberts Arm konnte sie darüber lächeln - über Dinge, die ihr sonst den kalten Angstschweiß über den Rücken trieben.
Die schwarzen Schatten der Depression, die ihrer Seele immer so empfindlich nahe gewesen waren, hatten sich verflüchtigt. Und ihre Ängste, von denen ein kleiner Teil ihres Inneren wusste, dass sie völlig unbegründet waren und die sie dennoch nie wirklich verlassen hatten - im Augenblick war von diesen unangenehmen, aber treuen Begleitern nirgends etwas zu sehen.
Sie bummelten zusammen durch die engen Gassen der Altstadt und später saßen sie am Strand. Ein paar Jugendliche spielten dort Fußball. Zum Baden war der Atlantik noch zu kalt.
Aber wenn auch das Wasser noch kalt war, die Sonne hatte bereits viel Kraft. 20 bis 25 fünfundzwanzig Grad erreichte sie leicht..
Als sie schließlich Hunger bekamen, gingen sie ins Hotel MARCO POLO, um etwas zu essen. Ein großes, unübersehbares Schild verriet, dass das MARCO POLO „unter deutscher Leitung“ stand - was immer das auch zu bedeuten haben mochte. Man hatte es wohl hingeschrieben, um die wachsende Zahl deutscher Touristen anzulocken.
„Ich bin hier schon vorbeigekommen“, erinnerte sich Elsa, als sie den üppigen Garten betraten, der das Gebäude umgab und den Gästen selbstverständlich zur Verfügung stand. Einige Bäume spendeten angenehmen Schatten.
„Es sieht teuer aus“, meinte sie nachdenklich.
Robert lachte nur.
„Alles ist relativ.“
„Was heißt das: 'Unter deutscher Leitung'?“
„Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sprechen die Kellner allesamt Deutsch. Und zwar ziemlich gut!“ Sie bekamen Fensterplätze im Obergeschoss, von denen sie eine hervorragende Aussicht hatten. Elsas Blick fiel auf die Gleise, die zum nahen Bahnhof gingen. Dahinter lag das Meer.
„Die Züge sehen ziemlich klapprig aus“, bemerkte sie. „Einige Wagen haben überhaupt keine Fenster.“ Ihr Gesicht wirkte nach innen gekehrt. „Ursprünglich hatte ich vor, mit dem Zug weiter ins Landesinnere zu fahren. Nach Casablanca.“
„Da wollen viele hin“, meinte Robert wie beiläufig. „Hauptsächlich wohl wegen des Films.“
Sie zuckte mit den Schultern.
„Ja, kann schon sein.“
„Bogart und Bergmann.“
„Kennst du den Film?“
„Wer kennt ihn nicht?“
„Die Schlussszene... Die spielt auf einem Flughafen. Im Nebel... Humphrey trägt seinen berühmten Trenchcoat...“
„Na und?“
„Ich habe immer gedacht: Das ist doch Unfug! Völliger Unfug! Ich meine, der Film ist zwar im Atelier gedreht, aber ein bisschen muss er sich doch auch nach der Realität richten, oder etwa nicht?“
„Und, tut er es denn nicht?“
„Doch, aber ich kannte die Realität nicht! Ich dachte an Nordafrika als ein Gebiet, in dem die Sonne scheint und es sehr warm ist. Nicht an Nebel und eine kalte Nacht, in der man einen Mantel braucht, so wie Bogie in dem Film. Aber der Irrtum lag bei mir. Jetzt weiß ich, dass es auch hier Nebel gibt - und nicht nur in London!“
„Casablanca ist nicht besonders zu empfehlen“, warf Robert ein.
„Meinst du den Film oder die Stadt?“
„Ich meinte jetzt die Stadt. Aber ich mag den Film auch nicht.“
„Warum nicht?“
Sie wechselten einen Blick miteinander, und zum ersten Mal schien ihm das unangenehm zu sein. Elsa hatte keine Ahnung, woran das lag.
Er blickte zur Seite und wich ihr so aus.
„Was willst du erst hören, meine Meinung zum Film oder zur Stadt?“
„Erst die Stadt“, verlangte Elsa.
„Das große Erdbeben von 1750 hat das meiste vom wirklich alten Casablanca vernichtet. Heute ist es eine Großstadt wie viele. Kaum etwas, was man nicht auch anderswo findet.“
„Und der Film?“
In diesem Moment kam der Kellner an den Tisch. Er sprach tatsächlich hervorragend Deutsch.
Robert bestellte für sie beide ein Mineralwasser, das den Namen „Sidi Harasem“ trug. Es stammte aus der Gegend und war weltberühmt.
Und sie nahmen beide einen „salade nicoise“.
„Deine Meinung zum Film, Robert“, hakte Elsa nach, als der Kellner sich wieder entfernt hatte. „Warum magst du den Film nicht?“
Er zuckte mit den Schultern. Sein Blick war nach innen gerichtet.
„Es geht um einen Mann, der vorgibt, ein Zyniker zu sein, und der sich dann aber am Schluss als Idealist entpuppt. Solche Stories mag ich nicht.“
„Warum nicht?“
„Sie überzeugen mich einfach nicht. Diese wundersamen Wandlungen... Vom Saulus zum Paulus. Nein, ich kann das nicht nachvollziehen. Es stimmt einfach nicht! Mit der Wirklichkeit hat das nichts zu tun, nicht das geringste!“
„Muss es das denn?“
Er zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß es nicht. Diese Sachen sind auch nicht mein Metier.“
„Was ist dein Metier?“
Sein Blick ging hinaus durch das Fensterglas. Dorthin, wo die Schienen lagen und die klapprigen Waggons ohne Fenster standen.
Er sah ins Nichts. Elsa spürte, dass er mit den Gedanken sehr weit weg war. Sehr weit...
Der Kellner brachte unterdessen das „Sidi Harasem“ und die Salate.
Vor dem MARCO POLO hielt ein Taxi und drei Amerikaner stiegen aus, ein Mann und zwei Frauen.
Elsa lachte unwillkürlich, als sie die drei aus dem Taxi steigen sah und als sie dann erschrocken die Hand vor den Mund nahm und sich umschaute, bemerkte sie, dass sie nicht die einzige war, bei der dieses Trio Heiterkeit auslöste.
Selbst das sonst so betont zurückhaltende Hotelpersonal konnte ein gewisses Schmunzeln einfach nicht unterdrücken.
Die drei sahen genauso aus, wie man sich typische Amerikaner in einer Karikatur vorstellt.
Der Mann war farbig.
In der Rechten trug er einen überdimensionalen Radiorecorder und auf dem Kopf einen riesigen, hellbeigen Cowboyhut. Das knallbunte Hawaiihemd und die grellen Bermudas bissen sich farblich wie Hund und Katze.
Aber das schien den Schwarzen nicht im geringsten zu stören. Er schien sich ohnehin nicht besonders um die Meinung irgendeines anderen Menschen zu scheren.
Obwohl sein Radio abgeschaltet war, machte er bereits auf der Straße einen ziemlichen Krach. Er sprach so laut, als hätte er eine Rolle in einem Freilichtspiel und wäre gezwungen, gegen kräftigen Wind bis zu seinem Publikum hinüber zu schreien.
Eine der beiden Frauen, die ihn begleiteten, war schlank. Gertenschlank, fast schon magersüchtig. Ihre Wangen waren hohl, das Kinn spitz - Ellbogen und Rippen vermutlich auch.
Die andere war das genaue Gegenteil. Sie war klein und fett.
Die Dünne war schwarz, die Dicke weiß.
Es dauerte nicht lange, und das Trio tauchte an einem der Nachbartische auf. Robert und Elsa waren nicht die einzigen, die sich dieses Schauspiel nicht entgehen lassen wollten. Alle Gespräche, auch unter den Angestellten, waren von einem Augenblick zum anderen verstummt.
Der Mann fläzte sich auf den Stuhl, setzte den Radiorecorder auf dem Boden auf und legte den großen Cowboyhut auf den Tisch. Er war so riesig, dass er ein gutes Drittel der Tischplatte einnahm.
„Hey, come here!“, rief er den Kellner heran. „I want spaghetti bolognese! Right now!“
Die dicke Frau wollte ebenfalls Spaghetti.
Die Dünne ein Stück Kuchen.
Und dann doch lieber Spaghetti. Und nach vier Sekunden, als der Kellner bereits den halben Weg bis zur Bar zurückgelegt hatte, wurde er noch einmal zurückgepfiffen. Keine Spaghetti, sondern Kuchen.
Als der arme Kellner bald darauf den Kuchen an den Tisch der drei brachte, durfte er ihn gleich wieder mitnehmen.
Die Dünne wollte jetzt nur noch ein Mineralwasser.
Die beiden anderen nahmen ihre Spaghetti in Empfang. Die Dicke schaufelte sich so viel hinein, dass ihr gleich wieder die Hälfte aus dem Mund fiel.
Der Mann stocherte lustlos auf seinem Teller herum und schob ihn dann zur Seite. Und während der ganzen Zeit machten sie Witze über den Kellner. Die Augen der dicken Weißen wurden dabei so klein, dass man kaum erkennen konnte, ob sie offen oder geschlossen waren. Die der schwarzen Dünnen quollen dafür noch mehr aus ihren Höhlen heraus, als sie es ohnehin schon taten.
Der Kellner wurde erneut herbeigerufen. Der Mann wollte jetzt ein Stück Kuchen und ein kühles Bier. Seine Spaghetti wurden abgeräumt.
Das Bier und der Kuchen kamen bald darauf, aber er schlürfte nur das Bier. In zwei Zügen.
Dann unterzog er den Kuchen einem äußerst kritischen Blick, verzog das Gesicht und reichte dann das Stück an die dünne Schwarze weiter.
Aber die verzog auch nur das Gesicht, nahm ein paar Krümel und reichte es schließlich an die dicke Weiße weiter, die inzwischen ihre Spaghetti restlos vertilgt hatte.
Das Stück Kuchen wäre für sie sicher auch kein unlösbares Problem gewesen, aber die Dünne war ziemlich ungeschickt. Das Kuchenstück fiel ihr vom Teller herunter auf den Boden, und dann hatte keiner mehr Appetit darauf.
Der Mann rief abermals den Kellner herbei und holte mit großer Geste ein riesiges Bündel Geldscheine heraus.
„Na, so viel hast du noch nie auf einem Haufen gesehen, was?“
Was sollte der arme Kerl darauf erwidern? Er machte gute Miene zum bösen Spiel. Und etwas anderes blieb ihm auch gar nicht.
Der Schwarze zählte laut und für alle im Raum vernehmlich das Geld ab. Ein gutes Trinkgeld war dabei.
Vielleicht ließ sich die offensichtliche Geringschätzung so besser ertragen...
Und dann waren die drei so schnell weg, wie sie gekommen waren. Wenig später hörte man von der Straße her das Gedudel des überdimensionalen Radiorecorders.
Die Erheiterung über das merkwürdige Trio brach sich jetzt endgültig Bahn. Sowohl unter den Gästen, als auch beim Personal konnte kaum noch jemand an sich halten vor Lachen.
„Wenn ich das zu Hause erzähle, glaubt mir das niemand“, meinte Elsa. Und dann war ihre Heiterkeit auf einmal wie weggeblasen, während alle anderen im Raum noch lachten.
Zu Hause... Der Gedanke machte sie traurig.
„Lass uns gehen, Robert“, meinte sie.
Er runzelte die Stirn.
„Warum?“
„Ich weiß nicht. Lass uns einfach von hier weggehen.“
„Gefällt es dir hier nicht?“
„Ich kann es dir nicht erklären, Robert.“
Er zuckte mit den Schultern.
„Gut, wie du willst.
4.
Die nächsten Tage und Wochen verflogen wie in einem Rausch. Elsa verbrachte ihre Zeit hauptsächlich damit, im Pool zu baden, sich in die kräftiger werdende Sonne zu legen und mit Robert in der Umgebung herumzufahren.
Sie machten Touren zu den alten Städten. Rabat, Fez, Marrakesch, wo sie ein paar Tage in einem Hotel blieben, und natürlich das unvermeidliche Casablanca.
Robert schien nichts zu tun zu haben, außer ihr Gesellschaft zu leisten. Keinerlei geschäftliche oder sonstige Verpflichtungen, nichts, was auch nur im entferntesten nach Arbeit aussah. Zunächst wunderte es sie ein wenig, dann genoss sie es einfach.
Robert wirkte wie ein Mann, der durch eine Erbschaft zu Reichtum gekommen war und nun nie wieder einen Finger krummzumachen brauchte. Eine Erbschaft, ein Volltreffer im Lotto, irgend etwas in der Art...
Elsa fragte ihn dann doch einmal nach seinen Geschäften, sie war einfach zu neugierig, und er meinte daraufhin, dass er mit ihr nicht darüber sprechen wollte.
„Vertraust du mir nicht?“
„Doch, damit hat das nichts zu tun.“
„Dann sag mir, womit es etwas zu tun hat!“
„Ich habe einfach keine Lust, über diese Dinge nachzudenken oder auch nur an sie erinnert zu werden.“
Und dann hatte er den Arm um sie gelegt und seine Hand war durch ihr dickes, braunes Haar geglitten. „Im Moment will ich nichts weiter, als mit dir zusammen zu sein und jeden Tag zu genießen.“
Und sie genossen jeden Tag. Es war ein rasanter Traum, wie die Fahrt auf einem Karussell - oder vielmehr: wie auf einer Achterbahn.
Es war Elsa instinktiv klar, dass das nicht ewig so weitergehen konnte, aber es gelang ihr erfolgreich, alle Gedanken an später erst einmal zu verscheuchen.
Je mehr Zeit verstrich, desto öfter dachte sie an zu Hause. Und dann fiel ihr wieder ein, dass es dieses Zuhause nicht mehr gab, jedenfalls nicht in der Form, in der sie es aus ihrer Kindheit kannte. Es gab nur noch ihren Vater und ihre Mutter. Das war alles.
Aber im Augenblick schmerzte sie das nicht mehr so schrecklich. Es wurde ihr etwas gleichgültiger, und das war gut so.
Vielleicht bin ich dabei, über die Sache hinwegzukommen, dachte sie.
Langsam, aber sicher rückte der Beginn des Sommersemesters näher. Es ging auf Ostern zu. Ursprünglich hatte sie dann wieder in ihren eigenen vier Wänden sein wollen. So hatte sie es geplant, aber jetzt war sie unschlüssig.
Sie hatte nicht die leiseste Ahnung, wie es weitergehen würde. Sie lebte einfach den Tag, den Augenblick, die Sekunde und wunderte sich dabei über sich selbst, wie schnell sie Roberts Ansicht verinnerlicht hatte, wonach nur das Hier und Jetzt von irgendeiner Bedeutung war.
Vielleicht war es so. Vielleicht auch nicht. Sie dachte nicht mehr viel darüber nach und wenn man es genau nahm, dann dachte sie kaum noch über irgend etwas nach, sondern zog es vor, einfach zu leben und zu genießen. Das zu können gab ihr ein bisher ungekanntes Gefühl von Freiheit und Glück.
Sie wollte, das es nie aufhörte. Eines Tages, als sie wieder einmal in der Stadt waren, hatte Elsa das Bedürfnis, ihre Mutter anzurufen. Sie ging ins Postamt, und wenig später hatte sie sie am Hörer.
„Mama?“
„Elsa! Du hast dich ja eine Ewigkeit lang nicht mehr gemeldet! Wo bist du?“
„Tanger, Marokko.“
„Immer noch?“
„Ja.“
„Wolltest du nicht schon längst auf dem Weg zurück nach Hause sein?“
„Ja, das stimmt...“
Elsa fühlte deutlich die Verkrampfung, die sie in dem Moment befallen hatte, als sie die Stimme ihrer Mutter am Hörer hatte. Sie hatte sich darauf gefreut, mit ihr sprechen zu können, aber jetzt fragte sie sich, ob es nicht ein Fehler gewesen war.
Doch nun war sie da auf der anderen Seite der Leitung, und es gab kein Zurück mehr.
„Wann beginnt das Semester, Elsa?“
Es war dieser unterschwellige Verhörton, den Elsa bei ihrer Mutter nicht mochte. Aber sie war es gewohnt, dennoch zu antworten.
Und genau das tat sie dann auch, obwohl sie es eigentlich nicht wollte, denn sie konnte es sich an zwei Fingern ausrechnen, in welche Richtung das Gespräch jetzt laufen würde. Genau dorthin, wo sie es nicht haben wollte.
Aber es war längst zu spät, um daran noch etwas ändern zu können. Sie wusste, dass alles seinen Gang nehmen würde und resignierte.
„Nach Ostern“, antwortete Elsa auf die Frage ihrer Mutter. „Genau einen Tag nach Ostern.“
„Wirklich kein freier Tag mehr zwischen Ostern und Vorlesungsbeginn?“
„Nein. Aber es macht nichts, wenn ich nicht rechtzeitig zurück bin. In der ersten Woche ist ohnehin noch nicht viel los...“
„Aber das ist doch keine Einstellung, Elsa!“
„Mama!“
„So etwas kenne ich gar nicht von dir... Du warst doch sonst immer so gewissenhaft.“
Elsas Mutter hatte Bluthochdruck und war ziemlich dick. Elsa konnte sich gut vorstellen, wie sie jetzt an ihrem Telefon saß und puterrot anlief.
Eigentlich hatte Elsa das vermeiden wollen, aber vermutlich wäre es ohnehin kaum zu verhindern gewesen.
Irgendwann musste ich mich ja mal wieder zu Hause melden, dachte sie.
Und sie hatte es ja wirklich schon eine geraume Weile vor sich hergeschoben.
„Wenn das dein Vater wüsste, dass du vorhast, nicht pünktlich zum Vorlesungsbeginn wieder zurück zu sein!“
„Es würde ihn kaum interessieren“, versetzte Elsa dann eine deutliche Spur schärfer im Tonfall, als sie es eigentlich beabsichtigt hatte. Ihre Mutter schwieg, und Elsa erschrak.
Sie hatte sie an ihrem wunden Punkt getroffen. Aber es war schließlich die Wahrheit. Die verdammte, bittere Wahrheit, und die war ihr in einem unbedachten Moment einfach so über die Lippen geflossen.
Ihre Mutter schien verletzt.
Und wenn schon, dachte Elsa trotzig, als auf der anderen Seite der Leitung noch immer kein Ton zu hören war. Es stimmt ja schließlich! Er interessiert sich nicht mehr für mich und auch nicht mehr für sie! Oder wie sollte man das interpretieren, wenn jemand zu Weihnachten nicht einmal eine Karte schickte? Er rief immer nur an, wenn sie vergessen hatte, ihm die Immatrikulationsbescheinigung zuzusenden, die er für seine Steuererklärung brauchte.
Immerhin kam sein Geld meistens pünktlich. Wenigstens in diesem Punkt war er zuverlässig. Aber in allen anderen Dingen hatte er sie verraten. So empfand sie das jedenfalls.
„Es war nicht so gemeint“, sagte sie dann, obwohl es nicht stimmte. Es war durchaus so gemeint gewesen. Genau so und nicht anders.
„Schon gut“, kam es gedämpft aus dem Hörer. „Geht es dir wenigstens gut?“
„Ja, es ging mir nie besser!“
„Hast du überhaupt noch Geld?“
„Ich komme aus!“
„Ich habe dir geschrieben. Hast du den Brief bekommen?“
„Nein, habe ich nicht.“
„Du hast nichts bekommen?“
„Nein, ich sag's doch!“
„Ich habe aber an die Adresse geschrieben, die ich von dir hatte. Dieses Hotel... Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen...“
„Da wohne ich schon lange nicht mehr.“
„Nein? Hat es dir nicht gefallen?“
„Doch, aber... Das ist kompliziert.“
„Wo wohnst du jetzt?“
„Bei Robert.“
Sie sagte es einfach so dahin, und dann war es heraus. Aber vielleicht war es gut so. Irgendwann musste sie es ohnehin erfahren. Besser früher als später...
Und wenn sie wirklich länger blieb, vielleicht sogar den ganzen Sommer hindurch und auf das Studium pfiff...
„Ich verstehe nicht...“
„Ich habe einen Mann kennengelernt. Und bei dem lebe ich jetzt.“
„Daher weht also der Wind!“
„Ja, daher weht der Wind, Mama!“
„Ich hoffe nicht, dass du deswegen dein Studium...“
„Nein, keine Sorge!“
Aber in Wahrheit war es genau das, woran sie gedacht hatte.
„Wie alt ist er? Was macht er?“
Elsa hatte keine Lust auf ein weiteres Verhör.
„Mama, es wird zu teuer für mich. Ich muss jetzt Schluss machen!“
„Ja, aber...“
„Tschüss!“
„Pass auf dich auf, Elsa. Wann höre ich wieder von dir?“
„Mal sehen. Wenn ich es einrichten kann.“
Elsa war froh, als der Hörer wieder in der Gabel hing. Sie fühlte sich wie befreit. Es war Abend.
Elsa legte den Kopf an Roberts Schulter und fand, dass er gut roch. Ihre Hand glitt über seine behaarte Brust. Sie spürte Roberts ruhigen Atem und seinen Arm an ihrem Rücken.
„Ich liebe dich“, murmelte sie. Und dann, nach einer kurzen Pause: „Hast du eigentlich gehört, was ich gesagt habe?“
„Ja.“
„Liebst du mich auch?“
„Ja.“
„Sex mit dir ist wunderbar. Ich glaube, ich könnte süchtig nach dir werden, Robert!“ Sie lachte. „Wahrscheinlich bin ich es längst.“
Dann schwiegen sie eine Weile.
Elsa schloss die Augen. Sie war glücklich.
Eine wohlige Müdigkeit hatte sich ihrer bemächtigt. Um ihre Lippen spielte ein entspannter Zug.
Dann schreckte sie plötzlich Roberts Stimme auf.
„Ich muss für einige Zeit weg“, sagte er.
Elsa war sofort wieder sehr aufmerksam. Sie setzte sich auf und blickte ihn verwundert an.
„Was?“
„Eine Geschäftsreise. Du wirst eine Weile allein hier wohnen, vorausgesetzt, du willst hierbleiben.“
„Natürlich will ich hierbleiben!“
„Musst du nicht irgendwann zurück nach Deutschland?“
„Warum?“
„Ich denke, du studierst...“
„Ich werde das Sommersemester aussetzen. Ich muss mir ohnehin über verschiedenes klarwerden, und vielleicht ist das eine gute Gelegenheit dazu.“
„Du meinst, du willst das Studium abbrechen?“
„Ich will damit sagen, dass ich noch nicht so genau weiß, ob ich das eigentlich will, was ich da tue...“
Die Wahrheit war viel einfacher. Sie wollte bei Robert sein. Jeden Tag, jede Sekunde. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass dieser Traum einmal zu Ende sein sollte. Nicht einmal der Gedanke an eine Unterbrechung war ihr erträglich.
„Du hast erwähnt, dass du fort müsstest, Robert...“
„Ja.“
„Für wie lange?“
„Vielleicht eine Woche. Plus minus ein paar Tage. Ganz genau kann ich das noch nicht sagen.“
„Wohin geht es?“
„Erst mal Madrid.“
„Könnte ich dich nicht begleiten?“
„Nein!“
In seinem Tonfall lag etwas Endgültiges. Sie wusste sofort, dass es keinen Zweck hatte, ein zweites Mal zu fragen. Er würde seine Meinung nicht ändern. Nicht nach diesem Nein; so gut kannte sie ihn inzwischen schon.
„Wann geht's los?“, fragte sie.
„Morgen.“
„Oh, morgen schon?“
„Ja.“
„Schade.“
„Es lässt sich nicht ändern, Elsa.“
„Ja, mag schon sein...“
„Irgend wovon muss dies alles hier, das Haus und so weiter, ja bezahlt werden. Und ab und zu muss ich halt auch etwas dafür tun.“
„Es ist trotzdem schade.“
„Ich komme ja wieder, Elsa!“
„Ich kann es schon jetzt kaum erwarten, obwohl du doch noch gar nicht weg bist und hier neben mir liegst!“
Sie bewegte sich wieder zu ihm hinunter und legte sich in seine Armbeuge.
Auf einmal begann sie zu frieren und zog die Decke bis zu den Schultern hoch.
5.
Am Morgen war Robert schon früh aufgestanden.
Undeutlich nahm Elsa wahr, wie er ein paar Sachen aus dem Kleiderschrank holte und in einen Koffer packte. Es dauerte ein bisschen, aber dann war sie hellwach.
„So früh?“
„Ja.“
„Willst du hier noch frühstücken? Ich könnte die Kaffeemaschine...“
„Nein. Dazu ist kaum noch Zeit. Hast du einen Führerschein?“
„Ja.“
„Dann lasse ich dir den Landrover hier.“
„Und du?“
„Ich rufe mir ein Taxi.“
„Wenn du meinst...“
„Ja.“
Er schloss den Koffer zu und verließ das Schlafzimmer. Sie hörte ihn die Treppe hinuntergehen, schlug die Bettdecke zur Seite und stand auf. Dann warf sie sich ein paar Sachen über und folgte ihm.
Als sie die Treppe hinabstieg, sah sie seinen Koffer, den er flüchtig abgestellt hatte. Darüber hatte er sein Jackett geworfen. Aus dem Wohnzimmer hörte sie Roberts Stimme beim Telefonieren. Er rief wohl gerade das Taxi, was sie allerdings nur vermuten konnte, denn er sprach Arabisch.
Sie wollte schon weitergehen und ihm ins Wohnzimmer hinein folgen. Dann fiel ihr Blick auf den Pass, der aus der Innentasche seines Jacketts ein Stück herausragte.
Elsa runzelte unwillkürlich die Stirn, sie glaubte ihren Augen nicht zu trauen. Dann zog sie mit einem schnellen Griff den Pass noch ein weiteres Stück aus der Tasche heraus und dann gab es keinen Zweifel mehr.
Sie hatte sich nicht getäuscht.
Es war nicht mehr der dänische Pass, den sie damals auf der Post gesehen hatte. Der Pass war britisch.
Elsa fuhr augenblicklich zusammen, als sie Robert herankommen hörte.
„Alles in Ordnung, das Taxi kommt gleich.“
Sein Blick war auf die Armbanduhr an seinem Handgelenk gerichtet. Dann sah er auf. „Ist irgend etwas?“
„Nein. Was sollte sein?“
„Ich meine nur. Du siehst aus, als wäre dir irgendeine Laus über die Leber gelaufen.“
„Nein, du irrst dich.“
Er zuckte die Schultern.
„Na gut.“
Er nahm seine Jacke und zog sie an.
Blitzlichtartig wirbelte ein halbes Dutzend Gedanken auf einmal in ihrem Kopf herum. Wie kam Robert an einen britischen Pass? Wozu brauchte jemand überhaupt mehrere Pässe? Sie hatte keine Gelegenheit gehabt, hineinzuschauen und wusste nicht, ob derselbe Name eingetragen war: Robert Jensen.
Vielleicht gibt es eine ganz simple Erklärung, dachte sie. Es gab ja schließlich so etwas wie doppelte Staatsbürgerschaften. Sie hätte ihn leicht fragen können, aber irgend etwas hielt sie davon zurück.
„Du brauchst dich um nichts zu kümmern. Aziz schaut vorbei und regelt alles. Er hat einen Schlüssel.“
„Gut.“
„Ich lasse dir genug Geld da, damit du über die Runden kommst.“
Wenig später kam das Taxi. Als Robert weg war, fühlte sie sich, als würde sie in ein großes, finsteres Loch fallen. Langsam begann ihr jetzt zu dämmern, wie sehr ihr Leben bereits um diesen Mann zu kreisen begonnen hatte.
Eigentlich hatte sie nichts dagegen. Eigentlich wünschte sie sich nichts anderes als genau das: um ihn zu kreisen wie ein Planet um seine Sonne.
Aber da war die Sache mit dem Pass. Und eine Ahnung von Misstrauen. Sie konnte nichts dagegen tun, es hatte begonnen, an ihrer Seele zu nagen, und sie konnte sich nicht dagegen wehren...
Unwillkürlich kamen ihr die Geschäfte ins Bewusstsein, mit denen Robert sein Geld verdiente... Viel Geld, wie auf der Hand lag. Sehr viel...
Was mögen das nur für Geschäfte sein?, dachte sie und zermarterte sich das Hirn. Am Ende gar Drogen oder etwas in der Art?
Robert hatte Elsa gegenüber bisher standhaft über die Herkunft seines Geldes geschwiegen.
Dann die Sache mit dem zweiten Pass... Wer, außer einem Mann, der seine Identität verdunkeln musste, brauchte mehrere! Es schien alles zusammenzupassen.
Elsa erschrak über ihre eigenen Gedanken. Mein Gott!, dachte sie. Das grenzt ja an Paranoia!
Sie sah ihren Traum bereits wie eine Seifenblase zerplatzen. Ein Teil von ihr weigerte sich, den Gedankengang zu Ende zu führen. Aber er ließ sich nicht einfach so aufhalten. Die Gedanken kamen wie von selbst, und sie konnte sie nicht stoppen.
Auf einmal hatte Elsa rasende Kopfschmerzen.
Elsa fühlte sich wie betäubt.
Ich lege mir da etwas zurecht, versuchte sie sich selbst einzureden.
Sie traute ihrer eigenen Wahrnehmung nicht so ganz. Sie erinnerte sich daran, dass sie sich früher oft verfolgt gefühlt hatte. Nicht nur, wenn sie in einsamen, finsteren Nebenstraßen einem nur als schattenhafter Umriss erkennbaren Unbekannten begegnete, sondern auch in ganz anderen Situationen. Im Kaufhaus zum Beispiel.
Eine Hälfte von ihr hatte immer gewusst, wie absurd das alles war und dass das alles nur ihrer Einbildungskraft entsprang. Die andere Hälfte zitterte vor Angst.
So ähnlich war es auch jetzt.
Sie ging hinauf ins Schlafzimmer, um in ihren Sachen nach Tabletten gegen die Kopfschmerzen zu suchen. Sie hatte immer so etwas dabei gehabt, seit sie 13 gewesen. Sie nahm die Tabletten, wenn sie Kopfschmerzen hatte, wenn ihre Regel im Anzug war - oder wenn sie sich ganz einfach schlecht fühlte.
Im Augenblick trafen alle drei Dinge auf einmal zu. Es war furchtbar.
Sie wühlte ihre Sachen durch, und schließlich fand sie, was sie gesucht hatte. Die Tabletten waren in der kleinen weißen Handtasche, die sie oft bei sich hatte.
Sie nahm ein paar, drei oder vier, und dann ging sie nebenan ins Bad, um sie mit etwas Wasser hinunterzuspülen.
Im Allgemeinen wurde davor gewarnt, das Leitungswasser unabgekocht zu trinken, aber das kümmerte sie im Augenblick nicht. Sie dachte überhaupt nicht daran.
Ihre Hand glitt die in Augenhöhe angebrachten Ablage entlang und suchte nach einem Zahnputzbecher, während sie eine Tablette bereits im Mund zerkaut hatte. Sie schmeckten scheußlich, und so verzog sie das Gesicht zu einer Grimasse.
Irgendetwas fiel ins Waschbecken. Es war ein Rasierapparat. Sie war ziemlich ungeschickt.
Dann hatte sie endlich den Becher, ließ ihn voll Wasser laufen und spülte nach. Und nach der nächsten Tablette wieder. Und dann noch einmal.
Als sie den Blick hob und den Rasierer zurück an seinen Ort legen wollte, sah sie ein paar Schminkutensilien, die ihr bisher noch nie aufgefallen waren.
Sie runzelte die Stirn. Für einen Mann in Roberts Alter war es nichts Außergewöhnliches, ein paar graue Strähnen im Haar zu haben. Und es war auch nichts dagegen einzuwenden, mit entsprechenden Mitteln etwas dagegen zu tun. Das galt für Männer ebenso wie für Frauen. Aber was Elsa hier vorfand, ging genau in die entgegengesetzte Richtung: eine graue Haartönung!
Ihr Interesse war jetzt erwacht, und trotz der Kopfschmerzen untersuchte sie sorgfältig, was sich da in Roberts Schrank befand.
Im ersten Moment hatte Elsa an eine Frau gedacht. Eine Frau, die vielleicht - ebenso wie sie selbst - Roberts Geliebte gewesen war und diese Sachen hier zurückgelassen hatte.
Aber bei näherem Hinsehen sah es dann wie etwas ganz anderes aus. Es schienen die Utensilien eines Clowns oder besser: eines Schauspielers zu sein, der sich mit Schminke maskierte.
In ihr begann es zu arbeiten. Wozu konnte Robert solche Schminkutensilien benötigen? Er machte nicht den Eindruck eines Mannes, der in seiner Freizeit in einer Laienspielgruppe mitarbeitete...
Ein Mann, der mehrere Pässe besaß, brauchte möglicherweise auch mehrere Gesichter!
Bestimmt gibt es für alles harmlose Erklärungen, hämmerte es verzweifelt in Elsas Kopf. Aber sie glaubte nicht daran. Ihr Instinkt sagte etwas anderes. Mit Robert war etwas nicht in Ordnung.
Und wenn er am Ende gar nur an einem Kostümfest teilgenommen hatte?
Es hat keinen Sinn, dachte sie.
Bis jetzt bestand alles nur aus Spekulationen. Ein Kartenhaus, das sich auf einen britischen Pass stützte, den sie flüchtig gesehen hatte und von dem sie nicht einmal mit Sicherheit sagen konnte, dass er Robert gehörte.
Vielleicht hatte ihn irgend jemand verloren, vielleicht hatte Robert ihn gefunden und eingesteckt, um ihn bei irgendeiner Stelle abzugeben. Und vielleicht war das Dokument dann einfach in seiner Tasche geblieben, weil er es vergessen hatte... Vielleicht, vielleicht...
Sie fasste sich an den Kopf. Ihr Daumen presste gegen die Schläfe. Mein Gott, dachte sie. Wie schnell wird aus einem Traum ein Alptraum!
Du redest dir etwas ein, durchfuhr es sie dann. Sie wusste nicht mehr, was sie glauben sollte und was nicht. Sie ging schleppend nach nebenan, ins Schlafzimmer und ließ sich ins Bett sinken. Ihren Kopf vergrub sie im Kissen.
Sie fühlte sich müde und zerschlagen, obwohl sie doch gerade erst aufgestanden war. Elsa wartete, bis das Mittel, das sie genommen hatte, endlich anfing zu wirken. Aber besonders gut fühlte sie sich trotz dem nicht. Später, als sie dann hinunter ins Wohnzimmer ging, stand die Tür zur Terrasse auf. Zunächst war sie etwas verwundert, aber dann sah sie Aziz durch das Fenster.
Er beugte sich hinunter zum Swimmingpool und hantierte mit einer kleinen Apparatur aus winzigen Glasröhrchen herum. Elsa blinzelte, aber sie konnte nicht erkennen, worum es sich handelte.
Sie trat hinaus.
„Guten Morgen“, sagte sie.
Aziz blickte auf. Ohne darüber nachzudenken, hatte Elsa ihn auf Deutsch begrüßt. Aziz antwortete ihr auf Englisch.
„Guten Morgen, Miss.“ Sein Englisch war akzentbeladen, aber dennoch gut verständlich.
„Was machen Sie da?“, fragte sie - nun ebenfalls auf Englisch. Sie hörte sich in der fremden Sprache reden, und ihre eigene Stimme klang fremd für sie.
„Ich überprüfe den pH-Wert“, erklärte Aziz. „So ein Pool braucht regelmäßige Wartung. Vielleicht muss ich etwas Chlor zusetzen...“
Aziz hantierte noch etwas herum, dann erhob er sich ächzend. Er schien fertig zu sein.
„Und?“, fragte sie.
„Und was?“
„Müssen Sie Chlor zusetzen?“
„Ja. Sonst ist bald alles grün, und der Pool wird zu einer einzigen, stinkenden Kloake!“
„Na, aber das dauert doch eine Weile, bis es so weit kommt, oder?“
„Das geht viel schneller, als viele Leute glauben. Zumal wenn die Sonne so scheint.“ Er deutete zum Himmel. „Wird heute wieder ein heißer Tag!“
„Ja“, murmelte Elsa nachdenklich. „Scheint so...“
Der Marokkaner wollte sich zum Gehen wenden, aber Elsa hielt ihn zurück.
„Aziz...?“
„Ja, Miss?“
„Ich darf Sie doch so nennen, ich meine...“
Er lachte. „Aziz ist mein Name. Warum sollten Sie mich nicht so nennen dürfen?“
„Wie lange arbeiten Sie schon für Robert?“
„Für Mr. Jensen? Schon sehr lange...“
„Wie lange?“
„Es werden jetzt bald drei Jahre, schätze ich.“
„Und seit wann ist Robert hier in Tanger?“
„Ich weiß es nicht, aber als ich hier angefangen habe, hatte er das Haus wohl noch nicht lange.“
Elsa machte eine unbestimmte Bewegung mit der Hand. „Er ist ein reicher Mann“, murmelte sie.
Und Aziz nickte. „Ja, sehr reich.“
„Was denken Sie über Robert?“
Aziz machte auf einmal einen ziemlich hilflosen Eindruck. In den Händen hielt er noch die Apparatur, die er zur pH-Wert-Bestimmung des Wassers gebraucht hatte. Er zuckte leicht mit den Schultern und lächelte etwas verlegen.
„Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll...“
Elsa kam in den Sinn, dass sie Aziz mit dieser Frage vielleicht überforderte. Schließlich lebte er von Robert... Aber sie bohrte dennoch weiter. Sie musste einfach mehr über den Mann erfahren, den sie liebte und in dessen Haus sie lebte.
„Sie werden doch sicher eine Meinung über einen Mann haben, für den Sie schon seit fast drei Jahren arbeiten!“
„Ich bin sehr zufrieden hier und kann mich nicht beklagen. Ich habe einen guten Job - und nicht nur ich, sondern auch meine Frau und meine Töchter. Sie kommen hierher zum Putzen. Wir alle verdanken Mr. Jensen viel.“
„Das meine ich nicht.“
„Dann verstehe ich Sie nicht.“
„Was ist er für ein Mensch?“
„Er ist sehr verschlossen, Miss.“
„Was heißt das?“
„Dass er nicht gerne mit anderen über seine Angelegenheiten redet! Aber ist das nicht auch sein gutes Recht? Alles in allem weiß ich nicht viel über ihn, obwohl ich schon seit drei Jahren fast täglich sein Haus betrete. Etwas merkwürdig ist das schon.“ Er zuckte mit den Schultern. „Er vertraut mir immerhin so weit, dass er mir seinen Haustürschlüssel überlässt.“
„Ich meine...“
„Hören Sie, vielleicht können wir uns ein anderes Mal ein wenig unterhalten, aber im Augenblick habe ich eigentlich alle Hände voll zu tun...“
Er wandte sich bereits halb um.
„Nur noch eins!“
„Was?“
„Womit verdient Robert sein Geld?“
„Das geht mich nichts an. Hat er es Ihnen nicht gesagt?“
„Nein.“
„Haben Sie ihn gefragt?“
„Schon, aber... Ich werde nicht schlau aus der Sache. Aus allem hier.“
„An diesen Zustand sollten Sie sich gewöhnen.“
„Weshalb?“
„Weil der Besitzer dieses Hauses einen gewissen Hang zur Geheimniskrämerei hat. Ich habe es aufgegeben, mich über irgend etwas zu wundern. Und Sie sollten dasselbe tun.“
„Ich weiß nicht...“
„Es ist ein Rat, mehr nicht.“
„Gut.“
„Stellen Sie sich eine Rose auf einem Misthaufen vor.“
„Eine Rose auf einem Misthaufen? Etwas merkwürdig, nicht?“
Aziz entblößte seine Zähne, als er ein breites Lächeln aufsetzte. „So etwas gibt es, Miss.“
„Wenn Sie es sagen.“
„Sie sollten sich an der Rose freuen, Miss - und nicht in dem Mist graben, auf dem sie gewachsen ist!“
Dann wandte er sich mit einer entschlossenen Bewegung um und ging davon.
6.
Vom Madrider Bahnhof Chamartin aus hatte Robert die Untergrundbahn genommen, war ein paar Stationen gefahren und dann an einer bestimmten Stelle ausgestiegen. Er kannte sich in Madrid aus, aber hier Ort - und vor allem in dem Hotel, vor dem er jetzt stand - war er noch nie gewesen.
Er hatte das extra so arrangiert.
Es sollte sich später niemand an ihn erinnern.
Das Hotel war eine Absteige, aber genau richtig für seine Zwecke. Man kümmerte sich in solchen Etablissements nicht besonders um die Gäste. Und ein Teil der Gäste schätzte das.
Die Fassade hätte eine Überholung dringend nötig gehabt, aber damit machte sie unter den anderen Gebäuden der Straße keine Ausnahme. Es war eine heruntergekommene Gegend.
Als Robert das schäbige, enge Foyer betrat, knarrte der Fußboden. An der Rezeption saß ein dicker Mann mit roter Trinkernase, der sich über eine Illustrierte beugte und Kreuzworträtsel zu lösen versuchte.
Robert trat näher, und blickte schließlich auf.
„Que quisiera, senor?“
Robert antwortete auf Englisch. British English. Der arroganteste Tonfall, den er hervorbringen konnte.
Und wie die meisten Briten erwartete auch Robert von seinem kontinentalen Gegenüber, dass er ihn verstand.
„Ich möchte ein Zimmer.“
„No problemo, senor! Ihren Passport bitte!“
Robert holte das Dokument aus der Jackentasche und schob es über den Tisch. Der Dicke mit der roten Nase holte ein Buch hervor und trug die Nummer des Passes ein. „Es Ingles, senor?“ Und dann, nach einer kleinen Pause, während der er gemerkt zu haben schien, dass er Spanisch gesprochen und sein Gegenüber ihn wahrscheinlich nicht verstanden hatte: „Engländer?“
„Machen Sie Ihre Arbeit, und lassen Sie mich in Ruhe!“, zischte Robert.
Aber der Dicke schien nicht gut genug Englisch zu sprechen, um das zu verstehen. „Hier den Portier zu spielen ist ganz schön langweilig. Kommen Sie aus London, Mister...“ Er blätterte in dem britischen Pass herum. „... McCord?“
„Nein.“
Robert nahm ihm das Dokument ziemlich grob aus der Hand. Der Spanier zuckte mit den Schultern und machte eine hilflose Geste. „Que va, senor! Was ist schon dabei!“
„Brauchen Sie noch etwas von mir?“
„Ja, eine Unterschrift.“
„Wohin?“
„Hier. Und dann hätte ich noch gerne, dass Sie für die nächste Nacht im voraus bezahlen. Das ist hier so üblich.“
„Nichts dagegen.“
„Wollen Sie Frühstück?“
„Wird das von Ihnen angerichtet?“
„Ja.“
„Dann lieber nicht.“ Robert bekam seinen Schlüssel. Nachdem er bezahlt hatte, ging er die Treppe hinauf zu den Zimmern.
„Zweite Tür links!“, rief der dicke Spanier ihm unfreundlich hinterher. Robert wandte sich nicht um.
Wenig später stand er vor einer Holztür, die mehrere unübersehbare Schrammen aufwies. Er drehte den Schlüssel, während aus einem der Nachbarzimmer das schrille Lachen einer Frau und das bierselige Grölen einer Männerstimme drang.
Robert trat ins Zimmer, warf den Handkoffer auf das Bett und sah sich um. Das Zimmer war passabel. Es gab sogar ein Telefon.
Robert nahm den Apparat vom Nachttisch und setzte sich neben seinen Koffer auf das Bett. Aus der Hosentasche holte er einen Zettel. Dann wählte er mit schnellen, sicheren Bewegungen eine Nummer.
Seine Rechte führte den Hörer zum Ohr.
Mit angestrengten, konzentrierten Zügen wartete er ein paar Augenblicke.
Dann: „Hallo?“ Eine kurze Pause. „Hier spricht das Chamäleon. Ich bin morgen um drei Uhr nachmittags im 'Parque del Buen Retiro'. Kommen Sie allein. Ich erkenne Sie daran, dass Sie ein Exemplar des 'New York Herald Tribune' bei sich tragen. Ich beschreibe Ihnen jetzt genauestens den Ort, an dem ich Sie sehen will! Schließlich ist der 'Parque' ziemlich groß. Hören Sie mir gut zu, ich habe keine Lust, mich zu wiederholen...“
Sonntag Nachmittag im „Parque del Buen Retiro.
Robert ließ vorsichtig den Blick umherschweifen. Was er sah, war alles andere als ungewöhnlich für diesen Ort und diese Tageszeit.
Familien mit Kindern spazierten durch die Parkanlagen. Manche von ihnen fütterten die Tauben, die überall zu finden waren und sich schon so sehr an die Menschen gewöhnt hatten, dass sie fast jegliche Scheu verloren hatten. Auf einer Bank saß ein alter Mann, der eine dicke Brille und eine Baskenmütze trug und angestrengt in seine Zeitung stierte. Wenige Meter entfernt spielten zwei kleine Jungs, vielleicht vier, fünf Jahre alt, im Sand. Es mochten Enkel oder gar Urenkel des Alten sein. Wenig später, als Robert sich auf eine freie Bank gesetzt hatte, rief der Alte die beiden Jungs herbei und holte für jeden eine Banane aus seiner abgenutzten Tasche.
Er selbst genehmigte sich eine Zigarre, hatte aber kein Feuer und sah sich dann etwas hilflos um. Da war noch ein junges Paar, das eng umschlungen dasaß und sich in mehr oder weniger regelmäßigen Intervallen leidenschaftlich küsste.
Der Alte hatte offensichtlich nicht die Absicht, die beiden zu stören, daher stand er auf und ging zu Robert. Er fragte ihn auf Spanisch nach Feuer.
Robert musste noch einmal nachfragen, um ihn richtig zu verstehen, was nicht an seinen mangelhaften Spanischkenntnissen, sondern an der Tatsache lag, dass der Alte ein Gebiss trug, das nicht richtig saß.
Robert hatte kein Feuer, und er sagte das dem Alten auch in dem besten Spanisch, das er hervorzubringen in der Lage war. Er sei Nichtraucher, erklärte er ihm. Wozu also Streichhölzer oder ein Feuerzeug?
Robert hoffte, dass das Gespräch damit zu Ende wäre, aber er hatte sich getäuscht. Der Alte schien auf einen kleinen Plausch aus zu sein und nahm die Sache zum Anlass, einfach draufloszureden.
Robert verstand einen Großteil gar nicht, aber das schien den Alten auch nicht zu interessieren. Sein Mund bewegte sich unaufhörlich, sein Gebiss rutschte auf und nieder.
Robert warf einen nervösen Blick auf die Uhr. Kurz vor 15.00 Uhr.
Dann machte er dem Alten den Vorschlag, doch die beiden jungen Leute zu fragen. Er habe den Mann Zigarette rauchen sehen. Das stimmte zwar nicht, aber er musste den Alten jetzt irgendwie loswerden.
Der Alte schien nicht genug Mut aufzubringen, um die beiden eng Umschlungenen zu fragen. Also fragte Robert sie.
Der junge Mann hatte kein Feuer, aber dafür das Mädchen. Robert war gerettet. Der Alte zündete sich eine dicke Zigarre an und versuchte nun, den beiden jungen Leuten ein Gespräch aufzuzwingen. Es entstand ein kurzer Wortwechsel.
Dann kam von den beiden Kleinen ein Geschrei. Die beiden Jungen waren in Streit miteinander geraten und bewarfen sich nun mit Händen voll Sand.
Der Alte musste sehen, dass er schleunigst an den Ort des Geschehens zurückeilte. Er schimpfte noch lauter, als die beiden Kleinen schreien konnten, und damit war die Sache dann erst einmal entschieden.
Der Alte setzte sich wieder auf seine Bank, zog an seiner Zigarre und wischte mit einem Taschentuch seine Brillengläser sauber, bevor er wieder in die Zeitung blickte.
Fast zur gleichen Zeit sah Robert einen etwas übergewichtigen Mann mit dunklem Oberlippenbart herankommen. Unter dem Arm trug er eine Ausgabe des „New York Herald Tribune“. Robert ließ sich nichts anmerken. Er wollte erst einmal abwarten.
Schließlich musste er sichergehen, dass der Mann auch tatsächlich allein gekommen war, wie Robert es gefordert hatte.
Der Mann mit dem Oberlippenbart setzte sich, nachdem er den Blick ausführlich hatte kreisen lassen, auf eine freie Bank. Es war die Bank, auf der das junge Paar gesessen hatte.
Die beiden waren Arm in Arm weitergegangen. Robert sah sie in einiger Entfernung Tauben füttern, und manchmal lachte die Frau so laut und hell, dass er es hören konnte.
Robert blickte sich um. Der Mann, mit dem er sich treffen wollte, schien tatsächlich, wie abgemacht allein gekommen zu sein.
Indessen hatte der Alte seine Sachen zusammengepackt und ging mit den beiden Kleinen davon.
Einer der Jungen versuchte, eine Taube zu streicheln und lief hinter ihr her. Die Jagd hatte erst ihr Ende, als der Kleine stolperte und hinfiel.
„Sie sind Mendez?“, fragte Robert.
Der Mann mit dem Oberlippenbart und dem „Tribune“ wandte sich zu ihm um.
„Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie das Chamäleon sein könnten.“
Wie selbstverständlich sprachen sie Englisch. Robert schien ein wenig ärgerlich zu sein.
„Ich fragte, ob Sie Mendez sind!“
„Nein.“
„Dann weiß ich nicht, was wir miteinander zu bereden hätten. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag, Sir!“
Robert wandte sich ab, um zu gehen.
„Mein Name ist Garcia“, sagte der Mann. Garcia!, dachte Robert. Der Name war aller Wahrscheinlichkeit nach falsch. Er war einfach zu gewöhnlich. Aber das interessierte Robert jetzt nicht weiter. Er wandte sich noch einmal zu dem Mann, der sich Garcia nannte und meinte sarkastisch: „Sie hätten ein bisschen mehr Phantasie aufbringen können, finden sie nicht auch?“
„Inwiefern?“
„Bei Ihrem Namen. Im Madrider Telefonbuch gibt es seitenweise Garcias. Sie hätten sich etwas Originelleres einfallen lassen können.“
„Auf Originalität kommt es in meinem Gewerbe nicht an.“
„In meinem manchmal schon.“
Robert wandte sich erneut rum und hatte bereits zwei Schritte hinter sich gebracht, da hörte er Garcia rufen: „So warten Sie doch! Mendez hat seine Gründe, dass er nicht persönlich kommen konnte!“
Robert kümmerte sich nicht darum, sondern ging einfach weiter. Er drehte sich auch nicht um, als er hinter sich Garcias Schritte hörte.
Garcia hatte ihn bald eingeholt. Auf Grund seines Übergewichts war er allerdings ziemlich außer Atem. Er wollte etwas sagen, aber zunächst kam nichts über seine Lippen.
„Ich spreche nur mit Mendez persönlich“, stellte Robert klar. „Bestellen Sie ihm das!“
„Mendez lässt Sie grüßen!“
„Dafür kann ich mir nichts kaufen...“
„Es ist besser, wenn man Sie und Mendez nicht zusammen sieht.“
Robert verzog das Gesicht.
„Besser für ihn oder besser für mich?“
„Für Sie beide. Wenn eine Spur von Mendez zu Ihnen führt, könnte sie auch wieder zurück zu Mendez führen.“
„Ich bin kein Anfänger! Zu mir hat noch nie irgendeine Spur geführt!“
„Jedenfalls ist es das Beste, wenn kein Zusammenhang zwischen Ihnen und Mendez sichtbar werden kann.“
Garcia holte dann einen braunen Umschlag aus der Innentasche seiner Jacke hervor, blickte sich sorgfältig nach allen Seiten um und gab ihn dann dann.
„Machen Sie das nicht ein wenig auffällig?“, murmelte Robert, während er den Umschlag wie beiläufig einsteckte. „Wenn ich mir das Material angesehen habe, werde ich Mendez anrufen und ihm meinen Preis sagen.“
„Gut.“
„Sonst noch etwas?“
„Nein. Das heißt...“
„Was?“
„Mendez sagt, es darf nicht danebengehen. Es hängt viel davon ab und...“
„Keine Einzelheiten, bitte. Ich will das gar nicht wissen.“
„Wie Sie wollen.“ Garcia zuckte mit den Schultern. „Mendez will Sie, weil er Sie für den Besten hält!“
„Das bin ich auch!“
„Er kann es sich nicht leisten, dass Sie versagen!“
„Das werde ich auch nicht, Garcia - oder wie immer Ihr Name auch sein mag.“
„Das ist gut.“
„Auf Wiedersehen.“
Sie gingen jeder ihrer Wege, und keiner von ihnen drehte sich noch einmal um. Robert schlenderte durch den Park und kickte dabei ein paar kleine Steinchen vor sich her. In seiner Jackentasche fühlte er den Umschlag.
Er würde sich den Inhalt später ansehen, wenn er wieder im Hotel war. Gedankenverloren schlenderte er weiter, so als wäre er irgendeiner der vielen Menschen, die hier nichts weiter taten, als ihren Sonntagnachmittag zu verbringen.
Er dachte an Elsa. Nur einen ganz kurzen Augenblick, aber dass er es jetzt überhaupt tat, sprach schon für sich.
Es konnte nicht für ewig sein, das war klar.
Aber strenggenommen ging es bereits viel zu lange. Die Sache musste beendet werden, doch Robert hatte wenig Neigung dazu.
Es scheint ganz so, als hätte es mich erwischt, dachte er stumm.
Ein quietschendes Saxophon riss ihn aus seinen Gedanken. Er blickte hoch und sah einen bärtigen Enddreißiger, der eine etwas eigenwillige Interpretation von „Take Five“ gab.
Roberts Rechte fuhr in die Hosentasche und suchte nach Geld.
In der Tasche waren nur Scheine. Er nahm einen und legte ihn dem Musiker in den aufgeklappten Saxophonkoffer, in dem bisher nur Münzen waren.
Dann machte sich Robert auf den Rückweg zu einem Hotel.
Es war bereits dunkel, als Robert noch einmal sein Zimmer verließ. Den Portier, der jetzt an der Rezeption Dienst hatte, kannte er noch nicht. Rund um die Uhr hing irgend jemand hinter dem Tresen, aber die meisten waren Aushilfskräfte, die den Job nur kurze Zeit machten.
Wahrscheinlich kannten sie sich gegenseitig kaum oder überhaupt nicht. Und vermutlich hatte auch kaum einer von ihnen einen Überblick über die Gäste.
Robert grinste matt, als er sah, dass der Portier, der im Augenblick Dienst hatte, den Kopf auf den Tresen gelegt hatte und laut und vernehmlich schnarchte.
Das ist es, was an diesem Hotel so liebenswert ist, dachte er nicht ohne Sarkasmus. Er ging an dem Schlafenden vorbei, ohne ihn zu wecken und ohne den Zimmerschlüssel zu hinterlegen. Einen Moment später befand er sich dann bereits draußen.
Die Luft war jetzt besser und frischer als am Tag. Er atmete tief durch.
Er schlenderte ein bisschen die Straße entlang, scheinbar ziellos. Er sah ein paar kleinere Geschäfte, die mit massiven Metallgittern verbarrikadiert waren. In einer Bar war noch Leben.
Als Robert durch die Tür kam, musste er einigen schwankenden Gestalten ausweichen, die offensichtlich nicht mehr ganz Herr ihrer Bewegungen waren.
In der Bar lief ein Fernseher mit dröhnender Lautstärke, obwohl niemand hinzusehen schien. Ein paar Männer konzentrierten sich auf ein gutes Dutzend bunter Kugeln, die auf einem Billardtisch hin und her schossen.
Robert wandte sich an den Mann hinter dem Schanktisch, der große, hervorquellende Augen hatte und ziemlich müde wirkte. Robert fragte ihn nach einer Telefonzelle. Der Mann hinter dem Schanktisch wusste aber offensichtlich nicht Bescheid und wandte sich seinerseits an die Männer am Billardtisch. Die konnten Robert weiterhelfen.
Wenig später war Robert wieder draußen auf der Straße. Die Beschreibung, die er bekommen hatte, war einigermaßen präzise, und so ging er eiligen Schrittes um eine Straßenecke und dann um noch eine, und dann war die Zelle zu sehen.
Robert suchte seine Münzen zusammen, wählte eine Nummer und nahm den Hörer ans Ohr.
„Mendez?“
Eine kurze Pause.
Dann: „Ich nenne Ihnen jetzt meinen Preis. Ich habe mir das Material genau angesehen, das mir Ihr Kurier übergeben hat. Die Sache ist machbar, aber nicht ganz billig.“
„Wie viel?“, kam es knapp aus dem Hörer.
„100 000. Das ist mein Preis.“
Auf der anderen Seite der Leitung herrschte ein paar Augenblicke lang ein Schweigen, das unterschiedlich interpretiert werden konnte.
„Ich schätze, Sie sprechen nicht von 100 000 Peseten!“
„Nein, Schweizer Franken. Die Hälfte davon im voraus.“
„Wie soll die Geldübergabe vonstatten gehen? Ich könnte sogar eine Barzahlung arrangieren. Ich habe eine schwarze Kasse...“
„Nein, kein Interesse. Überweisen Sie die ersten 50 000 in den nächsten Tagen auf mein Konto in Zürich. Ich gebe Ihnen die Nummer gleich durch. Die zweite Hälfte ist dann bei Erledigung fällig.“
„Sie verlangen ein hohes Maß an Vertrauen von mir, finden Sie nicht auch?“
„So sind meine Geschäftsbedingungen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, suchen Sie sich jemand anderen.“
„Schon gut. Wann treten Sie in Aktion?“
„Sobald Sie das Geld eingezahlt haben. Aber Sie sollten sich damit nicht allzuviel Zeit lassen.“
„Gut. Ich werde das gleich morgen früh veranlassen. Geben Sie mir jetzt die Nummer durch!“
Robert gab die Nummer durch und hängte dann den Hörer ein. Wenn alles gutging, würden sie nie wieder voneinander hören, er und Mendez. Robert trat aus der Telefonzelle heraus und atmete tief durch. Jetzt hieß es erst einmal abwarten, bis Mendez das Geld überwiesen hatte. Aber in der Zwischenzeit konnte er bereits ein paar Vorbereitungen treffen.
7.
Elsa war mit dem Landrover nach Tanger gefahren.
Eigentlich hatte sie nicht das geringste Verlangen danach, von Menschen umgeben zu sein. Im Geiste sah sie sich bereits von aggressiven Händlern und bettelnden Kindern umringt.
Sie dachte kurz an das Erlebnis am Strand, als die drei Marokkaner es auf sie abgesehen hatten... Die Erinnerung genügte völlig, um ein Gefühl der Beklemmung in ihr auszulösen.
Elsa hatte auch erwogen, gar nicht in die Stadt zu fahren, aber dann war ihr klargeworden, dass sie unbedingt fahren musste, schon um nicht völlig den Verstand zu verlieren.
Der Pass, die Schminkutensilien, Robert...
Alles drehte sich in ihrem Hirn wild durcheinander. Verzweifelt versuchte sie, einen Sinn in die Sache hineinzubringen. Aber wie sie es auch drehte und wendete: Was dabei herauskam, gefiel ihr nicht.
Sie trat energisch auf das Gaspedal, und der Landrover fegte rasant durch die Kurve. Ein klappriger, uralter Citroen kam von vorne und musste ein paar Meter ausweichen. Der Fahrer hupte und zeigte ihr einen Vogel.
Verdammt! Elsa ärgerte sich.
Sie musste sich mehr auf den Verkehr konzentrieren. Sie durfte ihre Gedanken nicht einfach so davontreiben lassen.
Geschäfte!, dachte sie bitter. Geschäfte, über die er nicht reden wollte! Was konnte dahinter stecken? Drogen? Irgendeine Scheußlichkeit?
Vielleicht sollte ich ihn zur Rede stellen, wenn er wieder zurück ist; überlegte sie. Dann würde es sich ja herausstellen.
Möglicherweise war alles ganz harmlos und es gab vernünftige Erklärungen für das, was Elsa jetzt noch schlaflose Nächte bereitete. Und wenn nicht? Elsa wagte nicht, daran zu denken.
Unterdessen hatte sie die Stadt erreicht. Sie stellte den Landrover in einer Seitenstraße ab und stieg aus. Sorgfältig verschloss sie den Wagen.
Als sie sich noch einmal umdrehte, sah sie ein paar Jungen, die sich um den Landrover geschart hatten.
Sie stierten ihn an, als wäre er ein exotisches Tier. Wenig später erreichte Elsa eine der belebteren Geschäftsstraßen des modernen Tanger. Sie kam bei einem Zeitungsverkäufer vorbei und nahm ihm ein paar Blätter ab. Es gab sogar deutsche Zeitungen. Sie klemmte sie unter den Arm und bezahlte. Als sie ein paar Schritte weitergegangen war, trat ihr jemand in den Weg.
Es war ein unrasierter, dunkelhaariger Mann mit schiefen gelben Zähnen und einem ziemlich abgewetzten Jackett. Dazu trug er Turnschuhe, die wohl irgendwann einmal weiß gewesen waren.
Er fragte Elsa zuerst auf Französisch und dann auch sicherheitshalber auf Englisch, ob sie an Haschisch interessiert sei. Elsa verneinte.
Nein, sie habe kein Interesse und wollte damit auch nichts zu tun haben. Sie versuchte, an ihm vorbeizugehen, aber er stellte sich ihr erneut in den Weg. Er sah sich kurz um und öffnete sein Jackett, um ihr sein Sortiment zu zeigen.
„Are you interested?“
„No!“
Sie ging energisch an ihm vorbei und machte dann ein paar schnelle Schritte, ohne sich dabei umzudrehen. Hinter sich hörte sie, wie er ihr folgte. Er schien noch immer nicht aufgegeben zu haben.
In einiger Entfernung sah sie dann einen Polizisten, der an seiner gebügelten Uniform herumzupfte und sich wohl furchtbar wichtig vorkam.
Sie drehte sich zu ihrem Verfolger herum und er begann erneut, auf sie einzureden. Aber sie drohte mit der Polizei, und das wirkte. Er ließ von ihr ab und schlich sich wie ein getretener Hund davon. Auch er hatte den vornehmlich mit seiner Uniform beschäftigten Beamten gesehen.
Der Polizist schlenderte heran und spielte dabei mit seinem Schlagstock.
Elsa registrierte mit Genugtuung, dass das den Abgang ihres Verfolgers noch ein wenig beschleunigte. Er machte ein paar rasche Schritte, warf noch einen unsicheren Blick zurück und war bald darauf hinter einer Straßenecke verschwunden.
Elsa atmete auf. Denken die eigentlich von jedem blassgesichtigen Europäer oder Nordamerikaner, dass er Drogen konsumiert?, fragte sie sich, während sie innerlich den Kopf schüttelte.
Später ging sie noch ins MARCO POLO, um etwas zu essen. An einem der Nachbartische saßen drei Marokkanerinnen, allesamt europäisch gekleidet, vornehmlich in Leder. Eine von ihnen trug sogar einen Minirock.
Elsa musste unwillkürlich an die bis zu den Augen verschleierten Frauen denken, die man ebenfalls in Tanger antreffen konnte.
Die drei Frauen schienen viel Spaß miteinander zu haben. Sie kicherten unentwegt. Elsa verstand kein Wort von dem, was sie sagten, aber dennoch hörte sie ihnen fasziniert zu.
Als sie später wieder in dem Landrover saß und zurück zu Roberts Haus fuhr, erfüllte sie ein zwiespältiges Gefühl, von dem sie nicht so recht wusste, was sie davon zu halten hatte.
Sie hatte sich etwas beruhigt, was sie für ein gutes Zeichen hielt. Aber die düsteren Schatten, die ihr Inneres schon den ganzen Tag mehr oder weniger im Griff gehabt hatten, waren noch da. Sie lauerten im Hintergrund, wie Schauspieler, die nur auf ihr Stichwort warteten, um sich auf der Bühne zu zeigen.
Elsa fuhr sehr schnell. Der Motor des Landrovers heulte laut auf, während sich ihre Gedanken wieder in atemberaubendem Tempo zu drehen begonnen hatten.
Elsa stand vor einem Abgrund aus Depressionen, und sie wusste das. Schließlich war es nicht das erste Mal, aber früher waren die Anlässe geringfügiger gewesen.
Die Stadt, die Menschen, selbst der Haschischhändler, das alles hatte sie für kurze Zeit etwas abzulenken vermocht. Aber nun war sie wieder allein mit sich und ihren Gedanken.
Es war schon später Nachmittag, als sie den Wagen vor Roberts Haus parkte. Sie schloss die Haustür auf, und mit ein paar Schritten war sie im Wohnzimmer. Die Zeitungen, die sie mitgebracht hatte, flogen auf den niedrigen Tisch.
Aus den oberen Räumen hörte sie Stimmen. Frauenstimmen. Sie schwatzten schier ohne Unterlass auf Arabisch und lachten zwischendurch hell.
Aziz' Frau und seine Töchter, dachte Elsa. Wenig später kam eine der Frauen die Treppe herunter und dann Wohnzimmer. Sie grüßte sehr höflich.
Elsa nickte ihr zu. Es gab keine Möglichkeit für sie, sich mit ihr zu verständigen. Die Frau sprach nur ihren eigenen arabischen Dialekt, sonst nichts.
Die beiden anderen Frauen kamen auch die Treppe herunter. Als auch sie das Wohnzimmer betraten und ihr Blick auf Elsa fiel, schwiegen sie augenblicklich. Am nächsten Tag hatte Elsa das Gefühl, dass Aziz ihr auszuweichen versuchte.
Er erledigte seine Pflichten so gewissenhaft wie immer, aber er schien deutlich darauf bedacht zu sein, sich nicht zu lange in Elsas Nähe aufzuhalten. Manchmal, wenn sie in seine Richtung sah, wich er ihrem Blick aus.
Elsa ließ das gestrige Gespräch noch einmal Revue passieren. Sie hatte Aziz nach Strich und Faden ausgefragt, und vielleicht gefiel ihm das nicht. Aber Elsa wollte noch mehr wissen.
Schließlich erwischte sie ihn, als er sich in der Küche eine Tasse Kaffee aufbrühte.
„Ich möchte Sie gerne noch etwas fragen, Aziz... Vorausgesetzt, Sie haben nichts dagegen...“
Er murmelte etwas Unverständliches vor sich hin. Dann meinte er mit gespielter Gleichgültigkeit: „Was sollte ich dagegen haben?“
Elsa zuckte mit den Schultern. „Hätte ja sein können!“
Er sah sie jetzt offen an und forderte: „Also, was wollen Sie wissen?“
„Haben in diesem Haus schon andere Frauen gelebt - mit Robert zusammen?“
Aziz war deutlich anzumerken, wie unangenehm ihm die Frage war. Wahrscheinlich bereute er seine Bereitwilligkeit schon wieder.
„Ich weiß nicht...“
„Ich möchte, dass Sie offen zu mir sind, Aziz!“
„Wollen Sie das wirklich wissen?“
„Ja!“ In ihrer Stimme klang ein hohes Maß an Entschlossenheit mit, dass ihr Gegenüber ein wenig zu überraschen schien.
„Ich verstehe, dass Sie das interessieren muss...“ Aziz versuchte sich zu drehen und zu wenden, aber Elsa ließ nicht locker.
„Es hat Vorgängerinnen gegeben, nicht wahr?“
„Ja.“
Als er das sagte, sah er sie nicht an. Es schien ihm peinlich zu sein. Vielleicht hatte er auch ein wenig das Gefühl, den Mann, für den er arbeitete zu verraten.
„Sie kennen Mr. Jensen doch jetzt eine ganze Weile“, meinte er dann. „Warum fragen Sie ihn nicht all die Dinge, die Sie mich fragen?“
Elsa ging nicht darauf ein. „Was waren das für Frauen?“, erkundigte sie sich.
„Meistens Europäerinnen, die wie Sie hierher kamen, um sich das Land anzusehen und sich zu amüsieren. Es hat nie lange gedauert.“
„Aber sie haben hier gewohnt.“
„Manche. Und auch höchstens für ein paar Tage, maximal eine Woche. Solange wie Sie ist keine geblieben. Ich weiß nicht warum. Es geht mich auch nichts an.“
Elsa überlegte.
Sie hatte realistischerweise nicht erwarten können, die erste oder gar einzige Frau in Roberts Leben gewesen zu sein. Er war schließlich 38, wenn man seinem Pass glauben konnte. Wenn...
Plötzlich fragte sie sich, ob in dem britischen Pass wohl dasselbe Geburtsdatum eingetragen war, wie in dem dänischen, in den sie hineingeschaut hatte.
Es war nur ein Gedanke, aber das, was eigentlich dahintersteckte, war die Frage, was an diesem Mann tatsächlich so war, wie es zu sein schien.
Elsa sah, wie Aziz die Kaffeetasse abstellte. Er würde die nächste Gelegenheit nutzen, um ihr wieder zu entwischen, soviel war ihr klar.
„Seit wann geht das so?“, wandte sie sich an ihn, bevor Gelegenheit dazu bekam, die Küche zu verlassen.
Er schien nicht recht zu verstehen.
„Was?“
„Dass Robert – Mr. Jensen - mit keiner Frau länger als eine Woche zusammengelebt hat!“
„Solange ich für ihn arbeite. Also seit annähernd drei Jahren. Vielleicht hat er irgendwo anders noch eine Beziehung unterhalten, die länger andauerte.“
„Warum nehmen Sie das an?“
„Ich nehme es nicht an, ich sage nur, dass es vielleicht möglich wäre.“
„Weshalb?“
„Weil ihr Ausländer im allgemeinen eine lockere Moral in diesen Dingen habt. Lockerer jedenfalls, als es hierzulande üblich ist.“
„Verachten Sie Robert deswegen nicht?“
„Nein. Jeder muss selbst wissen, was er tut.“ Er zuckte mit den Schultern. Elsa glaubte nicht, dass er diese Weisheit dem Koran entliehen hatte. Dann meinte er: „Mr. Jensen bezahlt mich gut für meine Arbeit. Wie könnte ich ihn da verachten?“
Das war ein deutlicher Hinweis darauf, wem im Zweifelsfall seine Loyalität gehörte.
„Hat Robert eigentlich irgendwelche Freunde? Bekannte, mit denen er sich trifft?“
Die Frage war einer plötzlichen Eingebung entsprungen, und ehe sie darüber nachgedacht hatte, war sie auch schon heraus gewesen.
Die ganze Zeit über, in der sie nun schon mit Robert zusammenlebte, hatte er sie nie irgend jemandem vorgestellt. Es hatte sie nicht gestört. In ihrem Rausch aus blinder Verliebtheit hatte sie ohnehin kein Verlangen nach anderen Menschen gehabt. Roberts Gesellschaft hatte ihr vollkommen genügt, und so war ihr nicht aufgefallen, dass sie beide wie auf einer Insel gelebt hatten.
„Wie soll ich die Frage verstehen, Miss?“ Elsa zuckte mit den Schultern. „Am besten so, wie ich sie gestellt habe. Was ist unklar daran? Ich meine, er lebt hier schon seit ein paar Jahren. Er muss doch irgendwelche Bekannte haben! Leute, mit denen er sich trifft...“
Er machte eine hilflose Geste.
„Ich weiß es nicht, Miss. Am besten, Sie fragen ihn selbst und lassen mich jetzt wieder meine Arbeit tun!“
Dann ging er an ihr vorbei.
Ja, dachte sie, sie würde Robert eine Menge Fragen zu stellen haben, sobald er zurückgekehrt war. Die nächsten Stunden verbrachte Elsa mit der Lektüre ihrer Zeitungen, die sie aus der Stadt mitgebracht hatte. Aber sie überflog nur die Überschriften und blätterte lustlos die Seiten hin und her.
Sie war mit den Gedanken nicht bei dem, was vor ihr lag. Sie dachte an Robert und fragte sich zum tausendsten Mal, was sie von diesem Mann eigentlich halten sollte.
Sie liebte ihn, dass schien ihr das einzige zu sein, woran es keinen Zweifel gab.
Ist es nicht im Grunde genommen gleichgültig, wer oder was er ist?, fragte sie sich. Mit der Hand fuhr sie sich nervös über das Gesicht.
Durch die offenstehende Tür, die hinaus zur Terrasse führte, trat Aziz ein.
„Ich mache Schluss für heute“, meinte er.
Sie blickte auf und nickte.
„Gut.“
„Auf Wiedersehen, Miss...“
Sie erwartete jetzt eigentlich, dass er sich zum Gehen wenden würde. Aber er tat es nicht. Er blieb in der Tür stehen, mit einem Bein im Wohnzimmer, mit dem anderen auf der Terrasse. Elsa hob die Augenbrauen.
„Ist noch etwas, Aziz?“
„Ja, wegen unseres Gesprächs...“
Elsa stand auf, ließ die Zeitungen liegen und machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Vergessen Sie es, Aziz.“
„Meinetwegen. Aber das ist es nicht.“
Sie runzelte die Stirn und musterte ihn überrascht.
„Was dann?“
„Ich will mich keineswegs in Ihre Angelegenheiten mischen, aber vielleicht sollte ich es doch sagen...“
„Was meinen Sie?“
„Lieben Sie Mr. Jensen, Miss?“
Elsa starrte ihn einen Augenblick lang wie entgeistert an. Dann nickte sie.
„Ja, natürlich.“
„Gibt es Liebe ohne Vertrauen?“
Sie sah ihn an, und das war ihm offenbar unangenehm. Dann zuckte Aziz mit den Schultern. „Vielleicht gibt es das: Liebe ohne Vertrauen“, meinte er dann. Er schmunzelte und setzte dann hinzu: „Meine Frau vertraut mir ja schließlich auch nicht!“
Sein Blick war nach innen gewandt, als er vor sich hin lächelte. „Sie reimt sich die dollsten Sachen zusammen. Meistens verdächtigt sie mich, irgendwo etwas mit anderen Frauen zu haben... Wie gesagt, sie traut mir nicht über den Weg. Aber wir sind seit 30 Jahren verheiratet! Als wir uns erst ein paar Wochen kannten, so wie Sie und Mr. Jensen...“ Er brach ab und zuckte mit den Schultern.
„Na ja, vielleicht liegt es daran, dass wir unterschiedlichen Kulturen angehören.“
„Nein, das glaube ich nicht.“
„Wenn Sie Mr. Jensen lieben, dann vertrauen Sie ihm doch ein klein bisschen. Er ist ein ehrenwerter Mann.“
„Nun, ich...“
„Ein sehr ehrenwerter Mann. Davon bin ich überzeugt, auch wenn ich nicht viel über ihn weiß!“
„Vielleicht haben Sie recht, Aziz...“
„Bestimmt habe ich das, Miss!“
Am Abend kam endlich ein Anruf von Robert. Seine Stimme klang, als wäre er sehr weit weg. Aber das mochte an den schlechten Leitungen liegen oder ganz einfach Einbildung sein.
Er sagte, dass er von Madrid aus anrufe.
Sie fragte, ob er ihr eine Nummer durchgeben könnte, unter der er zu erreichen wäre.
„Nein“, meinte er. „Ich rufe dich wieder an.“
„Und wann?“
„Ich werde sehen...“
Einen Augenblick lang wollte sie ihn fragen, weshalb er zwei Pässe besaß und warum zum Teufel er ihr nicht offen und ehrlich sagen konnte, womit er sein Geld verdiente! Es war ein einziger, törichter Augenblick, mehr nicht.
Und dann fragte sie sich auf einmal, ob sie eigentlich ihrer eigenen Wahrnehmung noch trauen konnte. Sie versuchte, die Dinge im Kopf zusammenzubringen, die ihr Misstrauen begründeten.
Aber da schien auf einmal nichts mehr zu sein. Gar nichts.
Sie hörte seine ruhige, sichere Stimme, und die Schatten in ihrem Inneren lösten sich auf.
„Ich liebe dich, Robert!“, sagte sie in das Telefon hinein.
„Ich dich auch, Elsa.“
Die Antwort klang etwas hölzern, aber Elsa hatte das Gefühl, dass sie ehrlich gemeint war.
Robert hatte Madrid per Zug verlassen.
Er hatte einen Schlafwagen genommen, und jetzt, am Morgen, fühlte er sich ausgeruht. Das Rattern der Schwellen hatte ihn geweckt. Er zog sich rasch an und schaute auf die Uhr. Es waren noch mehr als zwei Stunden bis zum Gare d'Austerlitz in Paris.
Es blieb ihm also noch mehr als genug Zeit, um zu frühstücken. Er quetschte sich durch die engen Korridore an den Abteilen vorbei. Einige Fahrgäste kamen ihm entgegen. Schließlich hatte er den Speisewagen erreicht.
Er aß ein Croissant mit Milchkaffee und sah dabei nachdenklich aus dem Fenster.
Später, nachdem der Zug im Gare d'Austerlitz eingefahren war und Robert den Zug verlassen hatte, verstaute er sein Gepäck in einem der Schließfächer. Er würde nicht lange in Paris bleiben. Ein paar Stunden, wenn alles glattging.
Und wenn das, was er vorhatte, doch mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, als er ursprünglich eingeplant hatte, dann konnte er sich immer noch ein Zimmer in der Nähe des Bahnhofs suchen.
Er nahm die Metro und musste ein paarmal umsteigen. Den Weg, den er zu nehmen hatte, kannte er in- und auswendig. Schließlich erreichte er ein heruntergekommen wirkendes, kleines Geschäft in einer Seitenstraße. Die ganze Gegend war nicht besonders fein.
In dem kleinen Laden, der sich im Souterrain eines Mietshauses mit bröckelnder Fassade befand, wurde Second-Hand-Ware angeboten. An- und Verkauf, vom Plattenspieler bis zum Lexikon.
Aber das alles war letztlich nichts weiter, als eine Tarnung - eine Tarnung für wirklich lukrative Geschäfte.
Robert öffnete die Tür, und als er eintrat, ertönte ein Klingelzeichen. Hinter dem Tresen saß ein kleiner dicker Mann, der kaum ein einziges Haar auf dem Schädel hatte. Er las in einer Illustrierten und hob den Blick.
„Tag, Bernard“, sagte Robert. „Lange nicht gesehen, was?“
Der Mann hinter dem Tresen klappte die Illustrierte zu und schien im ersten Moment ein wenig überrascht. Dann zeigte er ein breites Lächeln, das fast von einem Ohr zum anderen ging.
„Du hast dich lange nicht blicken lassen“, meinte er und reichte Robert in einer fast freundschaftlichen Geste die Hand.
Robert zeigte ein dünnes Lächeln.
„Kann schon sein...“
Robert blickte sich um. Das Innere des Ladens glich einem einzigen Chaos. Ein Judo-Anzug hing von der Decke herab. Robert sah ein paar alte Röhren-Radios neben einem hochmodernen CD-Player, der fast wie neu aussah. In einer Glasvitrine hatte Bernard sogar Armbanduhren und Schmuck. Selbst ein paar Eheringe waren darunter.
Bernard, der bemerkt hatte, dass Roberts Blick an der Glasvitrine hängengeblieben war, meinte mit einem schelmischen Grinsen: „Interesse?“
„Heiße Ware?“
„Für wen hältst du mich!“
„Ich denke nicht, dass ich mich in dir täusche, Bernard!“
Der Mann hinter dem Tresen machte eine hilflose Geste und zuckte mit den Schultern.
„Woher soll ich wissen, woher die Sachen kommen, die mir angeboten werden?“
Robert musste unwillkürlich lachen.
„Ich schätze, du hast auch noch nie jemanden danach gefragt, oder?“
„Hätte das denn irgendeinen Sinn?“
Bernard kam hinter dem Tresen hervor und trat nahe an Robert heran.
„Was hast du auf dem Herzen?“
Robert ließ noch einmal den Blick umherschweifen, so als suchte er etwas. Eine Spur von Misstrauen stand in seinem Gesicht.
„Alles wie gehabt, Bernard?“
„Alles wie gehabt!“
Robert zog einen Zettel aus seiner Jackentasche und reichte ihn Bernard.
„Lies dir die Sache durch und sag mir, ob du die Sachen besorgen kannst!“
Bernard trat hinter den Tresen zurück und holte aus irgend- einer der unzähligen Schubladen eine Lesebrille hervor, deren Bügel er sich hinter die Ohren klemmte. Er überflog kurz die Liste und hielt sie dabei ins Licht. Dann hob er den Blick und nickte.
„Ich denke, das wird gehen.“
„In drei Tagen komme ich wieder nach Paris.“
„Das wird knapp.“
„Ja oder nein?“
Bernard zögerte.
„Ja, aber es hat seinen Preis.“
8.
Elsa saß im Wohnzimmer und las in einer Zeitung. Die Glastür zur Terrasse stand offen. Von draußen war das Knattern eines Rasenmähers zu hören, den Aziz auf der Grünfläche umherschob.
Als Elsa dann für einen Moment aufblickte, sah sie etwas schier Unglaubliches, etwas, das ihr den Atem zu rauben drohte.
Aziz ließ den Rasenmäher los, seine Augen waren vor Schreck geweitet. Dann bildete sich auf seiner Stirn ein roter Punkt, der rasch größer wurde. Ein Ruck ging durch seinen Körper. Er wurde nach unten gerissen und blieb der Länge nach im Gras liegen. Der Marokkaner rührte sich nicht mehr.
Das alles ging sehr schnell, zu schnell um noch irgend etwas unternehmen zu können. Und vor allem geschah es lautlos.
Elsa sprang auf.
Hinter der Hausecke tauchte jetzt ein dunkel gekleideter Mann auf, in dessen rechter Hand sich eine automatische Pistole mit Schalldämpfer befand.
Und dann tauchte noch ein zweiter auf, ebenfalls mit einer Schalldämpfer-Pistole ausgerüstet. Die beiden stürmten am Pool vorbei auf die Terrassentür zu.
Eine Schrecksekunde lang stand Elsa wie gelähmt da. Dann schnellte sie rückwärts, in Richtung Haustür. Als sie durch den Flur kam, riss sie im Vorbeilaufen den Schlüssel des Landrovers vom Haken.
Sie hatte den Wagen vor der Tür abgestellt. Wenn sie großes Glück hatte, konnte sie es vielleicht bis dorthin schaffen und mit dem Landrover flüchten.
Als sie die Haustür aufriss, wirbelte sie kurz herum und blickte in ein hartes, narbiges Gesicht. Sie musste unwillkürlich schlucken.
In den Augen ihres Gegenübers sah sie ihren Tod. Warum nur?, dachte sie verzweifelt. Was wollten diese Männer von ihr? Was suchten sie hier?
Die Pistole mit dem Schalldämpfer schnellte hoch. Der Killer legte nur kurz an und feuerte, aber Elsa hatte sich rechtzeitig aus der Schusslinie gebracht. Nur ein Klicken war zu hören, dann schlug das Projektil glatt durch die Haustür.
Kein Schussgeräusch war zu hören. Es war gespenstisch.
Elsa rannte los und hörte hinter sich die Schritte ihre Verfolgers. Sie hatte die Tür instinktiv hinter sich zugeknallt, und dann war sie auch schon beim Landrover.
Wenig später saß sie hinter dem Steuer. Der Zündschlüssel hinein und herumgedreht, der Motor sprang an. Gleichzeitig ging die Haustür auf, und der Narbige kam heraus.
Ein zynisches Grinsen spielte um seine dünnen, blutleeren Lippen, als er erneut die Waffe hob, diesmal ganz langsam und ruhig, ohne den geringsten Anflug von Eile oder gar Hektik. Er war sich seiner Sache sehr sicher.
Elsa setzte den Wagen ruckartig zurück, während eine Kugel durch das Glas der Frontscheibe ging und dann den Beifahrersitz aufriss.
Großer Gott!, durchfuhr es sie. Kalter Schweiß stand ihr auf der Stirn und lief ihren Rücken hinunter. Ihre Knie zitterten, und ihre Hände schienen mit einem Mal völlig kraftlos zu sein.
Sie war mit dem Wagen auf ein Rasenstück gefahren. Jetzt legte sie den Vorwärtsgang ein und riss das das Lenkrad herum. Der Narbige zielte schon wieder. Noch im letzten Moment konnte sie hinter das Armaturenbrett tauchen, als erneut eine Kugel durch den Wagen pfiff. Diesmal war der Schuss von der Seite gekommen und hatte beide Seitenscheiben zertrümmert.
Nur ja nicht die Nerven verlieren!, dachte sie. Sie trat kräftig auf das Gaspedal, und der Landrover brauste voran. Vor ihr lag das geschlossene, gusseiserne Tor.
Einen Moment zögerte sie, aber als der nächste Schuss - diesmal von hinten - knapp an ihr vorbeipfiff, wusste sie, dass ihr keine andere Wahl blieb. Sie raste auf das Tor zu.
Meine letzte Chance!, dachte sie. Wenn das Tor aus seinen Halterungen herausbricht, geht es vielleicht gut. Und wenn nicht... Sie wagte nicht, diesen Gedanken zu Ende zu denken.
Elsa trat das Gaspedal durch, und ein paar Sekunden später krachte es furchtbar. Sie wurde nach vorne geschleuderte. Das Lenkrad presste sich unangenehm gegen ihren Bauch, irgendwo schlug sie mit dem Kopf an und war einen Augenblick lang benommen.
Das Tor hatte gehalten, so viel dämmerte ihr. Sie stöhnte.
Als sie den Kopf hob, blickte sie direkt in den Schalldämpfer ihres Verfolgers. Sie zitterte, als der Mann die Waffe durchlud und an ihren Kopf setzte. Sie war unfähig, irgend etwas zu tun. Statt dessen saß sie hinter dem Lenkrad und starrte ihr Gegenüber an wie das Kaninchen die Schlange. Der Puls ging ihr bis zum Hals.
Sie schloss die Augen. Aus dem Hintergrund drang die Stimme des zweiten Mannes. Es klang italienisch und war wohl so etwas wie ein Befehl. Elsa verstand kein Wort.
Der Narbige verzog seine dünnen Lippen zu einer merkwürdigen Grimasse. Elsa spürte den Druck des Schalldämpfers gegen ihren Kopf und schluckte. Sie machte die Augen wieder auf und wunderte sich darüber, noch am Leben zu sein. Ihr Atem ging jetzt schneller.
Der zweite Mann kam heran. Er sah besser aus, als der Narbige und hatte ein feingeschnittenes Gesicht, das von dichten schwarzem Haar und einem ebenso pechschwarzen Bart umrahmt wurde.
Der Narbige wandte den Blick zu seinem Komplizen, aber die Pistole blieb weiterhin auf Elsas Kopf gerichtet, auch wenn sich der Druck etwas abschwächte.
Sie wechselten ein paar Worte. Der Schwarzbart schien offenbar das Sagen zu haben. Der Narbige war nur ein Handlanger.
Elsa blickte ängstlich von einem zum anderen
Dann fragte der Schwarzbart in akzentbeladenem Englisch.
„Wo ist Steiner?“
Elsa verstand ihn nicht. In ihrem Kopf drehte sich alles. Sie wollte antworten, aber ihr Mund blieb stumm. So schüttelte sie nur den Kopf.
Der Narbige verstärkte den Druck seiner Waffe wieder.
„Du sollst antworten!“, zischte er.
„Ich kenne niemanden, der Steiner heißt“, erklärte Elsa wahrheitsgemäß.
Der Narbige holte zu einer schnellen Bewegung aus und schlug Elsa seitlich mit der Pistole ins Gesicht. Blut tropfte ihr aus der Nase.
„Du lügst!“, zischte er dann. „Steiner wohnt hier.“
Langsam begriff Elsa. Diese Kerle suchten Robert; aus welchem Grund auch immer.
Der Schwarzbart bedeutete seinem Komplizen, es erst einmal dabei bewenden zu lassen. Elsa wurde roh aus dem Auto herausgezerrt. Sie wagte nicht, sich zu wehren. Es wäre auch zwecklos gewesen.
Die Männer packten sie, und so wurde sie zurück ins Haus geführt.
Als sie im Wohnzimmer ankamen, warfen sie Elsa auf die Couch.
„Ich würde Ihnen empfehlen, keine Dummheiten zu machen!“, meinte der Schwarzbart kalt. „Wir spaßen nicht. Sie bekommen eine Kugel in den Kopf, wenn Sie irgend etwas versuchen.“
Er sah sie scharf an. „Haben Sie mich verstanden?“
Elsa nickte.
„Ich will es hören!“
„Ja!“
„Gut so!“
„Was wollen Sie? Geld ist nicht besonders viel da, aber...“
„Wir wollen Steiner. Wo ist er? Vielleicht kennen Sie ihn unter einem anderen Namen. McCord? Jensen? Er benutzt noch ein paar weitere...“
Er griff in seine Jackentasche und legte Elsa ein Foto auf den Tisch. „Sehen Sie sich das an!“
Elsa zögerte erst. Dann schaute sie hin. Auf dem Bild war Robert.
„Dieser Mann wohnt hier, nicht wahr?“
Elsa antwortete nicht. Der Narbige trat unvermittelt vor und schlug ihr mitten ins Gesicht. Die Blutung in ihrer Nase, die gerade erst ein wenig zum Stillstand gekommen war, brach wieder auf. Elsa begann zu schluchzen.
„Es hat wenig Sinn, wenn Sie nicht mit uns zusammenarbeiten“, meinte der Schwarzbart ungerührt. „Wir werden ohnehin alles aus Ihnen herausbringen, was wir wissen wollen. Dafür haben wir unsere Methoden. Sie haben nicht die geringste Chance, merken Sie sich das. Vielleicht werden wir etwas Zeit verlieren, aber das ist auch alles...“
„Wo ist er?“, fragte der Narbige, der für das Grobe zuständig zu sein schien.
Elsa schluckte, wischte sich mit der Hand über die Wangen und die Augen und versuchte, mit ihrem Taschentuch das Nasenbluten aufzuhalten.
„Er ist nicht hier“, sagte sie dann und fühlte sich scheußlich dabei. Sie hatte das Gefühl, Robert irgendwie zu verraten, obwohl sie wusste, dass es nicht so war.
Diese Männer wussten Bescheid. Sie wussten, dass Robert - oder wie immer sein wirklicher Name auch sein mochte - hier lebte.
„Das haben wir gemerkt“, erklärte der Schwarzbart kalt. Er musterte Elsa mit einem unangenehmen Blick, der alles zu durchdringen schien. „Etwas mehr musst du uns schon erzählen. Wo ist Steiner jetzt? Pardon, hier nennt er sich ja wohl Jensen und behauptet, Däne zu sein...“
„Ist er das denn nicht?“
„Nein. Aber die Fragen stelle ich.“
„Ich weiß nicht, wo er ist“, erklärte Elsa mit Nachdruck. Sie sah in die Gesichter der beiden Männer, und dann lief es ihr kalt den Rücken hinunter. Sie fühlte, dass diese beiden - wer oder was sie auch immer geschickt haben mochte - die geringste Rücksicht auf ihr Leben nehmen würden. „Es ist die Wahrheit, ich weiß wirklich nicht, wo er sich befindet... Das müssen Sie mir glauben!“
„Wir müssen gar nichts!“, meinte der Schwarzbart. „Hat er nichts gesagt? Ist vielleicht auf einer seiner... Geschäftsreisen?“
Das letzte Wort sagte er in einem seltsamen Tonfall. Etwas stimmte da nicht, Elsa fühlte es ganz deutlich.
„Ja“, murmelte sie.
„Wer sind Sie?“
„Mein Name ist Elsa Karrendorf.“
„Deutsche?“
„Ja.“
„Und was machen Sie hier in Steiners Haus?“
„Ich lebe hier.“
„Kennen Sie Steiner aus Deutschland?“
„Nein. Ich habe ihn hier in Tanger kennengelernt. Ich bin seit ein paar Wochen mit ihm zusammen, das ist alles. Warum fragen Sie? Ist Steiner - wie Sie ihn nennen - etwa in Wahrheit Deutscher?“
Das würde erklären, weshalb er die Sprache so vorzüglich sprich, überlegte Elsa still. Der Schwarzbart zuckte mit den Schultern.
„Er spricht sehr gutes Deutsch, habe ich gehört. Aber das gilt auch für ein halbes Dutzend anderer Sprachen. Steiner ist wie ein Chamäleon, das sich überall perfekt anzugleichen versteht. Er wechselt Aussehen, Name und Nationalität nach Belieben. Kein Mensch weiß, wer er wirklich ist. Das heißt...“
„Was?“
„Vielleicht wissen Sie es.“
„Nein. Ich kenne einen Mann namens Robert Jensen. Sonst weiß ich nichts. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was hier gespielt wird.“
„Ist Steiner noch in Marokko?“
„Nein.“
„Hat er sich irgendwann gemeldet?“
Als Elsa nicht sofort antwortete, drückte der Narbige ihr wieder die Pistole an den Kopf. Der Druck war unangenehm. Sie schluckte und fasste sich dann. Es hatte alles keinen Sinn, sie musste diesen Männern irgend etwas vorsetzen, irgendeinen Brocken, den diese Wölfe verschlingen konnten... Und vielleicht, wenn sie sehr viel Glück hatte, würden sie sich damit zufrieden geben... Vielleicht...
„Ja, er hat einmal angerufen.“
„Von wo aus?“
Sie überlegte kurz. „Italien. Ich glaube, es war Mailand.“
Ohne Vorwarnung verpasste der Narbige ihr einen furchtbaren Schlag.
„Sie lügen!“, kommentierte der Schwarzbart. Die beiden Männer schien fast so etwas wie Gedankenübertragung zu verbinden. Sie verstanden sich blind und ohne ein Wort. Aber vielleicht lag es auch nur daran, dass Elsa nichts von dem wirklich verstand, was hier vor sich ging.
„Warum sollte ich lügen?“
„Steiner weiß genau, dass er ein toter Mann wäre, sobald er sich in Italien blicken ließe... Nein, das würde er nicht wagen! Also, von wo aus hat er sich gemeldet?“
„Brüssel.“
Es war ihr gerade so eingefallen, und sie dachte, dass es Robert vielleicht half. Dann kam ihr in den Sinn, dass sie im Grunde genommen gar nicht wusste, bei was für einer Sache sie dem Mann half, den sie liebte.
Ich liebe ihn, und das sollte genügen!, dachte sie. Aber genügte es wirklich?
„Wann kommt er zurück?“
„Ich weiß es nicht.“
„Natürlich wissen Sie es!“
„Nein, er sagte, dass er das nicht so genau voraussagen könnte. Vielleicht eine Woche, meinte er...“
Der Schwarzbart nickte nachdenklich.
Der Narbige sagte ein paar Sätze auf Italienisch, gestikulierte mit der Pistole in der Hand herum und deutete dann auf Elsa.
Der Schwarzbart runzelte erst die Stirn, dann schüttelte er den Kopf und erwiderte etwas. Der Narbige schien mit der Antwort nicht ganz einverstanden zu sein, aber er spielte hier eindeutig die zweite Geige und hatte zu tun, was befohlen wurde.
Er warf Elsa einen grimmigen Blick zu, stieß einen italienischen Fluch in ihre Richtung aus und ging dann durch die Terrassentür hinaus ins Freie.
Elsa blickte ihm nach und sah, wie er sich an Aziz' reglosem Körper zu schaffen machte, der nach wie vor draußen auf dem Rasen lag.
Der Rasenmäher knatterte noch. Der Narbige stellte ihn ab. Dann packte er den Marokkaner unter den Armen und begann, ihn in Richtung Haus zu schleifen.
„Was haben Sie vor?“, fragte Elsa den Schwarzbart unterdessen. „Wollen Sie mich auch umbringen? So wie Aziz?“
Der Schwarzbart deutete hinaus zu seinem Komplizen. „Mein Freund meinte, dass es an der Zeit wäre, Sie über den Jordan zu schicken...“
Elsa stockte der Atem. Aber ihre Gedanken blieben trotz allem klar, was sie überraschte. Sie hatte große Furcht, aber sie hatte auch nichts mehr zu verlieren.
„Und was haben Sie vor?“
„Wir werden Sie erst einmal am Leben lassen. Vielleicht haben wir noch Verwendung für Sie.“
„Was soll das heißen?“
„Dass Sie eine Chance haben, aus dieser Sache lebend herauszukommen - falls Sie mit uns kooperieren.“
„Warum suchen Sie...“, Sie zögerte einen Moment, ehe sie den fremden Namen aussprach, „...Steiner.“ Es klang in ihren Ohren, als spräche sie von einen Fremden. Aber es war Robert, um den es hier ging.
Der Schwarzbart wandte sich ab. Er antwortete nicht. Erst als der Narbige mit dem toten Aziz durch die Terrassentür kam, sagte er endlich etwas.
„Wir werden hier auf Steiner warten“, meinte er - aber das war nicht die Antwort auf Elsas Frage.
„Und wenn er hier auftaucht?“
Der Schwarzbart zuckte mit den Schultern.
„Sie werden ihn umbringen, nicht wahr?“ Es war im Grunde kaum noch eine Frage, Elsa war sich ziemlich sicher, dass es so war. Es erschien ihr logisch.
Der Schwarzbart schwieg.
Elsa blickte in das starre, tote Gesicht von Aziz, der ausgestreckt auf dem Steinfußboden lag. Seine Augen waren weit aufgerissen, und sie sah das Loch mitten auf der Stirn, aus dem bereits ziemlich viel Blut gesickert war.
Der Narbige untersuchte die Leiche. Er schien nach Waffen zu suchen und tastete Aziz dementsprechend ab. Schließlich schüttelte er den Kopf und sagte etwas zu dem Schwarzbart.
„Was ist das für einer?“, fragte er schließlich, an Elsa gewandt.
„Er hat sich um den Garten gekümmert!“ Elsas Stimme zitterte vor Zorn, als sie das sagte. Sie konnte ihn nicht unterdrücken, er schwang einfach in jedem Ton mit, der über ihre Lippen kam. „Er war unbewaffnet.“
„Das konnten wir nicht wissen.“
„Hätte es etwas geändert, wenn Sie es gewusst hätten?“
Der Schwarzbart zuckte wie beiläufig mit den Schultern. „Vermutlich nicht.“
9.
Robert stieg den steilen Hang noch etwas hinunter. Unten standen vornehme Ferienhäuser, und dahinter schimmerte das Mittelmeer.
Er griff in seine Jackentasche und holte den brauen Umschlag hervor, den Garcia ihm in Madrid gegeben hatte. Er griff hinein. Eine Karte, ein paar Fotos, ein paar Daten auf einem weißen Blatt Papier.
Er sah noch einmal auf die Karte, blickte sich dann um und ging weiter. Er war hier richtig, so glaubte er. Sein Orientierungssinn war immer schon gut ausgeprägt gewesen.
Es dauerte aber nicht allzu lange, da war sein Weg plötzlich zu Ende, und es ging so steil hinunter, dass an einen weiteren Abstieg nicht zu denken war. Innerlich fluchte er.
Robert blickte hinüber zu einem der Häuser und verglich es mit seinen Fotos. Er war richtig hier, kein Zweifel. Dann schätzte er die Entfernung ab. 100 Meter waren es bis zur Terrasse. Vielleicht auch 120 oder 140, das war so genau nicht zu sagen. Aber es würde genügen.
Näher würde er kaum herankommen, aber diese Stelle war gar nicht schlecht. Robert sah einen Mann im Garten des Hauses, nahm seinen Feldstecher, und dann verglich er das Gesicht des Mannes mit einem Foto aus dem braunen Umschlag.
Morgen würde er wieder in Paris sein. Er würde den Abendzug von Marseille aus nehmen.
Robert drehte sich um und ging denselben Weg zurück, den er gekommen war. Irgendwo weiter oben, wo eine Landstraße in Serpentinen verlief, hatte er einen Leihwagen abgestellt. Der Wagen stand in einer Kurve, er musste sehen, dass er dort wegkam. Ein Unfall und viel Aufsehen, das war das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte.
Robert stieg schnell in den Wagen und brauste davon. Am nächsten Tag war er wie geplant in Paris und suchte Bernard in seinem Geschäft auf.
Unglücklicherweise waren Kunden im Raum. Ein paar Teenager, die sich für den CD-Player interessierten, ihn lange begutachteten, aber letztlich doch wohl nicht genug Geld bei sich hatten, um ihn sich leisten zu können.
Sie versuchten zu handeln, aber Bernard wollte nicht mit sich handeln lassen, und so zogen sie schließlich ab. Aber bis dahin dauerte es eine Weile, Robert ging unruhig im Laden auf und ab, sich scheinbar für dies und jenes interessierend, in Wahrheit wartete er aber nur darauf, dass die Jugendlichen endlich den Raum verließen. Als sie hinaus waren, wandte er sich sofort an Bernard.
„Na, wie stehen die Aktien?“ Robert war die Anspannung deutlich anzumerken war.
„Alles ist gut für dich gelaufen“, meinte Bernard lakonisch.
„Dann hast du die Sachen auf der Liste bekommen können?“
„Ja.“
„Alles?“
„Ja.“
Bernard ging hinter den Tresen und holte ein Paket hervor, das er Robert hinschob. Er wollte es öffnen, aber Bernard legte ihm die Hand auf den Arm und schüttelte den Kopf.
„Nein, nicht hier.“
„Wieso?“
„Ich will es einfach nicht. Du kannst es öffnen wo immer du willst, aber nicht hier. Wenn etwas nicht in Ordnung ist und du dich beschweren willst, kannst du ja wiederkommen.“
Robert zuckte mit den Schultern.
„So vorsichtig bist du doch sonst nicht gewesen!“
„Jetzt bin ich es aber. Wann bekomme ich übrigens mein Geld? Der Mann, der diese Dinger herstellt, wartet nicht gerne auf seine Kohle!“
Robert griff in sein Jackett und holte ein Bündel mit Geldscheinen heraus.
„Es ist sogar eine Bauanleitung dabei“, versicherte Bernard. „Jedenfalls hat man mir das gesagt.“
„Ich hoffe, dass ich sie nicht brauche...“
„Du wirst sie brauchen. So einfach ist es nämlich nicht zusammenzusetzen. Aber mit ein bisschen technischem Verstand! Du bist ja schließlich kein Anfänger.“
Für die Nacht hatte sich Robert in einer Absteige in der Nähe des Gare d'Austerlitz einquartiert.
Das Fenster war undicht, und von draußen dröhnte der Autoverkehr. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen donnerten zusätzlich die Züge über die Gleisanlagen. Es würde eine unruhige Nacht werden, aber schließlich war dies ja auch kein Erholungsaufenthalt.
Robert legte das Paket neben seinen Koffer auf das Bett und machte sich sogleich daran, es auszupacken.
Er sah ein paar Stangen, eine Nylon-Schnur, viele Schrauben und Schienen aus Metall... Und eine kurze Anleitung, wie er das alles zusammenzusetzen hatte.
Ich werde es in Einzelteilen in den Süden mitnehmen, dachte er. So würde er kein Aufsehen erregen. Aber dann musste er es dort zusammensetzen, und das musste ziemlich schnell gehen.
Er würde es also üben müssen, dieses Ding mit schnellen Handgriffen zusammenzusetzen und wieder auseinanderzulegen. Aber das konnte kein allzu schwieriges Problem zu sein. Am nächsten Tag fuhr Robert zurück in den Süden. Auch diesmal nahm er einen Leihwagen, allerdings von einer anderen Firma.
Er stellte den Wagen in derselben Kurve ab, wie bei seinem ersten Besuch. Auf dem Rücksitz hatte er eine Sporttasche, die er mitnahm, als er ausstieg und den Hang hinunterging.
Wenig später hatte er eine günstige Position erreicht. Er sah den Bungalow und jenen Mann vom Foto, das ihm Garcia gegeben hatte. Der Mann lag auf der Terrasse und und las in einer Illustrierten.
Und dann war da auch noch eine Frau, die kurz aus dem Inneren des Bungalows kam, anscheinend ein paar Worte mit dem Mann wechselte und wieder im Haus verschwand.
Robert atmete ruhig und regelmäßig. Er öffnete die Sporttasche, holte seinen Feldstecher hervor. Mit geübten Bewegungen steckte er die Metallteile zusammen, die sich in der Tasche befanden. Es wurde eine Armbrust. Zuletzt befestigte er das Zielfernrohr.
Schließlich setzte er das Projektil ein, legte an und feuerte, als sich der Mann auf der Bungalow-Terrasse mitten im Fadenkreuzes befand.
Durch das Zielfernrohr sah Robert, dass er getroffen hatte. Der Mann sackte leblos zusammen. Robert hatte ihn in die Brust getroffen - aber selbst wenn es nur der Arm gewesen wäre, wäre er jetzt tot gewesen, denn das Projektil war vergiftet.
Robert zerlegte die Armbrust wieder in ihre Bestandteile und packte sie sorgfältig in die Sporttasche ein.
Für sich genommen wirkten die Teile völlig unverdächtig. Robert würde sie in Paris in die Seine werfen.
Es gab keine Spuren, die die Polizei oder irgend jemanden in seine Richtung führen konnten. Ja, es würde nicht einmal eine Tatwaffe geben!
Robert sah ein letztes Mal hinunter zum Bungalow. Die Frau war wieder hinausgetreten und hatte bemerkt, was geschehen war. Sie schlug die Hände vor das Gesicht und beugte sich dann über den Toten. Aber da war natürlich nichts mehr zu machen.
Robert stieg unterdessen schon wieder den Hang hinauf.
10.
Die beiden Männer hatten sich auf Italienisch unterhalten. Jedenfalls glaubte Elsa, dass es Italienisch war.
Elsa hatte die ganze Zeit über auf dem Sofa gesessen und ihnen stumm zugehört. Sie verstand nicht ein Wort. Vielleicht war es besser so. Vielleicht sprachen sie gerade über sie und das, was sie mit ihr anstellen wollten.
Elsa fühlte die Angst und ihr Puls raste. Sie fühlte die innere Anspannung und konnte nichts gegen dieses übermächtige Gefühl tun. Sie saß einfach da und zitterte.
Es fehlt nicht viel, und ich verliere den Verstand!, ging es ihr durch den Kopf.
Dann wandte sich der Schwarzbart an sie. Er ging auf sie zu und baute sich breitbeinig vor ihr auf. Sein Gesicht war ernst, während sich um den Mund des Narbigen ein hässliches Grinsen legte.
Elsa blickte auf.
„Können Sie Kaffee machen?“, fragte der Schwarzbart.
Elsa nickte. „Ja.“
Sie wagte es kaum, zu ihm ihm aufzublicken.
„Dann machen Sie welchen. Aber nicht zu schwach!“
Seine Stimme war ruhig und kalt. Und dann machte er eine kurze Bewegung mit der Hand, eine Bewegung, die Elsa aufstehen und in die Küche gehen ließ.
Mit zitternden Händen machte sie sich an der Kaffeemaschine zu schaffen. Die Tüte mit den Filtern fiel ihr auf den Boden. Sie bückte sich, hob die Tüte auf und fuhr sich durch die Haare. Dann sah sie, dass der Schwarzbart ihr gefolgt war und sie beobachtete.
Er blickte sie stumm und kalt an. Sie blickte zurück und erstarrte. Sie fühlte sie wie gelähmt, unfähig auch nur einen Muskel ihres Körpers zu bewegen. Die Zeit schien für ein paar Sekunden stillzustehen.
„Machen Sie weiter“, murmelte er schließlich.
Sie nickte und machte weiter.
Sie nahm die Büchse mit dem gemahlenen Kaffee und tat ein paar Löffel in den Filter. Und dabei meinte sie plötzlich: „Ihnen macht es nicht allzuviel aus, einen Menschen umzubringen, nicht wahr?“ Sie blickte nicht zu ihm hin. Ihr Mund bewegte sich und formte Wörter - und das half ihr etwas dabei, nicht verrückt zu werden. Sie sprach weiter, ohne dass es sie im Augenblick interessierte, was das für Folgen haben konnte. „Was sind Sie nur für Menschen! Vielleicht sind Sie auch gar keine! Wenn sich plötzlich herausstellen würde, dass Sie beide in Wahrheit gefühllose, kalte Außerirdische mit schleimigen Tentakeln sind, die nur zufällig gerade menschliche Gestalt angenommen haben - es würde mich nicht im mindesten wundern.“
„Wir machen nur unseren Job“, sagte der Schwarzbart. „Nicht mehr - aber verdammt noch mal auch nicht weniger!“
„Sie sind Tiere!“
„Denken Sie nicht zu schlecht von uns!“
„Ich denke aber schlecht von Ihnen. Auch wenn Sie mich jetzt dafür abknallen, so wie Sie es mit Robert vorhaben!“ Sie zuckte trotzig mit den Schultern. „Wahrscheinlich werden Sie es ohnehin tun, wenn Sie erreicht haben, was Sie wollten und ich für Sie nicht mehr nützlich bin!“
Der Schwarzbart zuckte mit den Schultern. „Das hängt von Ihnen ab!“
„Ich glaube Ihnen kein Wort!“
„Es ist aber die Wahrheit, junge Frau!“
„Und was muss ich tun, um am Leben zu bleiben? Hängt es vielleicht davon ab, ob mein Kaffee Ihnen schmeckt?“
Er lächelte dünn.
„Wenn er mir schmeckt, dann wäre das keine schlechte Voraussetzung!“ Dann wurde sein Gesicht wieder ernst. Er zuckte mit den Schultern; eine Geste, die locker wirken sollte - in Wahrheit aber wohl Verlegenheit verriet. „Es macht mir keine Freude, Sie oder jemand anderen umzubringen. Ich habe aber andererseits keinerlei Skrupel...“
„Das haben Sie ja bereits unter Beweis gestellt!“, versetzte Elsa bitter. Sie dachte an den toten Aziz.
„Sie reden, als wüssten Sie wirklich kaum etwas über Steiner - Robert...“
„Was wollen Sie damit sagen?“
„Vielleicht sollte ich Ihnen ein paar Dinge über Ihren Freund erzählen... Und vielleicht denken Sie dann nicht mehr ganz so schlecht von uns...“
Elsa sah auf und musterte ihn nachdenklich. Was konnte der Schwarzbart damit meinen?
Sein Mund wurde breiter. Er hatte ihre Verwirrung bemerkt und schien sie regelrecht ein wenig zu genießen. „Ihr Freund ist ein Killer!“ sagte er dann so sachlich und kühl, wie man so etwas nur sagen kann. „Er verdient sein Geld damit, für Geld Menschen umzubringen, die irgendwem im Wege sind.“
„Das glaube ich nicht!“
„Es entspricht der Wahrheit. Sie können es mir glauben oder auch nicht. Das ist mir letztlich völlig gleichgültig.“ Er machte eine unbestimmte Bewegung mit der Hand. „Ihr Freund ist letztlich eine Art Kollege von uns!“
Sie sah ihn an. Ihre Augen waren weit aufgerissen. Sie wirkte fassungslos und schüttelte leicht den Kopf. Es dauerte einen Moment, bis sie bemerkte, dass ihre Hände zitterten.
„Sie lügen“, sagte Elsa dann leise.
Der Schwarzbart zuckte mit den Schultern. Er sah sie mit seinen dunklen Augen nachdenklich an.
„Lieben Sie ihn?“, fragte er.
„Was geht Sie das an?“
„Nichts.“
„Was soll die Frage dann?“
„Ich will nur darauf hinaus, dass Steiner für Sie wohl so etwas wie ein blinder Fleck ist! Wahrscheinlich würden Sie mir noch nicht einmal glauben, wenn ich eine Liste seiner Opfer samt den jeweiligen Beweisen vor Ihnen ausbreiten würde...“
Elsa antwortete nicht. Sie wandte ein wenig den Kopf zur Seite. Das Telefon klingelte.
Die Augen des Schwarzbartes verwandelten sich in schmale Schlitze, und nur einen Sekundenbruchteil später blickte Elsa bereits wieder in die blanke Mündung seines Revolvers, den er blitzartig hochgerissen hatte. Elsa war wie erstarrt. Sie wagte keine Bewegung. Es klingelte ein zweites und ein drittes Mal.
„Ist das – Robert?“, fragte der Schwarzbart.
„Ich weiß es nicht.“
Der Schwarzbart atmete tief durch.
„Wer könnte es sonst sein? Haben Sie Bekannte hier in Marokko?“
„Nein.“
„Gehen Sie, und nehmen Sie den Hörer ab.“
Elsa rührte sich zunächst nicht. Sie schluckte. Der Schwarzbart lächelte.
„Sie wissen doch, was Sie zu sagen haben nicht wahr - ich meine, falls es Robert ist!“
Sie nickte. „Ja.“
„Fragen Sie ihn, wann er zurückkommt. Haben Sie verstanden?“
„Ja, ich habe verstanden.“
„Der geringste Fehler - und Sie sind tot! Ihr Leben bedeutet uns nichts. Denken Sie immer daran.“
„Ich denke an nichts anderes, seit Sie hier eingedrungen sind!“
„Das ist gut so. Und nun gehen Sie!“
Der Schwarzbart bewegte den Lauf seiner Pistole. Als Elsa nicht sofort reagierte, packte er sie am Arm und schob sie vor sich her.
Einen Augenblick später standen sie am Telefon. Elsa nahm den Hörer ab. Der Schwarzbart stand naben ihr und horchte mit ihr an der Muschel.
„Hallo?“
Elsa spürte ihren Puls schlagen. Und dann hörte sie eine Stimme, die ihr eigentlich so vertraut war und ihr in diesem Moment doch so fremd vorkam.
Es war Robert.
Robert Jensen. Oder Steiner. Oder irgend jemand anderes. Was weiß ich schon über diesen Mann?, dachte sie.
„Ist alles in Ordnung, Elsa?“
„Ja, sicher... Was sollte denn nicht in Ordnung sein?“
„War nur eine Frage.“
„Wo bist du jetzt?“
„Paris. Wird noch ein bisschen dauern.“
„Schade.“
„Ist leider nicht zu ändern, Elsa. Ich komme morgen oder übermorgen. Vorher rufe ich aber noch an.“
„Robert...“
„Ja?“
Elsa versuchte den Kloß herunterzuschlucken, der ihr auf einmal im Hals zu stecken schien.
„Robert, ich liebe dich.“
Eine kurze Pause folgte. Elsa sah in das Gesicht des Schwarzbarts, der nur wenige Zentimeter neben ihr stand. In seinen Augen blitzte es. Es war keine Kunst, in diesem Augenblick seine Gedanken zu lesen.
Irgend etwas schien Robert misstrauisch gemacht zu haben. Es konnte alles mögliche sein, was nicht gestimmt hatte. Vielleicht der Tonfall in Elsas Stimme, vielleicht ein Geräusch aus dem Hintergrund, das nicht passte.
Elsa schluckte.
Im Gesicht des Schwarzbarts zuckte ein Muskel.
Vielleicht zwei, vielleicht auch drei Sekunden waren vergangen, dann kam das, worauf sie beide - der Schwarzbart und Elsa - aus unterschiedlichen Gründen warteten.
„Ich liebe dich auch, Elsa“, sagte Robert.
Elsa suchte nach einem Zeichen in seinem Tonfall, einem Zeichen dafür, dass er etwas bemerkt hatte. Aber was sollte er schon bemerkt haben?
Es ist eine Illusion, darauf zu hoffen!, sagte sie sich selbst. Eine verdammte Illusion... Aber an irgend etwas musste sie sich schließlich klammern - und warum nicht daran?
Es war letztlich nicht weniger vielversprechend, als auf das Wohlwollen dieser Männer zu vertrauen.
„Ich muss jetzt Schluss machen“, hörte sie wie in Trance Roberts Stimme an ihrem Ohr.
„Mach's gut.“
„Du auch.“
Robert legte auf.
Der Schwarzbart nahm Elsa den Hörer aus der Hand und hängte ihn ein. Sie sah ihm an, dass er nicht zufrieden mit ihr war. Er blickte sie mit zusammengekniffenen Augen an. Der Narbige stand etwas abseits, und Elsa war froh darüber. Er hätte sie vermutlich geschlagen. Der Schwarzbart schien weniger roh zu sein.
„Ich habe alles gemacht, wie Sie gesagt haben,“ sagte Elsa unsicher.
Der Schwarzbart nickte.
„Ja. Ich hoffe, dass er nichts gemerkt hat.“
„Hat er nicht.“
„Woher wollen Sie das so genau wissen? Einen Moment lang dachte ich...“
„Ich weiß es eben!“
Der Schwarzbart zuckte mit den Schultern.
„Na gut. Was glauben Sie, was passiert, wenn er doch Verdacht geschöpft hat?“
„Ich weiß nicht. Ich denke, er wird sofort hierher kommen und...“
„Und versuchen, Sie hier herauszuhauen?“ Er lachte. „Sie kennen diesen Mann wirklich nicht! Wenn Steiner etwas gemerkt hat, dann wird er sich sofort aus dem Staub machen.“
Er packte sie rau am Handgelenk, so dass es schmerzte. Um seinen Mund zuckte es nervös. „Wir wären dann ziemlich sauer!“, zischte er. „Wir müssten dann nämlich mit unserer Suche wieder so gut wie von vorne anfangen!“
Jetzt meldete sich der Narbige zu Wort. Er sprach Italienisch. Elsa sah aus den Augenwinkeln, wie er dabei eine Illustrierte durchblätterte.
Was er sagte war ganz offensichtlich an den Schwarzbart gerichtet, aber Elsa fühlte instinktiv, dass es dabei um sie ging. Um sie und ihr Schicksal. Vielleicht um ihren Tod. Der Schwarzbart gab eine kurze Erwiderung.
Warum habe ich nur nie Italienisch gelernt?, hämmerte es in Elsas Kopf.
„Was hat er gesagt?“, fragte Elsa den Schwarzbart.
„Dass Steiner vielleicht Ihretwegen in unsere Falle gehen wird.“ Er machte eine unbestimmte Geste. „Ich habe ihm erwidert, dass ich nach allem, was ich über Steiner weiß, ihn nicht für einen Romantiker halte.“
„Was werden Sie jetzt tun?“
„Eine Zeitlang abwarten. Was sonst?“ In der Nacht schlief Elsa nicht gut, was nicht nur darin begründet lag, dass man sie mit Handschellen an ihr Bettgestell gefesselt hatte und sie sich kaum bewegen konnte.
Es war vor allem die schreckliche Ungewissheit, die sie plagte. Noch glaubten diese Männer, dass sie ihnen zu irgendeinem Zweck nützlich sein konnte.
Aber wenn diese Bedingung nicht mehr bestand, dann würden sie sie töten. Darüber gab sie sich keinerlei Illusionen hin. Bisher hatte sie nicht allzuviel Gelegenheit dazu gehabt, nachzudenken und zu grübeln. Es war zuviel geschehen, die Spannung war zu groß gewesen. Ständig hatte sie den Schwarzbart und den Narbigen in ihrer Nähe gehabt, und die beiden hatten ihre gesamte Aufmerksamkeit gefordert. Aber das war jetzt anders.
Sie war allein im Schlafzimmer. Von draußen fiel etwas Mondlicht ein, aber ansonsten war es völlig dunkel. Jetzt war sie allein mit sich und ihren Gedanken. In ihrem Kopf schien alles wie rasend durcheinanderzuwirbeln. Elsa dachte an ihren Tod. Ein kalter Schauder ging ihr über den Rücken, und sie erinnerte sich an die Depressionen, die sie während ihrer Pubertät gehabt hatte.
Das Gefühl, das sie jetzt beherrschte, erschien ihr ähnlich, nur viel stärker und bedrohlicher. Der Abgrund, vor dem sie stand, war unvergleichlich tiefer. Für einige Jahre hatte sie fast vergessen, wie sich solche Gedanken anfühlten; erst als ihre Eltern sich trennten, kam ein Teil davon zurück.
Dann die Fahrt - die Flucht - nach Tanger und jenes erste Zusammentreffen im Postamt. Robert...
Jensen? Steiner?
Sie hatte einen Mann geliebt - und tat es noch immer - der genau zu wissen schien, was er wollte, der Sicherheit ausstrahlte und ihr Geborgenheit gegeben hatte, der eine elektrisierende Ausstrahlung auf sie ausübte und sie ihren Schmerz und ihre Selbstzweifel hatte vergessen lassen.
Ein Mann ohne Identität, und ein Mann ohne jegliches Gewissen.
Ich sollte nicht den Stab über ihn brechen!, beschwor sie sich verzweifelt. Nicht, bevor ich ihn nicht selbst gehört habe...
Sie stellte sich vor, was geschehen würde, sobald er zurückkam. Wenn er Verdacht geschöpft hatte, dann war er vielleicht wirklich über alle Berge, so wie der Schwarzbart vermutete. Rein gefühlsmäßig war das für Elsa unvorstellbar, schließlich konnte es ihm doch nicht gleichgültig sein, was mit ihr geschah.
Aber ihr Verstand sagte ihr, dass es keinen Grund gab, weshalb jemand, der über Leichen ging, nicht genau so handeln sollte...
Ein Mann seines Gewerbes konnte schließlich nicht die Polizei um Hilfe gegen seine Konkurrenz bitten.
Und wenn er nichts gemerkt hatte? Wenn er nichtsahnend hier auftauchte? Sie würden ihn wie einen tollen Hund erschießen, dachte Elsa. Und wahrscheinlich hatte er nicht die geringste Chance, davonzukommen, geschweige denn ihr - Elsa - zu helfen. Sie würden auf ihn warten und ihren furchtbaren Job erledigen.
So wie Robert es wohl auch getan hätte. Elsa wurde wach, als der Narbige am Morgen das Schlafzimmer betrat. Er bedachte sie nur mit einem kühlen Blick, warf dann einen Blick hinaus aus dem Fenster und kettete sie vom Bettgestell los.
Sie rieb sich die Handgelenke.
Der Narbige stand dicht vor ihr und blickte auf sie herab. Er sagte kein einziges Wort, aber seine bloße Nähe wirkte schon wie eine einzige, unverhohlene Drohung.
Elsa sah die Waffe in seinem Hosenbund stecken.
Er schien von ihr nicht viel Widerstand zu erwarten und sich ziemlich sicher zu fühlen. Und tatsächlich - welche Chancen hätte sie auch gehabt?
Ich muss etwas tun, dachte sie. Ich kann mich doch nicht wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lassen!
Eine Sekunde nur überlegte sie, ob sie nach der Waffe greifen könnte, die so provozierend nahe schien.
Dann hatte der Narbige sie am Handgelenk gepackt und schob sie vor sich her. Es ging die Treppe hinunter. Elsa stolperte fast, aber der Narbige hielt sie in eisernem Griff, bis sie ins Wohnzimmer gelangt waren. Dort ließ er sie los.
Sie sah den Schwarzbart auf der Couch sitzen und in einer Illustrierten blättern.
„Morgen!“, brummte er, ohne aufzusehen.
Dann wurde sie in die Küche geschickt, um das Frühstück zu machen. Der Narbige stand die ganze Zeit dabei und ließ sie nicht aus den Augen.
Was habe ich nur getan, um in eine solche Lage zu geraten?, hämmerte es in Elsas Kopf. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen - nachdem sie sich in den falschen Mann verliebt hatte. So einfach war das.
„Machen Sie den Kaffee nicht zu schwach!“, rief der Schwarzbart aus dem Nebenzimmer.
„Keine Sorge“, murmelte Elsa.
„Was?“
„Ich sagte: Keine Sorge! Ich werde ihn schon stark genug machen!“
Wenig später brachte sie das Frühstück auf einem Tablett ins Wohnzimmer und stellte es auf den Tisch. Es war noch etwas Brot und Marmelade dagewesen. Das Brot war zwar nicht mehr frisch, aber das konnte Elsa nicht ändern.
Sollen sie sich selbst um diese Dinge kümmern, wenn sie etwas Besseres wollen, dachte sie, als sie das Gesicht des Narbigen sah, der sich in einen der Sessel gefläzt hatte und nun auf einem ziemlich zähen Bissen herumkaute.
Elsa nahm nur eine Tasse Kaffee.
„Wollen Sie nichts essen?“, fragte der Schwarzbart mürrisch.
„Nein. Ich habe keinen Appetit.“
„Sie sollten etwas zu sich nehmen.“
„Was kümmert Sie das?“
Er blickte auf und grinste.
„Ihre Laune wird sonst zu schlecht.“
„Wenn Sie mich umgebracht haben, wird es keine Rolle spielen, ob mein Magen voll ist oder nicht - oder wie es um meine Laune bestellt ist.“
„Es ist noch nicht entschieden, ob wir Sie liquidieren müssen.“
„Das sagen Sie, um mir Hoffnungen zu machen. Sie denken, dass ich dann gefügiger bin!“
Der Schwarzbart winkte ab und lachte.
„Wo denken Sie hin!“
Elsa nahm einen weiten Schluck Kaffee. Dabei strich sie sich mit der anderen Hand die ungewaschenen Haare aus dem Gesicht.
Dann fragte sie: „Was wollen Sie eigentlich von Robert? Was hat er getan, dass Sie ihn unbedingt umbringen wollen?“
Sie hatte gestern schon einmal in diese Richtung gefragt. und da war er ihr ausgewichen. Vielleicht hatte sie jetzt mehr Glück. „Ich möchte wissen, worum es hier geht.“
„Je weniger Sie wissen, desto besser“, kam es zurück.
Und dann klingelte es plötzlich.
Es war nicht das Telefon, es war an der Tür.
Der Griff des Narbigen ging augenblicklich zu der Pistole in seinem Hosenbund. Er riss die Waffe blitzschnell heraus und lud sie durch.
„Wer kann das sein?“, fragte der Schwarzbart Elsa.
„Keine Ahnung...“
Der Schwarzbart holte nun ebenfalls seine Waffe hervor und erhob sich. Während es ein zweites Mal klingelte, diesmal schon deutlich ungeduldiger, trat er zur Tür und blickte durch den Spion hinaus.
Zwei Sekunden später drehte er sich um.
„Eine Frau ist da draußen.“
„Ich kenne hier niemanden.“
„Sieht wie eine Araberin aus.“
„Das könnte die Frau von Aziz sein“, erklärte Elsa.
„Aziz?“
„Der Mann, den Sie erschossen haben! Er ist nicht nach Hause gekommen, sie wird sich Sorgen machen!“
„Und wie ist sie durch das Tor gekommen?“
„Sie hat einen Schlüssel.“
„Das klingt merkwürdig.“
„Es ist gar nicht so merkwürdig. Sie putzt hier regelmäßig mit ihren Töchtern, und Robert ist oft auf Reisen.“
Der Schwarzbart schüttelte verständnislos den Kopf. „Ein Mann wie Steiner, der sonst keiner Seele trauen würde... Und dann so etwas! Das erstaunt mich!“
„Es ist aber so!“
Der Schwarzbart nickte.
Dann machte er eine Bewegung mit dem Lauf seiner Waffe, die Elsa bedeutete, zur Tür zu kommen.
„Sehen Sie durch den Spion!“
Elsa gehorchte.
„Ist sie es?“, fragte der Schwarzbart.
„Ja.“
„Wimmeln Sie die Frau ab!“, befahl er.
„Tun Sie ihr nichts. Sie hat mit allem nichts zu tun.“
„Ich tue ihr nichts, wenn Sie sie abwimmeln. Sonst haben wir vielleicht keine andere Wahl. Lassen Sie Ihre Fantasie spielen, und denken Sie sich irgend etwas aus, das plausibel ist, klar?“
„Klar.“
Der Schwarzbart postierte sich so neben der Tür, dass man ihn nicht sehen konnte, wenn Elsa öffnete. Er hob den Lauf seiner Waffe.
„Wenn Sie irgend etwas versuchen, sind Sie beide tot - Sie und die Frau.“
„Ich habe verstanden.“
„Öffnen Sie jetzt die Tür.“ Aziz' Frau sprach nur Arabisch. Sie redete in einem wahren Wortschwall auf Elsa ein, aber natürlich verstand sie nichts davon.
Man brauchte kein Arabisch zu sprechen, um zu wissen, was sie wollte. Es lag auf der Hand.
Elsa fühlte einen Kloß in ihrem Hals, als sie an den toten Aziz dachte. Die Frau, die vor ihr stand, war in Sorge. Ihr Mann war die Nacht über nicht nach Hause gekommen, sie hatte also allen Grund dazu. Aber Elsa konnte ihr nicht die Wahrheit sagen.
Die Wahrheit war grausam, sie ihr zu verschweigen und in falscher Hoffnung zu wiegen ebenfalls. Aber es gab keinen anderen Weg. Elsa wollte das Leben dieser Araberin nicht gefährden. Die Frau hatte mit dieser Sache genauso wenig zu tun, wie ihr Mann.
„Ihr Mann - Aziz - ist nicht hier!“, erklärte Elsa ziemlich laut auf Englisch, aber die Frau verstand sie dadurch keineswegs besser. Sie versuchte es mit Gesten. Die Frau erwiderte etwas, dann versuchte sie, an Elsa vorbeizugehen.
Im letzten Moment konnte Elsa sie daran noch hindern.
„Aziz - nicht hier!“ Sie schrie es fast.
Die Frau blickte sie verständnislos an. Wie sollte sie auch verstehen, was hier vor sich ging? Sie ahnte nichts von der Pistole, die Elsa auf sich gerichtet wusste - und genauso wenig ahnte sie etwas davon, dass es hier auch um ihr eigenes Leben ging. Sie murmelte etwas vor sich hin.
Elsa versuchte ihr klarzumachen, dass sie am besten zur Polizei gehen sollte. Die Frau zuckte mit den Schultern und ging dann davon. Sie schien niedergeschlagen.
Elsa sah Aziz' Frau durch das offenstehende Tor gehen. Davor wartete ein Wagen auf sie. Irgendein Verwandter hatte sie hierher gebracht.
Elsas Blick fiel dann auf den zweiten Wagen. Aziz' Wagen! Er stand gut sichtbar vor dem Haus, und seine Frau musste ihn gesehen haben. Elsa versetzte es einen Stich.
Kein Wunder, wenn sie so fest davon überzeugt war, dass ihr Mann hier zu finden sein musste!
„Hat sie es geschluckt?“, zischte der Schwarzbart hinter ihrem Rücken.
„Nein...“, murmelte Elsa. „Mein Gott! Sie kommt zurück!“
Wie konnte es auch anders sein, dachte Elsa. Sie war ja nicht dumm. Außerdem hatte sie Augen im Kopf, und der Wagen ihres Mannes konnte ihr unmöglich entgangen sein.
Aber sie kam nicht allein. In ihrer Begleitung war jetzt ein junger Mann, der aus dem Pkw gestiegen war, der sie hierher gebracht hatte.
Sie kamen zusammen auf Elsa zu, die noch immer wie angewurzelt in der Tür stand. Sie warf einen Blick zu dem Schwarzbart, dessen Pistolenmündung in ihre Richtung zeigte.
„Was ist los?“
„Ich sagte doch, sie kommt zurück!“
„Ich höre Schritte von zwei Menschen. Wer ist bei ihr?“
Aber Elsa kam nicht mehr dazu, die Frage zu beantworten.
Der junge Mann, mit dem Aziz' Frau gekommen war, stellte sich kurz vor.
Er heiße Nurreddin, sei ein Cousin von Aziz. Er sprach hervorragendes Englisch, und nun wurde es Elsa klar, weshalb Aziz' Frau gerade ihn mitgebracht hatte.
„Es geht um meinen Onkel“, erklärte Nurreddin, und Elsa fühlte, wie ihre Handflächen feucht wurden. „Er ist nicht nach Hause gekommen, und meine Tante ist sehr in Sorge um ihn. Er ist nie über Nacht weggeblieben, ohne ihr etwas zu sagen.“
„Ja, ich...“
„Wir dachten, er wäre vielleicht hier.“
„Er ist nicht hier.“
„Aber sein Wagen. Dort steht sein Wagen.“
Elsa machte eine hilflose Geste. Sie fühlte, wie ihr der kalte Schweiß auf Nacken und Stirn ausbrach. Mit einer fahrigen Geste strich sie sich die Haare zurück, obgleich sie ihr gar nicht ins Gesicht hingen
„Gehen Sie jetzt bitte. Ihr Onkel ist nicht hier. Weshalb sein Auto hier steht, weiß ich auch nicht. Vielleicht war es kaputt, und er ist anderweitig in die Stadt gekommen...“
„Er hätte jemanden von uns angerufen, damit er abgeholt wird!“
„Vielleicht hat er ein Taxi genommen.“
„Das glaube ich nicht. Das sähe ihm gar nicht ähnlich.“
Und dann trat Nurreddin einen Schritt vor. Aziz' Frau folgte ihm. Elsa versuchte, den jungen Mann zurückzuhalten, aber es war zu spät. Er war durch die Tür getreten, einen Schritt nur an Elsa vorbei. Und jetzt blickte er genau in die Mündung der Pistole.
Er erstarrte noch im selben Augenblick. Eine Sekunde lang geschah gar nichts.
Dann machte es 'Plop!'
Der Schwarzbart hatte den Abzug seiner Schalldämpferpistole betätigt, und in Nurreddins Stirn war jetzt ein kleines, rotes Loch.
Er fiel mit starren Augen nach hinten, während der Schwarzbart die Waffe herumriss und ein zweites Mal - diesmal auf Aziz' Frau - feuerte.
Sie bekam eine Kugel in den Leib und dann eine eine zweite in die Brust. Mit einem unterdrückten Stöhnen sank sie in sich zusammen, während Elsa zitternd zur Seite wich.
Sie begegnete den ruhigen, dunklen Augen des Schwarzbarts und blickte ihn einige Augenblicke lang einfach nur verständnislos an.
Dabei wagte sie es nicht, sich zu rühren. Sie sah die Waffe und dachte: Wenn er mich jetzt töten will, gäbe es nichts, was ich dagegen tun könnte!
Sie schluckte. Sie fühlte die Furcht und das Grauen kalt in sich emporkriechen, aber gleichzeitig war sie selbst erstaunt, wie ruhig sie in diesem Moment war.
Der Schwarzbart hatte seine Waffe noch immer nicht gesenkt. Er stand einfach da und musterte sie.
„Warum?“, fragte Elsa.
„Es war notwendig.“
„Das ist nicht wahr!“
„Sie hätten überleben können, wenn Sie es geschafft hätten, die beiden davon zu überzeugen, daß es besser ist, anderswo nach diesem Araber zu suchen!“
„Warum machen Sie es nicht komplett!“, meinte Elsa trotzig, während sie spürte, wie ihr Tränen des Zorns in die Augen traten. „Bitte! Warum schießen Sie mich nicht auch über den Haufen?“
In die Furcht, die sie empfand, mischte sich nun auch eine deutliche Portion Hass. Und ein wenig davon hatte sogar in ihren Worten mitgeschwungen.
Der Schwarzbart bewegte den Lauf seiner Pistole hin und her.
„Kommen Sie rein“, brummte er. „Und machen Sie keinen Ärger!“ Der Narbige kam herbei und machte sich daran, die Leichen ins Haus zu befördern. Elsa bekam den Befehl, ihm dabei zu helfen.
„Nicht in den Flur!“, meinte der Schwarzbart. „Steiner muss nicht gleich unsere Visitenkarte vorfinden, wenn er zurückkommt!“
Sie legten sie in eine Abstellkammer. Danach versuchte der Narbige, so gut es ging die Blutflecken zu entfernen.
Währenddessen arbeitete es in Elsas Kopf fieberhaft. Sie musste eine Möglichkeit finden, von hier zu entkommen, bevor die beiden Killer sie nicht mehr brauchten. Denn genau in dem Augenblick, würden sie sie töten.
Noch war das nicht der Fall. Noch konnte jeden Moment das Telefon klingeln. Und wenn Robert sich meldete, dann brauchten sie an der Leitung eine Stimme, die keinen Verdacht erregte und ihn glauben ließ, alles sei in Ordnung und er könne gefahrlos zurückkehren.
Es musste einen Weg geben! Wenn ihr die Flucht gelang, dann würde sie nicht nur ihr eigenes Leben retten, sondern vermutlich auch das von Robert.
Robert... Immer wieder hatte sie sich gefragt, ob das, was sie über ihn erfahren hatte, ihre Gefühle geändert hatte. Sie war sich nicht sicher.
Aber wahrscheinlich war der Teil in ihr, der ihn nach wie vor liebte, stärker - selbst unter der Voraussetzung, dass jedes Wort von dem, was diese beiden Männer ihr gesagt hatten, stimmte.
Seltsam, dachte sie. Ich habe immer gedacht, es sei unmöglich, jemanden zu lieben, der sein Geld mit Mord verdiente.
Elsa versuchte, sich in Gedanken Entschuldigungen zurechtzulegen. Entschuldigungen für Robert. Aber sie fand nichts.
Und wahrscheinlich gab es auch gar nichts. Aber an diese Möglichkeit mochte sie nicht denken. Ihr Glaube an ihn war derart fest, dass sie selbst darüber erschrak.
„Ich möchte mich duschen“, sagte Elsa an den Schwarzbart gewandt. „Seit Sie hier sind, hatte ich noch keine Gelegenheit mehr, mich zu waschen.“
Der Schwarzbart zuckte mit den Schultern.
„Tun Sie das. Aber Sie müssen warten, bis mein Freund mit der Entfernung der Blutflecken fertig ist. Er wird auf Sie aufpassen.“
„Haben Sie so große Angst davor, dass ich weglaufen könnte?“
„Wir müssen auf Nummer sicher gehen.“
„Das Bad ist oben. Sollte ich vielleicht aus dem Obergeschoss springen?“
Der Schwarzbart verzog den Mund zu der Ahnung eines Lächelns.
„Sie könnten versuchen, die Regenrinne hinunterzuklettern“, erklärte er dann kühl und ungerührt. Elsa schluckte.
Der Schwarzbart blickte sie mit seinen dunklen, ruhigen Augen an, und es schien ihr in diesem Moment, als würde er bis in ihr tiefstes Inneres hineinblicken.
Er hatte ins Schwarze getroffen. Genau daran hatte Elsa gedacht: an die Regenrinne und die Rohrleitung, die von ihr hinunterführte. An den metallenen Halterungen hätte sie sich festhalten können. Und da sie nicht besonders schwer war, hätte sie darauf vertrauen können, dass sie nicht aus der Wand herausbrachen und sie in die Tiefe stürzen ließen.
In diesem Augenblick kam der Narbige zurück.
Er sagte etwas auf Italienisch, und der Schwarzbart gab eine knappe Erwiderung. Dann begleitete der Narbige sie hinauf.
Es war trotzdem angenehm, sich zu duschen - auch wenn der Narbige dabei nicht von ihre Seite wich. Es hätte nur noch gefehlt, dass er sie sogar in die Duschkabine begleitete!
Während sie sich auszog, stand er da und musterte sie kühl. Im ersten Moment hatte sie die Befürchtung, dass ihn das auf die Idee bringen konnte, sein Vergnügen bei ihr zu suchen. Aber sie erkannte bald, dass in dieser Richtung kaum eine Gefahr bestand.
Diese Männer waren keine Vergewaltiger, keine unbeherrschten Triebtäter. Sie waren eiskalt, und das Töten schien ihnen nicht das Geringste auszumachen.
Allerdings hatten sie auch kein krankhaftes Vergnügen daran. In ihrer Handlungsweise lag eine absolut opportunistische Logik - kein Hass, keines der Gefühle, an die man für gewöhnlich zuerst denkt, wenn es um Mord geht.
Sie machten ihre Arbeit. Und sie glaubten an die Gewalt, als ein wirkungsvolles Mittel, bei dessen Einsatz sie nicht den geringsten Skrupel kannten.
Elsa zog sich wieder an.
Der Narbige beachtete sie kaum. Er stand da und spielte mit seiner Pistole herum.
Nachdem Elsa sich die Haare geföhnt hatte, gingen sie wieder hinunter. Dann klingelte plötzlich das Telefon.
Der Schwarzbart bedeutete Elsa, den Hörer abzunehmen, und sie gehorchte. Es war Robert. Er käme übermorgen, sagte er. Und er müsse schnell Schluss machen, weil er kein passendes Kleingeld mehr habe.
Als Elsa den Hörer eingehängt hatte, fluchte der Schwarzbart laut vor sich hin.
„Übermorgen...“, murmelte er. „Bis dahin wird uns die Verwandtschaft dieses Gärtners die Türen einrennen!“ Er wandte sich an den Narbigen und sagte etwas auf Italienisch zu ihm.
Elsa verstand kein Wort, aber sie konnte sich denken, was es bedeutete, denn gleich darauf machte sich der Narbige auf den Weg, das Auto wegzufahren, mit dem Aziz' Frau und sein Cousin gekommen waren.
„Während Sie sich Ihrer Körperpflege gewidmet haben, habe ich die Vorräte in der Küche etwas genauer unter die Lupe genommen. Es ist nicht mehr allzuviel da.“
„Wollen Sie mir das zum Vorwurf machen? Schließlich habe ich Sie nicht eingeladen.“
„Schon gut, schon gut!“
Es dauerte eine ganze Weile, bis der Narbige zurückkehrte. Elsa vermutete, dass er den Wagen ein Stück die Straße entlanggefahren war, um ihn dann irgendeinen Steilhang hinunterzustürzen. Dann war er wohl zu Fuß zurückgekehrt; jedenfalls schloss Elsa das daraus, dass er sich nach seiner Rückkehr den linken Schuh auszog, um eine Blase zu behandeln. Aziz' Wagen hatte der Narbige einfach in die Garage gestellt. Dort würde er nicht mehr auffallen. Die nächsten Stunden flossen ziemlich zäh dahin. Der Narbige beschäftigte sich mit dem Fernseher und schaltete fortwährend von einem Kanal auf den nächsten.
Der Schwarzbart saß in einem der Sessel und schien in Gedanken versunken.
Elsa machte den erfolglosen Versuch, sich zurückzuziehen, aber das war dem Schwarzbart nicht recht.
„Sie bleiben hier“, sagte er.
„Was soll ich schon tun? Die Vordertür haben Sie abgeschlossen und hinten heraus kann ich nicht, ohne direkt an Ihnen vorbeizugehen!“, erwiderte Elsa.
„Trotzdem. Ich möchte Sie im Auge behalten. Setzen Sie sich wieder!“
Elsa gehorchte.
„Wissen Sie, wie man Spaghetti kocht?“, fragte er dann.
Elsa nickte.
„Klar.“
„Ich hätte Hunger darauf.“
„Ich glaube, dass die nötigen Zutaten noch im Haus sind.“
„Sind sie nicht“, erklärte der Schwarzbart. „Ich habe nachgesehen. Aber vielleicht werde ich nachher in die Stadt fahren, um sie zu besorgen. Steiner kommt ja erst morgen. Bis dahin ist es noch lang...“
„Was hat er eigentlich getan, dass Sie ihn töten wollen?“
„Wir haben nur einen Auftrag.“
„Es wird aber niemand umgebracht, ohne dass es dafür einen Grund gibt!“, meinte Elsa.
Der Schwarzbart lachte.
„Ich schätze, Sie wissen sehr viel darüber“, meinte er ironisch. Er zuckte mit den Schultern und sagte dann: „Warum eigentlich nicht? Ich werde Ihnen sagen, weshalb Steiner sterben muss. Es ist etwa ein Jahr oder etwas länger her, da hatte er für irgend jemanden irgendeinen Job zu erledigen...“
„Einen Mord?“
„Ich wüsste nicht, dass er mal in einem anderen Gewerbe tätig gewesen wäre. Ja, es war ein Mord, wenn Sie diesen unfreundlichen Ausdruck unbedingt benutzen wollen. Steiner hat seinen Job erledigt, wie man das von einem Killer seiner Klasse erwartet.“
„Und jetzt will sich jemand rächen, der Sie angestellt hat?“, schloss Elsa.
Der Schwarzbart lachte schallend.
„Sie sind wohl wirklich so grün hinter den Ohren, wie sie tun!“
„Was haben Sie gedacht?“
„Was ich denke, behalte ich besser für mich. Es geht Sie nichts an.“ Er lehnte sich ein wenig zurück. „Der Mann, den Steiner umbringen sollte, war ein Kurier, der einen Koffer mit Geld bei sich hatte. Er war gerade auf dem Sprung in die Schweiz, um es dort im Auftrag seiner Hintermänner legal anzulegen. Und wie es aussieht, hat Ihr Freund Steiner nicht nur den Kurier erschossen, was ja seine Aufgabe war, sondern auch das Geld kassiert.“ Seine ruhigen dunklen Augen musterten Elsa und studierten jede Regung, die sich in ihrem Gesicht zeigte. „Beginnen Sie nun zu begreifen, weshalb ein paar Leute ziemlich sauer auf ihn sind?“
Elsa schluckte.
„Ja.“
„Wir haben lange gebraucht, um ihn endlich ausfindig zu machen. Steiner ist ein Meister im Verwischen von Spuren. Er passt sich überall perfekt an, spricht viele Sprachen... Weiß der Himmel, wie oft er schon seine Haarfarbe gewechselt, seinen Namen verändert und sich vermutlich sogar kosmetischer Operationen unterzogen hat.“
„Nun haben Sie ihn ja gefunden.“
„Ganz richtig.“
Elsa überlegte. Dann hob sie den Kopf und sagte: „Wenn Sie und Ihre Auftraggeber hinter dem Geld her sind, dann...“
„Wir sind nicht hinter dem Geld her“, erklärte der Schwarzbart kalt.
Elsa runzelte die Stirn und machte eine hilflose Geste.
„Aber Sie sagten doch...“
„Es geht den Leuten, für die wir arbeiten um das Prinzip!“
„Welches Prinzip?“
„Das Prinzip, das besagt, dass jemand bestraft werden muss, der die Spielregeln verletzt!“
„Aber...“
„Und Steiner - Robert - hat die Spielregeln verletzt, als er das Geld genommen hat. Selbst wenn es jetzt hier auf dem Tisch liegen würde - es würde ihm nichts nützen.“
„Das verstehe ich nicht!“
„Sie wollen ihn tot sehen.“
„Wer sind sie?“
„Das müssen Sie nun wirklich nicht wissen!“
„Ich verstehe es trotzdem nicht!“
„Ist es denn so schwer zu begreifen? Es ist eine Art Abschreckung für all diejenigen, die ebenfalls mit Koffern voll schwarzem Geld aus illegalen Geschäften herumreisen oder es sonstwie in die Finger bekommen könnten und auf diese Weise naturgemäß in großer Versuchung sind, sich einmal richtig zu bedienen.“
11.
Der Schwarzbart hatte seinen Plan wahrgemacht, hatte den Landrover genommen und war damit in die Stadt gefahren, um einzukaufen.
Elsa war nun mit dem schweigsamen Narbigen allein, der jetzt unruhig im Wohnzimmer auf und ab ging. Die Pistole trug er dabei lässig im Hosenbund. Ab und zu blickte er zu ihr hinüber und musterte sie seltsam. Elsa lehnte sich im Sessel zurück und träumte ein wenig vor sich hin.
Sie dachte an ihre erste Begegnung mit Robert und dann an die Szene am Strand, als er ihr geholfen hatte. Dann wanderten ihre Gedanken zu jener ersten, stürmischen Vereinigung mit diesem Mann, die sich genau hier, in diesem Raum abgespielt hatte, nachdem sie vom Swimmigpool gekommen waren. Es fiel ihr noch immer schwer zu glauben, dass derselbe Mann, den sie so voller Zärtlichkeit und Verständnis erlebt hatte, ein eiskalter Killer war. Und auf einmal erschien ihr das Vergangene so unwirklich, wie aus einer anderen Welt. Die ganze Zeit mit Robert, diese wunderbaren, viel zu schnell dahingerauschten Wochen...
Plötzlich wurde sie aus ihren Gedanken gerissen, und dem Narbigen schien es ganz genauso zu gehen. Jemand öffnete die Haustür.
Es war noch nicht allzulange her, dass der Schwarzbart nach Tanger aufgebrochen war. Wenn er jetzt schon wieder zurückkehrte - und wer sonst sollte es sein? - dann war er wirklich schnell. Aber vielleicht hatte er auch Probleme mit dem Landrover gehabt. Seit Robert weg war, war nicht mehr nach Öl und Wasser geschaut worden.
Elsa blickte zu dem Narbigen hinüber. Sie spürte seine Anspannung. Seine behaarte Pranke griff nach der Pistole im Hosenbund. Er zog die Waffe heraus und lud sie mit einer energischen Bewegung durch. Es schien, als wollte er auf Nummer sicher gehen. Er warf Elsa einen kurzen, strengen Blick zu, der ihr soviel sagte, wie: 'Bleib ja sitzen wo du bist!'
Dann machte er zwei Schritte nach vorn zur Wohnzimmertür und blickte den kurzen Flur entlang zur Haustür.
Seiner Körperhaltung sah Elsa an, dass es nicht der Schwarzbart sein konnte, der ihn dort erwartete.
Ein hässliches, kurzes Geräusch ließ sie dann zusammenzucken - und ebenso den Narbigen. Es hatte 'Plop!' gemacht, und Elsa wusste inzwischen nur zu gut, was das bedeutete.
Der Narbige taumelte nach hinten und feuerte dabei seine Waffe ab, so dass es ein zweites Mal 'Plop!' machte. Der Schuss ging in die Decke und riss dort ein kleines Loch. Der Narbige presste einen unterdrückten Schrei über die Lippen, während er schwer zu Boden stürzte. Er keuchte und versuchte, seine Waffe erneut hochzureißen, bevor es abermals 'Plop!' machte. Die erste Kugel hatte den Narbigen in der Brust getroffen, die zweite mitten in der Stirn. Jetzt lag er der Länge nach hingestreckt und mit starren Augen da.
Elsa hörte Schritte im Flur. Schon bevor diese Schritte das Wohnzimmer erreichten, wusste sie, wer gekommen war. Sie erkannte ihn am Gang.
„Robert!“, rief sie.
Robert war an der Tür stehengeblieben. Er warf einen kurzen Blick zu ihr, bevor er sich zunächst einmal dem Toten zuwandte. Elsa sprang auf und kam zu ihm herüber, während er sich über den Narbigen beugte und dessen Taschen durchsuchte. Er fand einen italienischen Pass, blätterte darin und steckte ihn dann ein.
„Ich dachte, du kommst erst morgen“, sagte sie.
„Es sollte eine Überraschung sein!“, meinte Robert sarkastisch. Dabei steckte er seine Waffe ein.
Elsa berührte seine Hand. Sie fühlte sich kalt an. Elsa schmiegte sich an ihn, und er strich ihr mit der Linken über das Haar.
„Ich bin so froh, dass du wieder da bist“, sagte sie, und sie meinte das auch so. Gleichzeitig aber spürte sie ganz deutlich die Kluft, die plötzlich zwischen ihnen lag. Es war eine merkwürdige Fremdheit. Sie hatte ihren Kopf an seine Brust gelegt und fragte sich auf einmal, was sie dort eigentlich machte. Eine sehr stürmische Begrüßung war das nicht gewesen aber das war beiderseitig.
Elsa löste sich von ihm, schluckte, rieb sich die Hände und strich sich die Haare aus dem Gesicht.
Einen Moment nur streifte ihr Blick die starren Augen des Narbigen. Es war eher Zufall, aber Elsa wandte schnell den Kopf und schaute woandershin.
„Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist“, sagte sie - und zwar in erster Linie, weil sie das Gefühl hatte, jetzt irgend etwas sagen zu müssen.
Roberts Blick blieb an ihr haften.
Elsa fühlte diesen Blick fast körperlich und erwiderte ihn schließlich.
„Woran hast du gemerkt, dass hier etwas nicht stimmt?“, fragte sie.
„Ich wusste es nicht“, erwiderte er.
„Aber, wenn du es nicht gewusst hast...“
„Ich habe es eher geahnt. Ich weiß nicht, vielleicht war es irgend etwas an der Geräuschkulisse beim Telefonanruf gestern, was nicht stimmte. Vielleicht auch, weil du so verändert wirktest.“
„Wenn ich dich gewarnt hätte, hätten sie mich erschossen“, sagte Elsa. Und dann berichtete sie in knappen Worten, was sich zugetragen hatte. Sie hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten.
Mit regungslosem, aber aufmerksamen Gesicht hörte Robert ihr zu.
„Sie sind zu zweit“, sagte Elsa. „Der andere ist in die Stadt gefahren, um einzukaufen. Allzulange kann es nicht mehr dauern, bis er zurückkehrt...“
Robert nickte.
„Gut“, murmelte er.
„Was sollen wir machen?“ fragte Elsa. Sie überlegte. Dann meinte sie: „Du bist mit einem Taxi gekommen, nicht wahr?“
„Ja.
„Aber in der Garage steht Aziz' Wagen. Sie haben ihn erschossen, weißt du?“
„Nein, das wusste ich nicht.“
„Seine Frau auch und auch den Mann, mit dem sie gekommen war, um sich nach Aziz zu erkundigen, nachdem er die Nacht über nicht nach Hause gekommen war.“ Sie schluckte. „Sie hätten mich auch erschossen, wenn ich meine Rolle als Lockvogel zu Ende gespielt hätte, nicht wahr?“
„Das ist zu vermuten!“
„Lass uns von hier verschwinden, Robert! So schnell es geht! Ich bitte dich!“
Um Roberts Mund zuckte es. Er schüttelte den Kopf.
„Nein“, sagte er. „So geht das nicht!“
„Aber der Zweite wird zurückkommen! Und er wird dich nach wie vor töten wollen! Und mich wahrscheinlich auch!“
Robert machte eine unbestimmte Geste.
„Wahrscheinlich hast du recht!“, sagte er. „Aber davonzulaufen hat in dieser Situation keinen Sinn. Ich werde hier auf ihn warten.“
„Und dann?“, fragte Elsa.
Er bedachte sie mit einem verständnislosen Blick. Seine Augen hatten sich ein wenig verengt, und Elsa empfand wieder dieses seltsame Gefühl der Fremdheit.
„Was soll das heißen - 'Und dann?'“ fragte Robert zurück.
„Was wirst du tun, wenn er zurückkehrt?“
„Ihn erschießen. Was sonst?“
„Robert, gibt es denn keine andere Lösung?“
Er zuckte mit den Schultern.
„Sag mir eine! Meinst du vielleicht, es wäre besonders intelligent, zur Polizei zu gehen und denen dieses Haus voller Leichen zu präsentieren?“ Er schüttelte den Kopf. „Ich habe keinen Vetter bei der hiesigen Justiz! Außerdem wird dieser Bluthund nicht aufgeben! Er wird versuchen, mich zur Strecke zu bringen. Der Kerl hat es geschafft, mich hier aufzutreiben. Er wird es auch an jedem anderen Ort irgendwann schaffen.“ Robert schüttelte den Kopf. „Nein“, murmelte er. „Es ist das Beste, wenn ich die Sache hier und jetzt zu Ende bringe!“ Er zuckte mit den Schultern. „Zumindest zu einem vorläufigen Ende!“
Elsa taumelte ein paar Schritte zurück und ließ sich auf die Couch fallen.
Robert ging unterdessen in die Küche und holte sich eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank. Er nahm kein Glas, sondern trank gleich aus der Flasche und schloss dabei die Augen.
Elsa sagte: „Es macht dir nichts aus, nicht wahr?“
Es war eher eine Feststellung, als eine wirkliche Frage. Und ihr Ton war sehr ernst.
Er nahm noch einen tiefen Schluck und setzte die Flasche dann auf dem flachen Wohnzimmertisch ab.
„Was?“, fragte er. „Was scheint mir nichts auszumachen?“
„Einen Menschen umzubringen!“
„Willst du mir jetzt eine Predigt halten, Elsa?“
„Nein. Auf diesen Gedanken käme ich nicht. Ich bin kein kein Pastor.“ Und dann, nach einer kurzen Pause setzte sie hinzu: „Ich bin nicht dein Vater!“
Robert atmete tief durch.
„Wenn ich am Leben bleiben will, muss ich ihn umbringen. So einfach ist das.“
„Ich weiß das, Robert!“
„Auch wenn es in deinen Augen hart klingt, so ist es nun einmal. Du brauchst kein Mitleid mit diesen Leuten zu haben. Sie hätten auch keines mit dir gehabt!“
Plötzlich schien es Elsa, als würde Robert sie mit seinem Blick förmlich durchbohren. Verzweifelt schien er in ihren Zügen lesen wollen. Sie erwiderte den Blick, fürchtete aber insgeheim, dass er bei seinem Bemühen, in ihr zu lesen, Erfolg haben könnte.
„Was haben dir diese Kerle über mich erzählt?“, fragte er kühl.
„Einiges“, flüsterte sie. Nachdem sie sich dann geräuspert hatte, setzte sie hinzu: „Und das meiste hat mir nicht gefallen!“
Er lächelte schwach.
„Du bist eine schnelle und harte Richterin“, murmelte er. „Du hast den Stab über mich gebrochen, ohne mich anzuhören.“
Elsa vermied es, ihn direkt anzusehen.
„Sie haben gesagt, du seist ein Killer!“, sagte sie. „Ein Mann, der für Geld Mordaufträge ausführt!“
„So, haben sie das gesagt“, meinte Robert gedehnt. „Und du glaubst ihnen...“
„Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll, Robert!“ Sie deutete mit der Hand auf den Narbigen, wobei sie es vermied, die Leiche anzusehen. „Kennst du ihn?“
„Ich habe ihn nie zuvor gesehen.“
„Aber seine Auftraggeber, die kennst du, nicht wahr, Robert? Die Leute, denen der Geldkoffer gehörte, den du dem toten Kurier abgenommen hast!“
„So“, murmelte Robert. „Das haben sie dir also auch erzählt...“
Elsa nickte.
„Ja.“ Und nach einer kurzen Pause setzte sie noch hinzu: „Ist das alles wahr, Robert?“ Es war keine wirkliche Frage, sondern nur ein letzter Rest von Hoffnung. Zumindest die Hoffnung auf eine einleuchtende Entschuldigung.
Robert schwieg und wandte sich ab. Er ging ein paar Schritte hin und her. Er schien nachdenken zu müssen, blieb aber völlig ruhig.
Elsa hatte so sehr gehofft, dass es nur Lügen waren, und er alles widerlegen würde. Sie fühlte ihre Hände sie waren schweißnass.
„Wie viele waren es, Robert? Fünf, zehn, ein Dutzend?“
„Hör auf, Elsa!“
„Hast du etwa schon aufgehört, die Toten zu zählen, Robert?“
„Ich sagte: Hör auf!“
„Wer war es diesmal - in Madrid, in Paris oder wo immer du auch sonst gewesen sein magst!“
„Es war ein Schweinehund“, sagte Robert. „Nicht besser als der dort!“ Und dabei deutete er auf die Leiche des Narbigen.
Das Geräusch eines Wagens ließ sie beide erstarren.
Es war der Landrover. Der Schwarzbart kehrte zurück.
Elsa verharrte bewegungslos, während Robert in den Flur ging. Die Haustür öffnete sich. Der Schwarzbart schien nicht die geringste Ahnung zu haben, was ihn jetzt erwartete - und Robert ließ ihm nicht den Hauch einer Chance.
Er feuerte sofort. Dreimal drückte er ab.
Die Kugeln trafen den Schwarzbart in der Bauchgegend und ließen ihn zusammenklappen wie ein Taschenmesser. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und weit aufgerissenen Augen ging er zu Boden. Er hatte noch nicht einmal Zeit dazu gehabt, seine Waffe herauszuziehen.
Robert trat etwas heran und sah zu ihm hinunter. Der Schwarzbart lag zusammengekrümmt am Boden, aber er regte sich noch.
Seine Hand versuchte zitternd, nach hinten zu greifen, wo der Griff seiner Pistole aus dem Hosenbund ragte.
Er hätte es wahrscheinlich ohnehin nie geschafft, nicht einmal, wenn er einen ganzen Tag Zeit gehabt hätte. Robert ließ ihm gerade fünf Sekunden.
Unterdessen war Elsa ebenfalls in den Flur gekommen, und so sah sie gerade noch, wie Robert dem am Boden Liegenden einen Kopfschuss verpasste. Es sah sehr hässlich aus und sie wandte sich ab.
Mein Gott!, dachte sie. Ein Haus voller Leichen. Immer wieder hämmerte es in ihrem Kopf. Dieser eine Gedanke: Ein Haus voller Leichen!
Ihr Mund stand weit offen. Sie schüttelte stumm den Kopf. Sie wollte etwas sagen, aber sie konnte es nicht. Sie brachte einfach keinen Laut heraus. Kurz begegnete sie Roberts Blick, der sie kühl musterte. Er schien ihre Reaktion mit Befremden zu registrieren. Dann wandte Elsa sich um und lief die Treppe hinauf. Sie bewegte sich wie automatisch und gleichzeitig hatte sie furchtbare Angst.
Sie ging ins Schlafzimmer, holte ihre Tasche aus dem Schrank und begann dann, ihre Sachen zu packen. Den Pass und und ihr Portemonnaie steckte sie sich in die Gesäßtaschen ihrer Jeans.
Nur das Nötigste raffte sie zusammen. Dann zog sie den Reißverschluss ihrer Reisetasche zu.
Ihre Hand legte sich um den Griff, sie machte einen Schritt nach vorn. Als sie aufblickte, sah sie Robert in der Tür stehen. Sie erstarrte und schluckte.
„Was hast du vor?“, fragte er, obwohl es offensichtlich war.
„Ich kann so nicht weitermachen“, erklärte sie. „Ich kann einfach nicht.“
„Was willst du jetzt tun, Elsa?“
„Ich werde das nächste Schiff nach Algeciras nehmen.“
„...und dann nach Hause fahren und so tun, als wäre nichts gewesen?“
„Warum nicht? Hier werde ich jedenfalls nicht bleiben!“
Sie sah seine Hand zur Seite gleiten, und dann umfassten seine Finger den Griff der Pistole.
Sein Gesicht wirkte bewegungslos.
„Robert...“, flüsterte sie. „Du willst doch nicht etwa...?“
„Ich fürchte, ich habe keine andere Wahl, Elsa.“
„Keine andere Wahl?“
„Ja. Du weißt zuviel über mich.“
„Ich...Ich würde niemandem etwas sagen!“
„Das sagst du jetzt - aus Angst. Aber woher weiß ich, dass du in zwei Wochen, in einem Jahr, in zehn Jahren noch genauso darüber denkst?“
Er kam näher, Elsa wich zurück, bis sie in ihren Kniekehlen die Bettkante spürte.
„Robert! Ich dachte...“
„Ja?“
„Ich dachte, wir hätten uns geliebt!“
„Die Situation hat sich geändert, Elsa. Daran kann ich nicht vorbeigehen!“
„Es macht dir nichts aus, mich nun zu erschießen?“
„Wer sagt, dass es mir nichts ausmacht?“
„Es scheint so.“
„Es ist notwendig, dass ist alles.“ Er zuckte mit den Schultern. „Es tut mir leid. Wirklich.“
„Sehr tröstlich für mich!“, zischte Elsa bitter.
„Ich sage das nicht nur so, ich meine es auch! Wir waren ein schönes Paar. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich mich gar nicht erst darauf eingelassen hätte. Es ist also gewissermaßen mein Fehler gewesen, das gebe ich zu. So etwas wie mit dir, das passt nicht zu dem Job, den ich mache... Aber du hast mich eben so verzaubert. Ich konnte nichts dagegen machen.“
Er hob die Waffe, und Elsa schluckte. Sie erwartete jeden Moment, dass es 'Plop!' machte und ihr ein Projektil in den Körper fuhr, um sie zu zerreißen.
Sie schluckte.
Dann sah sie aus den Augenwinkeln die Vase auf dem Nachttisch. Es war ein plötzlicher Entschluss, eine Handlung, die aus der Verzweiflung kam. Sie bückte sich und griff nach der Vase, während Robert annähernd im selben Moment seine Waffe abfeuerte.
Das Geschoss pfiff über sie hinweg und ging in die Wand, während sie die Vase mit voller Wucht Robert entgegenschleuderte. Ein zweiter Schuss löste sich aus der Pistole, aber der war kaum noch gezielt, denn Robert musste gleichzeitig die Vase abwehren, die ihn sonst am Kopf getroffen hätte.
Es war kaum mehr als eine Sekunde, die Elsa dadurch gewonnen hatte, aber die nutzte sie, indem sie sich mit ihrem ganzen Gewicht nach vorne warf und Robert so zu Fall brachte.
Sie hörte ihn fluchen und zu Boden gehen, während sie schon wieder hoch war und aus dem Schlafzimmer lief. Eine Kugel pfiff ihr hinterher.
Sie stolperte die Treppe hinunter und war einen Augenblick später bei der Haustür, die offen stand. Elsa sah die Leiche des Schwarzbarts. Aus dem Hosenbund des Toten ragte ein Pistolengriff.
Nur wenige Augenblicke hatte sie, um sich zu entscheiden. Gleich würde Robert die Treppe hinunterkommen. Sie hatte keine Chance, schnell genug den Land Rover zu erreichen, ihn zu starten und zu verschwinden.
Selbst dann nicht, wenn die Schlüssel noch steckten und sie sie nicht in den Taschen des Schwarzbarts suchen musste.
Sie legte ihre Finger um den Pistolengriff und holte die Waffe heraus. Sie wusste nicht viel über Waffen. Wenn man es genau nahm, fast gar nichts. Als kleines Mädchen hatte sie bei Bekannten einmal mit einem Luftgewehr auf Blechbüchsen geschossen, aber das war auch schon alles.
Sie fühlte mit der Fingerkuppe den kleinen Hebel an der Seite der Pistole. Eine Schusswaffe muss entsichert werden, das war ihr aus Kriminalfilmen bekannt. Und dies musste der richtige Hebel dafür sein und so legte sie ihn um.
Eine Sekunde später blickte sie in Roberts Gesicht, der die Treppe herunterkam, seine Waffe in der Hand.
Elsa zögerte keinen Moment, denn sie wusste, dass sie nur diese eine Chance bekommen würde. Und vielleicht würde auch die ihr nicht mehr helfen können. Sie drückte ab und feuerte einen Schuss nach dem anderen, wobei sie kaum bewusst zielte, sondern die Waffe einfach nur in die Richtung hielt, aus der Robert kam.
Damit hatte er nicht gerechnet.
Er sackte getroffen in sich zusammen und rutschte die Treppe hinunter. Elsa ließ die Waffe fallen, als sie sah, was sie bewirkt hatte. Robert blickte sie mit starren Augen an.
Er war tot.
12.
Elsa lief hinauf zum Schlafzimmer, um ihre Tasche zu holen. Was geschehen war, war so furchtbar, dass es ihr fast den Verstand zu rauben drohte.
Aber es war ihr auch klar, dass sie jetzt, trotz allem, ein Minimum an kühlem Kopf bewahren musste. Sie nahm also ihre Tasche und ging zum Landrover, draußen vor der Tür. Sie stieg ein.
Der Schlüssel steckte, so brauchte sie ihn nicht erst in den Kleidern des Schwarzbarts zu suchen. Sie ließ den Wagen an und fuhr los.
Ein paar Augenblicke später befand sie sich auf der Straße nach Tanger.
Ihre Hände zitterten, während sie das Lenkrad hielt.
Nur weg von hier!, dachte sie. So schnell und so weit wie möglich!
Ein Lieferwagen kam ihr entgegen und streifte den Landrover fast, weil Elsa zu weit in der Mitte fuhr.
Nur ruhig bleiben!, hämmerte es in ihr.
Als sie die Stadt erreichte, stellte sie den Wagen irgendwo in einer Seitenstraße ab und ließ sich von einem Taxi zum Hafen fahren.
Sie hatte Glück. Sie würde noch das letzte Schiff erreichen, das heute nach Spanien abfuhr. Es dauerte endlos, bis sie es schließlich geschafft hatte, ein Ticket zu bekommen.
Und dann hieß es erneut warten. Hunderte von Marokkanern hatten sich hier am Hafen gesammelt. Die meisten von ihnen Männer, die in Frankreich oder Holland arbeiteten.
Ein dürrer, hohläugiger Mann, der doppelt so alt wirkte, wie er wirklich war, trat an Elsa heran und bot ihr Haschisch an. Erst auf Französisch, dann auf Englisch, schließlich auf Deutsch.
Elsa tat so, als bemerke sie ihn nicht, blickte zur Seite, ging ein paar Schritte weiter. Aber der Kerl war hartnäckig, so hartnäckig, wie ein Vertreter seiner Zunft eben nur sein konnte.
„Verschwinde!“, sagte sie unfreundlich und genervt. „Ich will nichts von dir!“
„Very good quality!“
„Hau ab!“
Er machte noch einen eher halbherzigen Versuch, mit ihr ins Geschäft zu kommen, dann zog er endlich ab.
Elsa ließ ihre Tasche nicht aus der Hand. Sie wusste, dass man hier im Hafen höllisch aufpassen musste, dass man nicht etwas ins Gepäck gesteckt bekam, was einem später Ärger machte.
Dann kamen die Zollkontrollen, die umständlich und bürokratisch vor sich gingen. Wirklich scharf kontrolliert wurde aber nur das Gepäck der Marokkaner.
Der Beamte, der sich Elsas Pass vornahm, hatte eine prächtige Uniform und schien sich vorzukommen wie ein Vier-Sterne-General. Er machte eine große Geste und musterte Elsa. Erst das Gesicht, dass er mit dem Passbild verglich, dann glitt sein Blick tiefer und blieb an ihren Schuhen hängen. Und dann sah es auch Elsa. Sie erschrak. Ihr rechter Turnschuh hatte rote Flecken. Blut...
Bei ihrer Flucht war sie wohl hineingetreten. Jetzt war es angetrocknet. Elsa fühlte ihren Puls bis zum Hals schlagen. Sie dachte an den schrecklichen Ort, von dem sie geflohen war. Wenn jemand dorthin kam, und alles so vorfand, wie es jetzt war, was musste er davon halten?
Sechs Leichen.
Die Waffe!, kam es ihr in den Sinn. Sie hatte die Waffe des Schwarzbarts einfach fallen lassen. Sicher würde man ihre Fingerabdrücke daran noch finden können... Sie hatte in der Eile einfach nicht daran gedacht. Warum auch? Sie war ja keine vorsätzliche Mörderin, die ihre Tat sorgfältig geplant hatte...
Und dann ihre Schuhe... Wenn sie in eine Blutlache getreten war, dann gab es auch Fußspuren... Spuren, die zu ihren Turnschuhen passten!
Nur ruhig bleiben!, versuchte sie sich einzureden. Sicher hat noch niemand entdeckt, was passiert ist...
Der Beamte lächelte und gab ihr den Pass zurück. Bei europäischen Touristinnen hatte er offenbar schon ganz andere Verrücktheiten gesehen, als einen rotgefleckten Turnschuh.
Eine halbe Stunde später stand Elsa an der Reling des Schiffes, das sie nach Algeciras bringen würde und das sich gerade anschickte, die Bucht von Tanger zu verlassen.
Es war kühl hier draußen, und sie fror ein wenig.
ENDE
ABENDESSEN MIT KONVERSATION
Es ist eine traurige Sache.
Warum bleiben sie nicht?
Warum erschrecken sie, wenn sie das Haus betreten? Weshalb beklagen sie alle sich über einen bestimmten Geruch, von dem sie nicht sagen können, wodurch er verursacht wird?
Sie wollen nicht bleiben und mit mir reden.
Ich weiß nicht warum.
Ist es zuviel, was ich verlange?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Und doch, es ist immer dasselbe. Sie wollen nicht bleiben. Ich kann von Glück sagen, wenn sie sich wenigstens mit mir an den gedeckten Tisch setzen.
Ich zünde die Kerzen an.
Der Schein des Lichts fällt auf ihre ebenmäßigen Züge und taucht sie in ein diffuses Licht.
Ich konnte sie nicht gehen lassen.
Ich konnte einfach nicht.
"Sie wollen wirklich schon gehen?"
Ihr Gesicht wirkt verlegen.
"Ja."
"Aber..."
"Ich muss mich auf den Weg machen. Verstehen Sie mich doch, es ist höchste Zeit..."
"Ich habe den Tisch gedeckt!"
"Hören Sie, ich will Sie nicht kränken, aber..."
"Aber?"
"Ich weiß nicht, ob es richtig war, Ihre Einladung anzunehmen... Was ich sagen will ist..."
"Sie können mir das nicht antun! Ich habe für Sie gekocht!"
"Das ist sehr nett, aber - "
"Alles ist vorbereitet... "
Sie runzelt genau in diesem Moment die Stirn.
"Vorbereitet?"
Viele von ihnen haben genau in diesem Moment die Stirn gerunzelt.
Ich kann es unmöglich erklären, aber es ist so.
Ich habe kein gutes Gefühl.
"Es gibt Lachs in Kräuterbutter. Dazu einen guten Wein. Es wird Ihnen schmecken..."
Ich habe etwas Scheußliches getan.
Naja, das haben die meisten vielleicht irgendwann schonmal in ihrem Leben. Aber das, was ich getan habe, ist von besonderer Scheußlichkeit. Ich weiß es, aber ich kann es nicht ändern.
Ich empfinde auch keine Schuld.
Es ist so gekommen.
Aus.
Fertig.
Reden wir über etwas anderes.
Ich sehe ihr in die Augen, diese leuchtend blauen Augen, die mich eigentlich ganz friedlich anblicken.
Sie sitzt mir gegenüber, mit diesen Augen, mit ihrem schmalen Mund, mit ihrem feingeschnittenen Gesicht. Ihr Mund lächelt nicht mehr. Er ist vielmehr unbeweglich, etwas starr, ich weiß auch nicht.
Ich hebe mein Glas und proste ihr zu.
Sie schweigt.
Ich rede mit ihr. Oder besser: Ich erzähle ihr alles mögliche. Über mich. Über meine Ansichten. Über Gott. Und die Welt.
Nein, vielleicht doch nicht über Gott. Was ich damit sagen will ist folgendes: Gott hat in dieser Geschichte eigentlich nicht allzuviel verloren.
Ich sollte ihn aus dem Spiel lassen.
Um seinetwillen.
Mein Mund produziert Worte. Eins nach dem anderen, ohne Unterlass. Eigentlich bin ich ein schweigsamer Mensch, vielleicht sogar schüchtern. Ich lebe zurückgezogen mit meinen drei Katzen. Das Haus, in dem ich wohne, liegt etwas abseits, nicht weit von der Steilküste entfernt.
Ich habe es für mich allein und das ist gut so.
Oft bin ich oben bei den Klippen.
Es herrscht immer ein starker Wind dort.
Man trifft Leute dort. Touristen. Manchmal komme ich mit ihnen ins Gespräch und lade jemanden zu mir nach Hause ein.
Zum Essen.
Die meisten wollen nicht, aber bei einigen gelingt es mir.
Kein Mensch kann immer allein sein. Kein Mensch. Auch ich nicht.
Ein Tag vergeht. Und ein weiterer.
Ich lasse sie am Tisch sitzen. Sie blickt mich starr an, wenn wir uns unterhalten.
Hätte ich sie doch gehen lassen sollen?
Vielleicht.
Ich konnte es nicht.
Es war einfach unmöglich.
Ich brauchte sie.
Und ich hoffe nur, dass ich ihr nicht allzu sehr wehgetan habe. Jedenfalls hat sie nicht geschrien. Sie war wohl sofort tot. Ganz bestimmt.
Am vierten oder fünften Tag nahm ich sie über die Schulter und setzte sie in einen der großen Ohrensessel, die bei mir im Wohnzimmer stehen. Wir saßen beieinander. Es war schön.
Jedenfalls besser, als wenn man alleine dasitzt.
Von Tag zu Tag gab es mehr Fliegen im Haus und mir war klar, woher das kam.
Ich betrachtete wehmütig ihr Gesicht.
Schade, aber ich würde mich von ihr verabschieden müssen.
Ich schob es noch ein paar Tage vor mir her. Schließlich hatte ich mich an ihre Gesellschaft gewöhnt.
Dennoch, es war unvermeidlich.
Ich löste ein paar Fußbodenbretter, unter denen ich eine Art Grube angelegt hatte, und legte sie zu den anderen.
ENDE
EIN PROFI GIBT NICHT AUF
Joe Martinez steckte das Zielfernrohr auf das Gewehr und legte an. Von hier, dem siebten Stock eines Rohbaus, aus dem irgendwann einmal das Bürogebäude eines mittelgroßen Versicherungskonzerns werden sollte, hatte Martinez eine hervorragende Aussicht auf das ehrwürdige Gerichtsportal. Es konnte nicht mehr allzu lange dauern, dann würde Gordon Smith durch dieses Portal geführt werden - jener Mann, dem Martinez eine Kugel in den Kopf jagen wollte... Martinez war ein Profi-Killer, sein Ruf in Syndikats- und Unterweltkreisen mehr als hervorragend! Er arbeitete schnell und präzise. Und vor allem konnte man sich auf ihn verlassen! Wenn er einen Auftrag annahm, konnte man todsicher davon ausgehen, dass er die Sache auch durchzog. Joe Martinez hatte noch nie versagt. Martinez verengte die Augen ein wenig. Der Finger am Abzug spannte sich, als der gepanzerte Wagen vorfuhr. Sicherheitsbeamte stiegen aus und blickten sich mit der Waffe im Anschlag nach allen Seiten um. Und dann kam endlich Gordon Smith zum Vorschein, von beiden Seiten von Polizisten eingekeilt. Gordon Smith musste sterben. Martinez wusste über diesen Mann zwar kaum mehr, als man aus der Presse erfahren konnte, aber die Sache lag wohl ziemlich klar auf der Hand. Smith sollte als Kronzeuge gegen einige große Nummern des organisierten Verbrechens aussagen, wodurch diese vielleicht endlich hinter Gitter kamen. Natürlich war diesen Leuten kaum ein Preis zu hoch, um Smith aus dem Weg zu räumen. Und so hatten sie über einen Mittelsmann Joe Martinez angeheuert - den Besten seines Fachs. Martinez hielt den Atem an.
Smith befand sich nun genau in seinem Fadenkreuz. Unter seiner Kleidung trug der Kronzeuge sicher eine kugelsichere Weste. Das bedeutete, dass Martinez den Kopf treffen musste, wenn er sichergehen wollte. Noch einen Sekundenbruchteil wartete er ab, dann glaubte er den richtigen Zeitpunkt für gekommen und feuerte. Martinez wusste, dass er wahrscheinlich nicht mehr als einen Schuss haben würde. Aber für einen Profi seiner Klasse reichte das in der Regel auch.
Und genau so schien es auch diesmal zu sein. Durch das Zielfernrohr beobachtete er, wie Smith getroffen zu Boden stürzte. Die Sicherheitsbeamten rotierten und ließen irritiert die Köpfe kreisen. Martinez lächelte kalt und packte sein Gewehr in eine Tasche für Golfschläger. Es hatte ihn niemand gesehen.
*
Joe Martinez wohnte in einer schäbigen Absteige, in der man sich nicht sonderlich um Identität und Herkunft der Gäste kümmerte, solange im Voraus bezahlt wurde. Gestern Abend war er in die Stadt gekommen und morgen früh würde er sie auch schon wieder verlassen. Bis zum nächsten Auftrag vielleicht. Die erste Hälfte seines Honorars hatte man ihm bereits im Voraus bezahlt, die zweite würde wohl irgendwann in den nächsten Tagen auf seinem Züricher Bankkonto eingehen. Alles war glattgegangen. Leicht verdientes Geld! dachte Martinez, bis er am nächsten Morgen eine böse Überraschung erlebte, als er die Morgenzeitung aufschlug. Über das Attentat auf den Kronzeugen Gordon Smith wurde groß berichtet. Und Martinez glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als er da lesen musste, dass Smith noch lebte! Smith lag schwerverletzt im Städtischen Krankenhaus und war bis auf weiteres nicht vernehmungsfähig. Martinez ballte grimmig die Rechte zur Faust. Er würde noch einmal in Aktion treten müssen! Schließlich war er Profi und hatte immerhin einen exzellenten Ruf zu verlieren. Und diesmal vielleicht sogar noch mehr!, durchzuckte es ihn fröstelnd. Denn es mochte gut sein, dass seine Auftraggeber es ihm nicht verzeihen würden, wenn er versagte... Schließlich ging es ja auch für sie um die Existenz. Martinez würde die Sache also zu Ende bringen müssen. Um jeden Preis!
*
Joe Martinez besorgte sich in einem einschlägigen Fachgeschäft einen weißen Kittel. Natürlich konnte er sich bei seiner Anmeldung nicht einfach danach erkundigen, in welchem Zimmer man Gordon Smith untergebracht hatte. Das hätte nur Verdacht erregt. Und wahrscheinlich führte man den Kronzeugen sogar unter falschem Namen. So musste er also suchen. Flur um Flur ging Martinez durch, bis er schließlich fündig wurde. Vor einem Krankenhauszimmer hatte ein uniformierter Beamter Posten bezogen. Das musste es sein! Martinez versuchte wie selbstverständlich an dem Wachmann vorbeizugehen, aber dieser trat ihm in den Weg.
"Wer sind Sie?"
"Dr. Morton, Facharzt für Neurologie. Der Patient hat eine schlimme Kopfverletzung. Und da vielleicht das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen ist, meinte der Chef, ich sollte ihn mir mal ansehen!"
"Der Chef? Sie meinen Dr. Miller!"
"Ja, genau den!" Der Wachmann trat zur Seite. "Gehen Sie hinein!", meinte er. Und Martinez dachte: Jetzt ist es so gut wie geschafft!
Er würde eintreten, die Tür hinter sich schließen, dann die Schalldämpferpistole unter dem Kittel hervorziehen und abdrücken. Eine Sekundensache.
*
Mit einem schnellen Schritt war Martinez im Krankenzimmer und seine Rechte hatte bereits nach der Waffe unter dem Kittel gegriffen, da erstarrte er mitten in der Bewegung. Er blickte direkt in die Mündungen einiger Revolver. Jemand hielt ihm eine Polizeimarke unter die Nase. "Wir wussten, dass es ein Profi sein musste, der es auf Smith abgesehen hatte", erklärte einer der Kriminalbeamten, während Martinez ein anderer die Waffe abnahm und ihm Handschellen anlegte.
Martinez fluchte.
"Ich begreife nicht...", murmelte er.
"Wir brauchten nur warten", fuhr der Beamte fort. "Ein Profi gibt schließlich nicht auf, stimmt's?" Er grinste. "Ich schätze, wir haben irgendwo ein schönes Foto von Ihnen in unseren Karteien..."
"Und wo ist Smith?", knurrte Martinez.
"An einem sicheren Ort, wo er sich vermutlich besser von seiner Schussverletzung erholen wird als hier!", war die trockene Antwort.
ENDE
DAS LINKE BEIN
Ralph Jakobs bemerkte nicht, wie drei Augenpaare ihn beobachteten, während er sein Glas austrank, bezahlte und gemessenen Schrittes das Lokal verließ. "Seht mal, wen haben wir denn da: Unseren hochverehrten Herrn Bankdirektor!", murmelte Larbach, einer der Beobachter mit deutlich ironischem Unterton. Sein Mund verzog sich spöttisch, als er noch hinzusetzte: "Ist er nicht ein feiner Herr, unser Herr Jakobs?"
"Er ist schlicht und einfach ein Schwein!", brummte Bronner, der neben ihm saß, den Blick ins Glas gerichtet. "Allerdings habe ich eine ganze Weile gebraucht, um das zu merken!", setzte er noch naserümpfend hinzu. "Jahrzehntelang war er mein bester Freund. Und dann hat er mich ruiniert. Einfach so, ohne mit der Wimper zu zucken. Er zertrat meine Karriere - mein ganzes Leben - mit einer Gleichgültigkeit, mit der man für gewöhnlich ein störendes Insekt erschlägt." Tief empfundene Bitterkeit lag in Bronners Tonfall.
"Wie kam das?", fragte Neubauer, der dritte am Tisch.
"Die Geschichte ist schon Jahre her", berichtete Bronner zögernd. "Jakobs und ich waren beide in der hiesigen Bankfiliale beschäftigt."
"... deren Direktor Jakobs jetzt ist", vervollständigte Larbach, der Bronners Geschichte kannte. "Genau! Nun, um es kurz zu machen: Ich hatte mich damals finanziell etwas übernommen - Familie gegründet, ein Haus gekauft und so weiter und so fort. Andererseits war ich nicht bereit, Abstriche an meinem Lebensstandard zu machen. Wofür legt man sich schließlich krumm, frage ich Sie! Jedenfalls nicht, damit alles von Raten, Tilgung und Zinsen aufgefressen wird und einem nichts bleibt, um sich zu amüsieren!"
"Das kann ich verstehen!", meinte Neubauer.
"Nun, ich ließ mich dazu hinreißen, meine Probleme auf illegalem Weg - zumindest vorübergehend - zu lösen. Ich sah damals keinen anderen Ausweg, als mir bei der Bank, bei der ich beschäftigt war, Geld zu beschaffen. Hier eine kleine Manipulation am Computer, dort eine weitere... Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze auffliegen würde, war eins zu tausend, und ich beabsichtigte ja auch, zum Schluss alles wieder in Ordnung zu bringen. Ein zinsloses Darlehen, so könnte man es ausdrücken, das war alles. Mehr wollte ich gar nicht und wahrscheinlich wäre die Sache auch längst vergessen, wenn Jakobs mir nicht auf die Schliche gekommen wäre."
"Wie hat Jakobs reagiert?", fragte Neubauer und nahm einen Schluck aus seinem Glas. "Lassen Sie mich raten: Er hat Sie verpfiffen!"
Bronner nickte mit versteinertem Gesicht. "Ja, das hat er. Wir waren Freunde - seit der Schulzeit, verstehen Sie? Er hätte nur so zu tun brauchen, als hätte er nichts gesehen und vielleicht eine Woche abwarten müssen. Aber nein, das konnte er für seinen alten Schulfreund nicht tun! Er musste zum Direktor laufen und mich anschwärzen... Seiner Karriere hat es jedenfalls nicht geschadet: Er sitzt heute selbst auf dem Direktionssessel, während ich rausgeworfen wurde. Natürlich sprach sich die Sache im Bankgewerbe herum und so gelang es mir nicht, dort je wieder Fuß zu fassen. Heute verdiene ich meine Brötchen mit dem Verkauf von Lebensversicherungen..." Er atmete schwer, seine Augenbrauen zogen sich zusammen. "Ein sozialer Abstieg, kann ich Ihnen sagen! Hätte Ralph Jakobs sich damals anders verhalten vielleicht würde ich heute auch eine Filiale leiten, wer weiß?" Seine Augen waren gerötet. "Sie wissen nicht, wie das ist", murmelte er an Neubauer gewandt. "Sie sind selbständiger Konditor, Ihr Geschäft geht gut, Sie können sich nicht vorstellen, wie man sich fühlt, wenn alte Freunde einem aus dem Weg gehen..."
Neubauer legte Bronner eine Hand auf die Schulter. "Vielleicht verstehe ich Sie viel besser, als sie meinen!", erklärte er, woraufhin Bronner ihn ungläubig anstarrte. "Sie kennen sicher Frau Jakobs, nicht wahr?", fragte Neubauer.
"Flüchtig. Sie war zuvor schon einmal verheiratet, soweit ich gehört habe."
"Sie haben richtig gehört", griff Neubauer den Faden auf. "Frau Jakobs war bereits einmal verheiratet. Mit mir."
"Ach", sagte Bronner. "Das ist ja interessant!"
"Eine traurige Geschichte", fuhr Neubauer fort. "Wenn Sie so wollen, bin ich auch ein Jakobs-Geschädigter. Als ich Franziska kennenlernte, war ich ein kleiner Angestellter, dessen Lohn gerade ausreichte, um die Familie über Wasser zu halten. Aber Franziska genügte das nicht. Sie wollte mehr, ihre Ansprüche an das Leben waren größer, vielleicht sogar maßlos. Als die Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, suchte sie sich auch Arbeit, um mitzuverdienen, aber auch das reichte ihr bald nicht mehr. Sie wollte Luxus, teure Mode, ein eigenes Haus, mehr soziales Prestige... Sie trietzte mich so lange, bis ich bereit war, weiterzulernen und meinen Konditormeister zu machen. Schließlich war ich soweit und hatte mein eigenes Geschäft. Franziskas Sucht nach Höherem war für eine Weile gestillt.
Vielleicht hätte es ihr gereicht, vielleicht wäre sie damit zufrieden gewesen, wenn... wenn Ralph Jakobs nicht aufgetaucht wäre. Wir lernten ihn bei irgendeiner Gelegenheit kennen und von da an hatte ich nicht mehr die geringste Chance, den Wettlauf mit der Zeit zu gewinnen. Was ist schon ein Konditormeister gegen einen Bankdirektor? Nichts!"
"Ich sagte ja, dass er ein Schwein ist, unser Bankdirektor", kommentierte Larbach Neubauers Geschichte. "Der Mann schreckt vor nichts zurück."
"Ich könnte ihn umbringen!", meinte Bronner, wobei er mit der geballten Faust auf den Tisch schlug. "Was hat er Ihnen getan?" fragte Neubauer an Larbach gewandt. "Er muss Ihnen etwas getan haben, sonst würden Sie kaum so bitter über ihn reden." Larbach nickte. "Und ob er mir etwas getan hat! Er hat meinen Sohn totgefahren, aber er hatte die besseren Rechtsanwälte.
Man konnte ihm kein schuldhaftes Verhalten nachweisen... Aber Irgendwann wird er sich vor einem anderen, höheren Richter verantworten müssen und dort wird er sich nicht herausreden können!"
*
Ein paar Tage waren vergangen. Die Dunkelheit war bereits hereingebrochen, als Ralph Jakobs sich auf den Weg nach Hause machte. Er hatte ein Lokal besucht, etwas getrunken und versucht abzuschalten. Es waren nur ein paar hundert Meter bis zu seinem Haus und er war schon fast angekommen. Da tauchte aus dem Schatten eine Gestalt auf. Es war ein Mann, der das linke Bein beim Gehen etwas nachzog. Jakobs erkannte den Hinkenden sofort und dachte: Was will der denn hier? Dann umgab den Bankdirektor auf einmal nur noch Schwärze.
*
In der nächsten Woche trafen sie sich wieder zu gewohnter Stunde an ihrem Tisch: Larbach, Neubauer und Bronner. Natürlich redeten sie über Jakobs, dessen Tod groß in der örtlichen Tageszeitung gestanden hatte. Man wusste nur, dass er mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen worden war. Ansonsten tappte die Polizei völlig im Dunkeln.
"So einer wie Jakobs hat sicherlich eine Menge Feinde!", meinte Bronner.
"Und drei dieser Feinde sitzen hier an diesem Tisch!", setzte Larbach hinzu.
"Nun erlauben Sie mal!", empörte sich Bronner. "Vermuten Sie den Mörder unter uns?"
"Ist das so abwegig?" Larbach grinste. "Wir haben schließlich alle drei ein ausreichendes Motiv, oder etwa nicht? Jeder von uns könnte ihn umgebracht haben. Sie selbst haben eine dahingehende Bemerkung gemacht..."
Bronner wurde blass und so beschwichtigte Larbach ihn sogleich: „Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Der Kerl hat es verdient, ich verurteile diesen Mord keineswegs!"
"Jakobs hat es wirklich verdient!", meinte Neubauer. „Man sollte den Mörder zu seiner Tat beglückwünschen."
"Vielleicht waren Sie ja selbst der Mörder", sprach Larbach ihn mit einem diabolischen Lächeln auf den Lippen an. "Wo waren Sie am Mittwoch, so gegen zehn Uhr abends?"
"Beim Tennis. Wie jeden Mittwoch."
"Und ich war zu Hause", erklärte Bronner eiligst, woraufhin Larbach verächtlich abwinkte. "Das kann jeder behaupten. Wo waren Sie tatsächlich?"
"Es ist doch für jeden von uns eine Leichtigkeit, sich ein Alibi zuzulegen!", schnaufte Neubauer.
"Was soll eigentlich dieses Räuber-und-Gendarm-Spiel?", fragte Bronner ärgerlich.
Larbach lächelte. "Ist es denn nicht interessant, mal ein bisschen Gendarm zu spielen? Es war sehr aufschlussreich, zu sehen, wie Sie darauf reagiert haben..." Er erhob sich. "Ich muss jetzt leider gehen. Es ist schon spät." Dann ging Larbach dem Kellner entgegen und bezahlte, bevor er sich dem Ausgang zuwandte und das Lokal verließ. Er zog ein wenig das linke Bein nach.
ENDE
ZUM DESSERT: EIN MORD!
Sie hatten sich zu einem gepflegten abendlichen Tete-a-tete verabredet.
"Ich kann auch über Nacht bleiben", hatte Nadine gesagt.
"Sagt dein Mann nichts dazu?"
"Nein, Robert."
"Aber..."Er runzelte die Stirn.
"Die Wahrheit ist: Ich habe ihn schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen."
"Hattet ihr Streit?"
"Ja, ein bisschen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm kommt und er einfach davonläuft und nicht wieder auftaucht."
Jetzt saßen sie vor einem vorzüglichen Essen. Robert war ein guter Hobby-Koch und hatte sich gehörig ins Zeug gelegt.
Es war ein alter Jugendtraum von ihm, Koch in einem Restaurant der haute cuisine zu sein. Aber daraus war nichts geworden.
Er hatte Jura studiert und war Anwalt geworden.
Robert hatte Lachs mit Kräuterbutter auf den Tisch gebracht und er sah mit Genugtuung, dass Nadine solche Kostbarkeiten zu würdigen wusste.
Sie hoben die Weingläser und prosteten sich zu.
"Auf meinen charmanten Gast", sagte Robert.
"Auf einen excellenten Koch!", erwiderte Nadine freundlich lächelnd. "Und auf einen faszinierenden Mann!"
"Sagen wir einfach: Auf uns!"
Sie nickte.
"Ja, das ist gut. Damit bin ich auch einverstanden."
Zum Nachtisch gab es köstliche Eistorte. Robert hatte sie selbstverständlich eigenhändig kreiert.
Nadine dachte kurz an ihren Mann und daran, was er wohl sagen würde, wenn er sie hier mit Robert hätte sehen können.
Nadines Mann war temperamentvoll und sehr eifersüchtig. Und vor allem war er nicht bereit, Nadine freizugeben Nadine wiederum war keine sehr starke Persönlichkeit. Sie hatte zwar schon oft Robert gegenüber angekündigt, dass sie sich nun endlich von ihrem Mann trennen wollte, aber wenn es dann ernst wurde, schreckte sie regelmäßig davor zurück.
Das war ein Punkt, den Robert nur schwer schlucken konnte und den er auch nicht verstand.
Er musste es hinnehmen, schon deshalb, weil ihm wirklich etwas an Nadine lag. Er würde ihr soviel Zeit geben, wie sie brauchte.
"Was weiß dein Mann eigentlich von mir?", fragte Robert.
"Er weiß, dass da etwas ist. Aber er weiß keinen Namen. Er kennt dich also nicht, jedenfalls soweit ich weiß." Sie lachte und zeigte dabei ihre strahlend weißen Zähne. "Und das ist auch gut so, Robert!"
"Ich weiß nicht. Vielleicht würde es einiges klären..."
"Das glaube ich nicht! Ich kann dir sagen, was passieren würde, Robert!"
"Und was bitte?"
"Er käme hier vorbei, würde mit einem hochroten Kopf bei dir klingeln und dich dann gleich beim Kragen packen."
"Und dann?"
Sie zuckte mit den Schultern.
"Vielleicht - wenn er verhältnismäßig ausgeglichen ist - würde er eine ernste Warnung aussprechen. 'Lassen Sie in Zukunft die Finger von meiner Frau!' oder so ähnlich würde sich das anhören."
Robert verzog das Gesicht.
"Dein Mann ist doch keine Figur aus diesen alten Wildwest-Filmen!"
"Er benimmt sich aber so."
Robert schien das Ganze zu amüsieren.
"Wie ginge es dann weiter?"
"Vielleicht würdest du einen Kinnhaken abbekommen, vielleicht auch eine ausgewachsene Tracht Prügel..."
"Klingt nicht sehr verlockend."
"Was würdest du tun, Robert?" Sie schien auch zunehmend Gefallen an dieser Art der Gedankenspielerei zu entwickeln. "Mein Mann ist über eins neunzig groß und ein ziemlich breiter Schrank."
"Kein Problem, Nadine!"
Robert griff blitzschnell unter sein Jackett und zog eine Pistole hervor. Nadine erschrak.
"Mein Gott, Robert! Das... Das wusste ich bisher nicht!"
"Habe ich dir nicht erzählt, dass ich Sportschütze bin und eine Waffen besitze?"
"Doch, das wohl. Aber ich wusste nicht, dass du sie ständig bei dir trägst!"
Er zuckte mit den Schultern. "Ich habe oft genug die Opfer von Gewalttaten vor Gericht vertreten müssen. Wir leben in einer gefährlichen Zeit und ich möchte nicht eines Tages selbst zu diesen Opfern gehören."
Sie atmete tief durch. "Ja, das verstehe ich. Aber wenn man so etwas sieht, verschlägt es einem im ersten Moment einfach die Sprache..." Dann blitzte es in ihren Augen. "Würdest du meinen Mann erschießen, wenn er hier auftauchen würde?"
Er nickte. "Warum nicht? Wären damit nicht alle meine Probleme gelöst? Ich hätte dich endlich für mich gewonnen..."
Sie lächelte freundlich und fasste seine Hand. "Leider ist das wohl kein gangbarer Weg", meinte sie.
"Weshalb nicht?"
"Du scherzt! Aber im Ernst: Weil die meisten Morde irgendwann einmal aufgeklärt werden. Bei Autoeinbrüchen ist das anders, da hat man als Täter eine Chance. Aber nicht als Mörder, Robert."
Sie lachten beide herzhaft. Der Wein hatte sie bereits etwas beschwipst und ihre Zungen gelockert.
"Weißt du, weshalb die meisten am Ende gefasst werden?", fragte sie und gab auch gleich die Antwort: "Weil sie keinen wirklich guten Ort wissen, an dem man die Leiche verstecken kann!"
"Man könnte meinen, du hättest praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet!"
"Nein. Ich habe nur jede Menge Romane gelesen." Um ihre Mundwinkel spielte ein schwer zu deutendes Lächeln. "Angenommen, mein Mann wäre hier aufgetaucht, hätte dich zur Rede gestellt, vielleicht auch angegriffen und du hättest ihn erschossen... Wo hättest du die Leiche versteckt? In den Fluss geworfen? Im Garten vergraben?"
"Bevor wir uns darüber unterhalten, Schatz: Möchtest du zum Schluss noch einen Cappuccino?"
"Oh, ja, gerne."
"Gut, dann gehe ich schnell in die Küche und mach uns einen!"
Sie sah ihm nach und dann fiel ihr Blick auf die restlichen Stücke der Eistorte, die zu schmelzen begonnen hatten. Nein, es wäre doch wirklich zu schade drum gewesen! Die Torte musste schnellstens wieder eingefroren werden, wenn man sie noch retten wollte! Nadine zögerte nicht lange. Sie kannte sich in Roberts Bungalow gut aus, fast wie zu Hause.
Sie nahm die Torte und lief mit ihr in den Keller, wo sich die Vorratskammer befand. Nadine stand zwei Tiefkühlschränken gegenüber, die vermutlich mit Delikatessen angefüllt waren.
Nadine wusste nicht, in welchen die Torte gehörte.
Sie versuchte es beim rechten Eisschrank und öffnete die Tür. Die Torte fiel ihr vor Schreck aus der Hand, als sie in das ihr wohlbekannte Gesicht ihres Mannes blickte.
ENDE
TÖDLICHE TROPFEN
Sie trafen sich so oft es ging, ohne dass Anne bei ihrem Mann damit Misstrauen erregte. Meistens an einem neutralen Ort, in einem Cafe zum Beispiel. Anschließend gingen sie oft noch in seine Wohnung.
Das machte keinerlei Schwierigkeiten. Vor Jahren war er verheiratet gewesen, so hatte er ihr erzählt, aber seit seiner Scheidung lebte er allein.
"Diese Nachmittage gehen so schnell vorbei!", sagte sie seufzend und schaute dabei auf die Uhr. "Robert, ich glaube nicht, dass ich das noch lange aushalte!"
Robert Burger zuckte mit den Schultern.
"Lass dich scheiden, dann bist du wieder frei und kannst tun und lassen, was du willst!"
Anne machte ein ziemlich ratloses Gesicht.
"Haben wir das nicht schon oft genug durchdiskutiert!"
Burger nickte. Ja, das hatten sie. Anne und ihr Mann hatten sich auseinander gelebt, es gab kaum noch Gemeinsamkeiten, jeder lebte sein Leben neben dem des anderen, ohne dass es dabei mehr Berührungspunkte gab, als unbedingt nötig.
Burger verzog das Gesicht und musterte seine Geliebte mit einer Spur von Abschätzigkeit. "Ein goldener Käfig ist dir letztlich doch lieber, als die Freiheit", stellte er mit einer Spur Bitterkeit fest. Als Anne geheiratet hatte, war sie naiv genug gewesen, zu glauben, dass ihre Liebe ewig halten würde. An ein Ende hatte sie nicht einen Gedanken verschwendet und als sie dann Paul Emmerich, den jungen Erben einer gutgehenden Kaufhauskette heiratete, hatte sie gegen eine Gütertrennung nichts einzuwenden gehabt.
Warum auch? Sie war in kleinen Verhältnissen groß geworden und daher überzeugt, jederzeit auch wieder ohne den Luxus auskommen zu können, den sie bei ihrem Mann kennenlernen sollte.
Aber mittlerweile waren über zwanzig Jahre vergangen, und die hatten sie in dieser Hinsicht vielleicht ebenso stark geprägt, wie die Zeit davor.
Sie konnte nicht mehr dorthin zurück, woher sie gekommen war.
Anne schaute noch einmal auf die Uhr.
"Es ist höchste Zeit. Ich muss zu Hause sein, bevor Paul aus dem Büro kommt..."
"Es wird also alles beim Alten bleiben..."
Sie zuckte mit den Schultern. Burger war ein biederer Steuerberater. Selbstständig zwar, aber er würde ihr kaum das bieten können, was sie von Paul gewohnt war.
"Wenn ich mich scheiden lasse, bekomme ich nichts", erklärte sie kühl. "Aber im Falle seines Todes bin ich erbberechtigt..."
"Und dein Sohn - Thomas?"
"Es würde genug für mich übrigbleiben." Sie lächelte ihn rätselhaft an. "Mehr jedenfalls, als du je auf einem Haufen gesehen hast!" Sie zuckte mit den Schultern. "Leider erfreut Paul sich blendender Gesundheit!"
Robert Burger lächelte etwas unsicher zurück. "Du willst doch wohl nicht etwa vorschlagen, dass man da - wie soll ich sagen? - etwas nachhelfen sollte?"
Anne Emmerichs Gesicht wurde auf einmal ziemlich ernst.
"Man kommt auf die seltsamsten Ideen, nicht wahr...?"
*
Am folgenden Tag erreichte Burger ein aufgeregter Anruf von Anne. Sie schien völlig außer sich zu sein.
"Paul ist tot", sagte sie.
"Was?"
"Die Polizei war hier, sie haben Fragen gestellt, ich -"
"Wodurch ist dein Mann gestorben?"
"Gift..."
"Mein Gott... Mord!"
"Robert, wir müssen uns unbedingt treffen!"
Sie hat es wirklich getan!, durchzuckte es ihn. Sie hat ihn umgebracht! Dieses Maß an Entschlossenheit hatte er ihr gar nicht zugetraut!
*
Anne Emmerich trug eine Sonnenbrille, als sie das Cafe betrat, in dem sie ihren Treffpunkt vereinbart hatten. Der Kragen ihres Mantels war hochgeschlagen und sie blickte sich ständig um.
"Glaubst du, dass dir jemand folgt?", fragte Burger stirnrunzelnd.
"Es wäre möglich, dass die Polizei mich beschattet."
"Hat man dich in Verdacht?"
"Robert, sie wissen von unserem Verhältnis! Früher oder später werden die Kripo-Leute auch bei dir auftauchen."
"Verdammt, Anne! Konntest du mich da nicht rauslassen?"
Sie zuckte mit den Schultern.
"Sie wissen es nicht von mir. Paul hat mich beschatten lassen und bei der Durchsicht seiner Sachen sind sie auf die Ermittlungsberichte eines Privatdetektivs gestoßen... Ich hatte nichts damit zu tun!"
"Und ich möchte nichts mit einem Mord zu tun haben!"
"Glaubst du, mir ist das angenehm?" Sie atmete heftig.
"Ich brauche jetzt deine Unterstützung! Wer, wenn nicht du, sollte mir jetzt beistehen. Mein ehrenwerter Sohn vielleicht? Du weißt doch, was mit ihm ist!"
Burger wusste es. Thomas Emmerich war ständig betrunken und ein notorischer Spieler. Glücklicherweise war er als Sohn eines reichen Vaters geboren worden, der die horrenden Spielschulden - wenn auch zähneknirschend - begleichen konnte.
"Wie geht es jetzt weiter?", fragte Burger schwach.
"Ich brauche ein Alibi, Robert. Diese Kripo-Leute werden immer weiter bohren!"
*
"Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, Mutter!"
Als Anne Emmerich das Wohnzimmer betrat, fand sie ihren Sohn dort auf dem Sofa ausgestreckt. In der Rechten hielt er ein halbleeres Glas. Anne erstarrte.
"Was soll das heißen, Thomas."
"Das weißt du ganz genau!" Er verzog das Gesicht. "Du bekommst ein ansehnliches Vermögen, über das du frei verfügen kannst! Wolltest du das nicht immer?"
"Du ebenfalls, mein Sohn!"
"Ich mache dir keinen Vorwurf!" Er stand auf und griff nach einer Karaffe. "Möchtest du auch einen Drink, Mutter? Vielleicht beruhigt dich das etwas..."
Anne überlegte kurz, dann nickte sie.
Thomas reichte ihr ein Glas. Sie wollte es gerade an die Lippen setzen, da klingelte es an der Tür. Mit dem Glas in der Hand ging sie zur Tür und öffnete. Es war einer von den Kriminalbeamten.
"Lorant, mein Name. Vielleicht erinnern Sie sich noch", erklärte er.
"Ich erinnere mich."
"Darf ich hereinkommen?"
"Natürlich."
Sie gingen ins Wohnzimmer. Bevor Anne einen Schluck aus ihrem Glas nehmen konnte, fragte Lorant: "Hat Ihr Sohn Ihnen das eingeschenkt?"
"Ja, wieso?"
"Dann würde ich es nicht trinken!" Er nahm ihr das Glas ab." Das kommt ins Labor. Es könnte nämlich sein, Frau Emmerich, dass Ihr Sohn die zu erwartende Erbschaft nicht mit Ihnen teilen möchte..."
"Was meinen Sie damit?"
Lorant wandte sich an Thomas Emmerich.
"Wir haben den Apotheker gefunden, der Ihnen die tödlichen Tropfen verkauft hat. Er hat Sie auf einem Photo einwandfrei identifiziert!" Er hob das Glas, das er Anne abgenommen hatte. "Ich bin gespannt, was die Analyse ergibt..."
ENDE
DER KOPF-ABHACKER
"Haben Sie schon gehört?", fragte mich Mrs. Cross, als sie an meinen Bankschalter trat. "Loretta ist verschwunden."
Ich schluckte, sah der alten Dame in die Augen und wurde rot. Eine alte Krankheit von mir. Ich kann nichts dagegen machen. "Welche Loretta?", fragte ich.
"Wir haben doch nur eine Loretta hier im Ort. Loretta Grayson."
"Oh."
"Sie sind eigentlich noch ein bisschen jung für Gedächtnisschwund!"
"Liegt wohl daran, dass ich schon viel mitgemacht habe."
Es war keine besonders intelligente Antwort, das gebe ich zu, aber mir fiel halt nichts Besseres ein. Und außerdem konnte ich ihren unterschwellig tadelnden Tonfall nicht ausstehen. "Wie möchten Sie Ihre fünfzig? So wie immer?"
"Wie immer", nickte sie. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie nur in die Bank kam, um mit jemandem zu reden.
Deswegen hob sie ihre Rente in Fünfzig-Dollar-Raten ab. Wenn man so darüber nachdachte, dann war es schon ziemlich traurig.
Sie fing wieder an, von Loretta zu reden, obwohl ich gehofft hatte, dass sie damit aufhören würde. Aber die Sache schien Mrs. Cross ziemlich zu beschäftigen.
Mich auch.
Und das war auch der Grund dafür, dass ich nicht darüber reden wollte. Aber Mrs. Cross kümmerte das nicht. Ihre Worte plätscherten wie ein Wasserfall.
"Was denken Sie darüber?", erkundigte sie sich.
"Ich weiß nicht."
"Man hört jetzt soviel von diesem Wahnsinnigen. Sie wissen schon..."
"Hm."
"Ich meine den, der seinen Opfern den Kopf abhackt..."
Die Sache hatte groß in der Zeitung gestanden. Fünf Leichen, alle geköpft. Die Köpfe hatte man nie gefunden.
Genau der richtige Stoff, um alten Frauen den Schlaf zu rauben und ihnen einen Grund zu geben, sich das Maul zu zerreißen.
Und was war mit jungen Frauen?
Ein anderes Thema.
Ihre faltige Haut wirkte irgendwie reptilienhaft. Die Gläser ihrer Brille waren nahezu flaschendick.
"Sie haben sie doch ganz gut gekannt, oder?", fragte sie.
Ich zuckte etwas zusammen. Mein Gott, ich stierte sie an wie ein Alien-Monster, das direkt von einer stockigen Leinwand heruntergestiegen war.
"Wen?", fragte ich und schluckte. Ich konnte ihren Blick durch die dicken Brillengläser nicht sehen. Nur die tiefen Furche auf ihrer Stirn.
"Na, Loretta! Oh, Gott, jetzt rede ich schon in der Vergangenheit von ihr!"
Ich sagte: "Machen Sie sich keine Sorgen um Loretta."
"Meinen Sie?"
"Ganz bestimmt?"
"Ja. Ich habe sie heute Morgen noch gesehen."
"Wirklich?"
"Hören Sie, ich habe noch zu tun."
"Ja, sicher..."
"Bis zum nächsten Mal, Mrs. Cross!"
Sie humpelte davon. Ich atmete tief durch. Und dabei registrierte ich, dass Mrs. Cross einen sehr kurzen Hals hatte. Ich weiß auch nicht, warum mir das in diesem Moment auffiel. Ja, ein sehr kurzer Hals war das
Ich war ziemlich müde, als ich nach Hause kam. Das Haus hatte ich geerbt. Für mich allein war es viel zu groß, aber streng genommen lebte ich auch gar nicht allein. Das Haus war immer voller Freunde.
Immer.
Ich atmete tief durch, als ich die abblätternde Fassade sah. Mein Gott, das Haus brauchte mal wieder einen Anstrich.
Vielleicht im nächsten Frühjahr.
Vielleicht...
Ich schloss die Tür auf.
"Hallo?", rief ich. Dann legte ich den Schalter um. Der Strom ging an. Das Licht auch.
"Loretta?", fragte ich. Sie hatte die Augen geschlossen. Sie sah so friedlich aus, wenn sie die Augen geschlossen hatte. Ich ging zum Tisch, wo ich meine Apparatur aufgebaut hatte und legte einen Hebel um.
Etwas surrte.
Und es stank ein bisschen verschmort.
Loretta machte die Augen auf.
"Schön, dass du wieder da bist."
"War anstrengend heute in der Bank."
"Hat dir Mister Bascomp wieder zugesetzt?"
"Dieser Mann ist die personifizierte Nervensäge!"
"Mach dir nichts draus, Billy."
"Tu ich nicht."
"Irgendwann liegt Mister Bascomp unter der Erde und du bist Direktor!"
Ich zuckte die Achseln und machte ein ziemlich skeptisches Gesicht.
"Der ist ziemlich zäh."
"Du doch auch, oder?"
"Naja, geht so!"
Dann zischte es und ich fluchte vor mich hin. Weißer Qualm stieg auf. In meiner Apparatur gab es einen Kurzen. Loretta schloss die Augen. Sie schloss die Augen, als würde sie sagen wollen: "Welcher erwachsene Mann verbringt seine Zeit schon damit, solche Apparaturen zu bauen?" Aber sie sagte es nicht. Und sie sagte auch nicht, dass ich mit dem Zeug auf dem Tisch vermutlich irgendwann mir selbst das Dach über dem Kopf anzünden würde...
Sie sagte nichts.
War auch am besten so. Aber das war das Gute an ihr. Sie wusste einfach, wann sie den Mund halten musste.
Von vielen kann man das nicht sagen.
Am nächsten Tag stand etwas von einer Leiche in der Zeitung.
Sie war ganz in der Nähe in einem Maisfeld gefunden worden.
Und sie hatte keinen Kopf.
Die ganze Gegend sprach darüber.
Auch Dorothy, die in Bewleys Cafe arbeitete, wo ich immer in der Mittagspause hinging. Da ich meine Pause erst machte, als die Mittagszeit schon längst vorbei war, hatte sie Zeit, sich zu mir zu setzen.
Wir waren die einzigen in dem Laden.
"Ich frage mich, was er mit den ganzen Köpfen macht", sagte sie.
"Wer?"
"Na, der Verrückte!"
"Woher weißt du, dass es ein Mann ist?"
Sie zuckte die Achseln. "Habe ich einfach so angenommen. Übrigens habe ich gehört, dass die Tote Loretta Grayson sein soll."
"Ach, ja? Wie will man das sagen - ohne Kopf?"
"Ihre Sachen gehörten Loretta."
"Naja..."
"Furchtbar sowas."
"Schlimm."
"Willst du noch einen Kaffee, Billy?"
Ich hob die Schultern. "Sicher." Ich war etwas müde.
Ein bleiernes Gefühl hatte sich in mir breitgemacht. Es ging von meinem Kopf aus, begann irgendwo hinter der Stirn und es dauerte gar nicht lange, dann war es bis in die Zehenspitzen vorgedrungen.
"Ich würde dich gerne mal besuchen, Billy."
"Heute besser nicht."
"Wieso nicht?"
"Heute passt es schlecht."
"Vielleicht komme ich einfach mal vorbei, ja?"
"Ich weiß nicht..."
Als ich wieder zu Hause war, wurde mir klar, dass ich Loretta nicht wieder hinkriegen würde. Ich experimentierte noch etwas mit den Drähten herum, die ich an ihrem Kopf angebracht hatte. Über feine elektrische Impulse ließen sich die Augenlider und der Mund öffnen und schließen. Sie wirkte dann so lebendig, auch wenn ihre Gesichtszüge manchmal etwas maskenhaft blieben. Ich vermied daher, sie grellem Licht auszusetzen. Man muss die Dinge nicht so genau sehen. Muss man wirklich nicht. Sie war da. Loretta. Einfach da. Eine Gefährtin. Sie konnte auch den Mund halten. Habe ich das schon erwähnt? Ich weiß nicht...
Traurigkeit erfasste mich.
"Was ist los, Billy?"
"Ich weiß es nicht."
"Warum ist da immer dieser weiße Qualm?"
Ich schluckte. "Ich krieg' das schon hin, Loretta."
Eine Lüge.
Als der weiße Qualm erneut aufstieg, schaltete ich die Apparatur ab. Schade, dachte ich. Du wirst mir fehlen.
"Was?"
"Nichts."
Der bleiche, tote Mund verstummte.
Endgültig.
Ich ging zum Kühlschrank, fragte mich, was ich verkehrt gemacht hatte und nahm mir eine Dose Budweiser. Das Bier war warm. Scheiße. Ich hatte nicht daran gedacht, dass ich den Stecker herausgezogen hatte, um die Dose für meine Apparatur nutzen zu können. Ich schlürfte die warme Brühe, machte den Fernseher an, hörte aber nicht richtig zu.
Beim nächsten Mal mache ich es besser, dachte ich. In Gedanken ging ich die gesamte Schaltung noch einmal durch.
Ich sah dabei zu Loretta hinüber.
Zu ihrem Kopf.
Irgendein Schleim tropfte unten aus der Öffnung am Hals, die ich eigentlich mit einer Polyester-Dichtung verstopft hatte.
Es war fünf Uhr nachmittags, als Dorothy kam. Sie trug ein Kleid. Ich hatte sie noch nie in einem Kleid gesehen, immer nur in karierten Hemden und Jeans.
Ich starrte sie an. Sie wurde rot. Ich wahrscheinlich auch.
"Hi!"
"Hi, Dorothy!"
"Ich dachte, ich komme mal vorbei."
"Tja..."
"Komme ich ungelegen?"
"Nein, aber..."
Ich hielt sie zurück, als sie an ihm vorbeigehen wollte.
Sie sah mich an. Ihre Augenbrauen bildeten eine Schlangenlinie. Eine Frage stand in ihrem Gesicht.
"Hast du Besuch?"
"Quatsch."
"Was ist dann los?"
"Ich muss eben was wegräumen, Dorothy. Dann kannst du reinkommen, okay?"
"Irgendwie riecht das komisch bei dir da drinnen..."
"Ich habe gebastelt. Mit Polyester... Warte hier, ja?"
"Okay", seufzte sie.
Ich wusste nicht, wo ich Lorettas Kopf so schnell hinstecken sollte. Ich packte ihn schließlich in den Mülleimer. Die Klappe ging nicht richtig zu. Ich musste ihn ziemlich quetschen.
Die Apparatur ließ ich so stehen, wie sie aufgebaut war.
Es hätte zuviel Arbeit gemacht, alles von neuem zu verkabeln. Nur die Blutflecken wischte ich weg. Und diesen Schleim, der aus Lorettas Kopf herausgequollen war. Aber viel war davon nicht vorhanden.
Ich bin immer sehr reinlich.
Ich holte die Axt.
Der Puls schlug mir bis zum Hals.
Dorothy...
Sie hat ein schönes Gesicht, dachte ich. Und einen schlanken, langgezogenen Hals. Anders als Mrs. Cross.
"Du kannst reinkommen, Dorothy!"
ENDE
UNGEBETENE GÄSTE
Alles hatte damit angefangen, dass George noch so spät in die Stadt gefahren war um einzukaufen. Es gab dort einen Supermarkt, der die ganze Nacht geöffnet hatte.
Maureen stand am Fenster und blickte hinaus in die Nacht.
Sie und ihr Mann George betrieben eine Tankstelle mit Drugstore. Sie blickte zu den erleuchteten Zapfsäulen. Dahinter war der Highway. Um diese Zeit war der meiste Betrieb vorüber. Im Hintergrund hörte Maureen das Radio. Country-Music, die dann durch eine Meldung unterbrochen wurde.
Zunächst hörte Maureen kaum hin, aber dann horchte sie plötzlich doch auf. Ein Mann namens John Bowles war aus einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung ausgebrochen. Dann folgte eine ausführliche Beschreibung.
John Bowles! Den Namen kannte Maureen nur zu gut! Der Fall war damals durch die bunten Blätter gegangen und Maureen hatte jede Wendung mitverfolgt. Schließlich kam es ja nicht allzu häufig vor, dass so etwas in der näheren Umgebung vorkam!
Bowles war für eine Serie von Frauenmorden verantwortlich gewesen. 15 Jahre war die ganze Sache jetzt schon her. Man hatte Bowles schließlich gefasst und nur die psychiatrischen Gutachten hatten ihn schließlich vor dem elektrischen Stuhl gerettet. "Ich kenne das Irrenhaus aus dem dieser Kerl ausgebrochen ist", meldete sich der Kerl an der Theke zu Wort, dem Maureen den letzten Hamburger gemacht hatte, für den noch ausreichend Zutaten im Kühlschrank gewesen waren. "Ich fahre zweimal die Woche die Milch dorthin, wissen Sie?"
Maureen wandte sich vom Fenster ab und sah zu ihrem derzeit einzigen Gast. Aber sie sagte nichts. Der Mann schüttelte den Kopf. "Ich frage mich wirklich, wie der Kerl da herausgekommen ist! Diese Anstalt ist mindestens so gesichert wie ein Gefängnis!" Dann nahm er den letzten Bissen von seinem Hamburger, wischte sich den Mund ab und wandte sich dann zum Gehen. "Wird Zeit für mich!", meinte er. "Ist Ihr Mann nicht da?" - "Nein. Aber er kommt bald wieder." - "Das ist gut! Mit diesem Kerl ist nicht zu spaßen." - "Ich weiß." - "Im Radio hieß es, er hätte eine Narbe an der rechten Schläfe..."
"Ja, das stimmt. Die war auch damals immer auf den Photos zu sehen. Stammte angeblich aus einer Messerstecherei..."
"Ach, diese Revolverblätter! Aber passen Sie auf sich auf!"
"Das werde ich!" Und dann war Maureen allein.
Maureen ging zu einer Schublade am Tresen, öffnete sie und überprüfte den Revolver, der dort lag. Sicher ist sicher, dachte sie. Eine halbe Stunde später kam dann der Anruf.
Es war George. "Ich komme etwas später, Liebling!", sagte er.
"Was ist los?"
"Ich rufe vom Supermarkt aus an. Der Wagen streikt, aber ich bekomme das schon wieder hin. Mach dir keine Sorgen."
"Komm so schnell du kannst, ja?" - "Ja, natürlich"
*
Ungeduldig wartete Maureen. Dann kam ein Truck heran. Maureen hörte die Bremsen zischen. Sie sah einen Mann zum Drugstore kommen. Als er durch die Tür trat, wich sie etwas zurück.
Der Mann vor ihr hatte dasselbe Alter wie Bowles jetzt. Auch die Größe konnte passen. Und das Gesicht? Maureen war sich nicht hundertprozentig sicher. Es konnte hinkommen. Es war faltiger, nicht mehr so glatt wie damals auf den Zeitungsfotos. Und die Haare waren ergraut und hatten sich gelichtet.
Der Mann ging an die Theke, setzte sich auf einen der Hocker und bestellte ein Bier. Maureen brachte es ihm. Und dann sah sie das große Heftpflaster an seiner rechten Schläfe! Maureen zuckte zusammen. Natürlich! Die ganze Umgebung wusste aus dem Radio von der Narbe! Wen wunderte es, dass er sie zu verbergen suchte! Dieser Mann war Bowles, daran hatte sie jetzt keinen Zweifel mehr! 15 Jahre älter, aber er war es! Maureen starrte ihn an wie ein exotisches Tier.
"Stimmt was nicht mit mir?" Er kam näher. Gut, dass die Theke zwischen uns ist, dachte sie. Er trank sein Bier aus und dann begegneten sich ihre Blicke. Dieses Feuer..., dachte sie schaudernd. Dieses unheimliche, wahnsinnige Feuer, das in seinen Augen zu brennen schien und damals, vor 15 Jahren Titelbilder von Illustrierten geziert hatte!
Ich muss etwas tun, durchzuckte es sie. Dann griff sie zu der Schublade mit dem Revolver, riss die Waffe heraus und richtete sie auf den Mann. "Stehenbleiben! Keinen Schritt weiter!"
"Hey, was soll das? Ich habe Ihnen nichts getan!"
"Sie sind John Bowles!"
"Nein, ich heiße Clifford!"
"Sie sind aus der Anstalt ausgebrochen, haben dann vermutlich einen Trucker umgebracht, der sie mitnahm und haben dann Durst auf ein Bier gekriegt!"
"Ma'am, ich wollte hier nichts weiter, als ein Bier trinken! Ich habe noch eine weite Fahrt heute Nacht vor mir!"
"Dann können wir ja die Polizei kommen lassen! Wenn Sie wirklich nicht John Bowles sind, werden Sie nichts dagegen haben!"
Er hob abwehrend die Hände. "Nein, nicht die Polizei!"
"Und warum nicht?"
"Die würde mich doch kontrollieren! Hören Sie, unser Geschäft ist hart. Mein Wagen ist überladen und mein Fahrtenschreiber zeigt, dass ich längst in der Koje liegen müsste!"
"Das erfinden sie doch jetzt! Sie wollen keine Polizei, weil Sie John Bowles sind! Ich wette, dass sich unter Ihrem Pflaster eine Narbe befindet!"
"Ich habe da eine Wunde..."
"...die Sie sich vermutlich selbst beigebracht haben, damit man die Narbe nicht mehr sieht! Wie praktisch! Wenn Sie wirklich nicht Bowles sind, dann zeigen Sie mir doch einen Führerschein oder ein andere Dokument, das Ihr Photo mit einem anderen Namen als John Bowles zeigt!"
"Ich... Ich habe keinen. Man hat ihn nur letzte Woche wegen Trunkenheit abgenommen. Aber was soll ich machen? Ich muss sehen, dass mein Truck läuft! Also bitte keine Polizei!"
Aber Maureen glaubte ihm nicht. Zu fadenscheinig waren diese Erklärungen. Oh, wenn George doch nur hier wäre!,hämmerte es verzweifelt in ihr. Sie griff zum Telefon, aber da beugte er sich über die Theke nach vorne und ergriff ihren Unterarm. Sie versuchte sich loszureißen. Ein Schuss löste sich und traf ihn in der Brust. Maureen ließ ihre Waffe fallen. Nur kurz blickte sie zu dem Toten. Dann rief sie die Polizei an. Kaum hatte sie aufgelegt, da hörte sie jemanden an der Tür. Das musste George sein. Endlich. Sie lief ihm entgegen. Dann erstarrte sie plötzlich mitten in der Bewegung. Der Mann, der soeben eingetreten war, hatte eine gut sichtbare Narbe an der linken Schläfe...
ENDE
DIE KONKURRENTEN
Olmayer hatte bereits selbst an die Möglichkeit gedacht, dass er unter Umständen an Verfolgungswahn litt, sie dann aber rasch und energisch bei Seite geschoben....
Aber so furchtbar dieser Verdacht auch war, der in ihm nagte und ihn einfach nicht loslassen wollte: Nun schienen die Tatsachen eine Sprache von grausamer Eindeutigkeit zu sprechen. Nein, für Olmayer gab es keinen Zweifel mehr. Aus dem Verdacht war für ihn Gewissheit geworden.
*
Olmayer zeigte dem Polizisten das abgesägte Geländer. "Hier, sehen Sie! Das war kein Unfall! Um ein Haar wäre ich dort hinuntergestürzt!"
Der Polizist warf einen kurzen Blick hinab in die Tiefe, der offenbarte, dass er nicht schwindelfrei war. Nachdem der Uniformierte dann den Blick kurz über die weiträumigen Industrieanlagen hatte schweifen lassen, wandte er sich wieder an den immer noch erregten Olmayer und fragte, so ruhig es eben ging: "Sagen Sie, seit wann leiten Sie dieses Werk hier?"
"Seit vier Monaten etwa!", kam die zornige Erwiderung. "Hören Sie mir eigentlich gar nicht zu? Ich habe Ihnen das doch alles längst erzählt!
Außerdem - was hat das hiermit zu tun?" Und dabei deutete er auf das Geländer.
"Ich schätze, Ihr Job bringt 'ne Menge Stress mit sich, nicht wahr?" Der Beamte legte Olmayer eine Hand auf die Schulter. "Ich will damit nur sagen, dass das alles vielleicht etwas zuviel für Sie war. Vielleicht..."
"Was?"
"So etwas ist durchaus keine Schande, Herr Olmayer. Bitte, Sie sollten das, was ich gerade gesagt habe, um Himmels Willen nicht falsch verstehen..."
"Sie meinen, dass ich verrückt bin, nicht wahr? So ist es doch!"
"Aber, Herr Olmayrer, ich bitte Sie..."
"Sie denken, ich hätte mir das alles nur eingebildet! Sie glauben, ich würde unter Verfolgungswahn leiden!"
Der Polizist sah Olmayer mit ernstem Gesicht an.
"Offen gestanden sieht es mir wirklich danach aus. Diese Serie von angeblich mysteriösen Unfällen, die Sie mir geschildert haben und hinter denen einige Ihrer Kollegen stecken sollen..."
Olmayer wurde von ohnmächtiger Wut geschüttelt.
Dieser selbstgefällige uniformierte hatte nicht die Absicht, ihm zu helfen und sorgfältige Ermittlungen durchzuführen. Zum Teufel mit dieser Ignorantenseele!
"Schauen Sie, Sie müssen doch selbst zugeben, dass das alles sehr fantastisch ist, was Sie mir da erzählt haben: Ich habe mit Ihren Kollegen gesprochen und kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand darunter ist, der Ihnen nach dem Leben trachtet." Er schüttelte entschieden den Kopf. "Natürlich gibt es innerhalb einer Betriebshierarchie schon einmal Uneinigkeiten und Rivalitäten. Aber wegen solcher Sachen begeht doch niemand einen Mord!" Er fasste sich bedeutungsvoll an die Mütze. "Ich habe zwanzig Jahre Praxis mit solchen Dingen. Sie sollten mir glauben, Herr Olmayer."
"Dann erklären Sie mir doch bitte endlich dies hier!" Olmayer deutete wieder auf das zersägte Geländer. "Sehen Sie nicht, dass es vorsätzlich zersägt wurde?"
"Ich weiß natürlich nicht, wer das getan hat. Aber ich weiß eins: Von einem zersägten Geländer kann man noch nicht ohne weiteres auf einen Mordversuch schließen."
Sie stiegen die Treppe hinunter. Unten wartete ein weiterer Beamte im Streifenwagen.
"Also, auf Wiedersehen, Herr Olmayer. Wenn Sie gegen irgend jemanden Anklage erheben wollen...", der Polizist konnte sich ein ironisches Lächeln nicht verkneifen, "...dann wissen Sie wohl sicher den formellen Weg!"
Er stieg zu seinem Kollegen in den Wagen. Als die Beamten davongebraust waren, bemerkte Olmayer etwas abseits drei Gestalten, die leise miteinander flüsterten. Deutlich sah man die Anspannung und den Missmut in ihren Gesichtern. Als Olmayer sie sah, verhärteten sich auch seine Züge, seine Körperhaltung verkrampfte sichtlich und ja, vielleicht war da auch so etwas wie Furcht. Da waren sie also: Benrath, Larsen und Galring.
Die drei waren von Anfang an gegen Olmayer gewesen - gleich, als er das Werk zum erstenmal betreten hatte, hatte er das deutlich gespürt.
Ursprünglich war ihr Verhältnis untereinander wohl eher von Rivalität geprägt gewesen, aber ihr Buhlen um die Beförderung hatte jäh aufgehört, als man ihnen unerwarteterweise einen Fremden - Olmayer - vor die Nase setzte, anstatt einen von ihnen für die Leitung des Werkes auszuwählen.
Sie taten alles, um Olmayers Autorität zu untergraben und ihm Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Jedes Mittel schien ihnen recht zu sein, um den missliebigen Vorgesetzten loszuwerden.
Natürlich würden sie, sobald dieses Ziel erreicht wäre, wieder wie Hyänen gegenseitig übereinander herfallen.
"Guten Tag, Herr Olmayer!", sagte Benrath. Die anderen nickten ihrem Vorgesetzten zu, ohne sich jedoch die Mühe zu machen, die von ihnen empfundene Abneigung auf irgendeine Art und Weise zu kaschieren. Olmayer grüßte zurück, ohne richtig zu ihnen hinzuschauen.
"Warum war die Polizei da?", erkundigte sich Galring, als Olmayer sich anschickte, an den dreien vorbeizugehen. Olmayer hielt an. Er hörte das Quentchen Unsicherheit in der Frage des anderen mit sichtlicher Genugtuung. "Ich wüsste nicht, weshalb ich Ihnen das erzählen sollte", brummte er und ließ den Frager stehen.
*
Am nächsten Tag geschah etwas sehr Seltsames:
Benrath erschien in Olmayers Büro, sichtlich nervös, aber ohne den sonst stets vorhandenen abschätzigen Gesichtsausdruck. Er war freundlich - ja, fast zu freundlich! - und unterbreitete seinem Vorgesetzten ein überraschendes Angebot.
"Schauen Sie, Herr Olmayer, wir hatten in der Vergangenheit einige, nun ja, sagen wir mal menschliche Schwierigkeiten miteinander. Es lief nicht alles so, wie es unter Kollegen hätte laufen sollen..."
"Allerdings! Da haben Sie recht! Sie, Galring und Larsen haben mir ständig nur Schwierigkeiten gemacht, anstatt mich unterstützen, wie es Ihre Pflicht gewesen wäre!" Olmayer beugte sich Benrath entgegen. "Ich habe es bisher noch niemandem gesagt, um nicht Unruhe unter der Belegschaft zu stiften, aber es gibt in der Zentrale große Schwierigkeiten! Wenn wir uns nicht sehr ins Zeug legen, kann es sein, dass man sich dafür entscheidet, dieses Zweigwerk zu schließen!"
Und bei sich dachte Olmayer: Ich bin zum Erfolg verurteilt. Wenn ich es nicht schaffe, den Laden in Schwung zu bringen, wird man mir so schnell keine Werksleitung mehr anbieten...
Aber welche Chance hatte er, solange er drei erbitterte Feinde in seiner unmittelbaren Umgebung hatte, die Sabotage betrieben und ihn sogar umzubringen versucht hatten - anstatt ihn unterstützen? Olmayer kniff die Augen zusammen.
"Ich hoffe, Sie wissen jetzt, worum es geht!"
Benrath nickte ehrlich betroffen.
"Davon hatte ich keine Ahnung!", sagte er leise.
Als Olmayer dann wieder das Wort ergreifen wollte, kam ihm der andere jedoch zuvor und bot ihm die Versöhnung an.
"Ich habe mit Larsen und Galring gesprochen. Sie waren mit mir einer Meinung, dass diese Fehde ein Ende haben muss! Kommen Sie doch heute Abend zu mir nach Hause! Da können wir dann bei einer Flasche Wein den Frieden begehen!"
*
Als Olmayer am Abend mit einer Flasche Wein unter dem Arm bei Benraths eintraf, warteten die anderen bereits auf ihn. Die Gläser waren gefüllt und auf dem Tisch stand eine Platte mit belegten Broten.
"Ah, Olmayer! Schön, dass Sie doch noch den Weg zu uns gefunden haben", sagte Galring.
"Entschuldigung", erwiderte Olmayer. "Ich bin etwas spät dran, nicht wahr? Er stellte die mitgebrachte Flasche auf den Tisch.
"Stoßen wir also an!"
"Ja, trinken wir!"
Olmayer blickte zunächst misstrauisch in sein Glas.
"Nicht Ihre Sorte?", fragte Benrath, der bereits ausgetrunken hatte. Dann lächelte er und fügte hinzu: "Natürlich werden wir gleich auch aus ihrer Flasche probieren."
Olmayer trank und brach eine Sekunde später zusammen, während sich die anderen noch einmal zuprosteten. Larsen beugte sich anschließend über den reglosen Olmayer, hob ihn hoch und setzte ihn in einen Sessel.
"Hey, das war nicht abgemacht!", wandte er sich plötzlich kreidebleich an Benrath.
"Was ist denn los?"
"Wir wollten ihn einschüchtern, aber nicht umbringen!"
"Ist er tot?", fragte Galring unnötigerweise.
Larsens Blick war noch immer starr auf Benrath gerichtet.
"Du warst es, der das Zeug zusammengemixt hat, das unseren Freund ins Reich der Träume versetzen sollte!"
Benrath konnte nur mit den Schultern zucken. "Ich muss wohl was in sein Glas geschüttet haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ein Unfall..."
Larsen erhob sich wütend und packte Benrath bei den Schultern.
"Was hast du getan!"
"Hör auf!", fuhr Galring dazwischen. "Wir sollten uns besser darum kümmern, wo wir mit Olmayer bleiben."
Larsen griff nach der Weinflasche auf dem Tisch, öffnete sie und schüttete sich etwas ein. "Ich brauche jetzt erst einmal einen Schluck. Ihr auch?"
Benrath nickte. "Ja..."
"Mir auch etwas!", murmelte Galring matt.
Sie kippten den Wein hastig hinunter und schenkten sich gegenseitig nach.
"Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren!", meinte Galring sachlich. "Das ist jetzt das Allerwichtigste."
"Mir ist auf einmal so schlecht!", brummte Larsen.
Er sank auf das Sofa und hielt sich den Leib. Das Weinglas entfiel seinen Händen und zersplitterte auf dem glatten Holzparkett. Galrings Gesicht begann, sich zu verfärben, er krümmte sich.
"Sag' mal, woher kommt eigentlich der Wein?", fragte er. "Ist das nicht die Flasche, die Olmayer mitgebracht hat?"
Plötzlich, kurz bevor auch ihm übel wurde, begriff Benrath. "Da muss etwas drin gewesen sein!Olmayer wollte uns vergiften!", keuchte er völlig unnützerweise, denn Galring und Larsen waren bereits tot.
ENDE
DER EINZIGE MORDZEUGE
An Arthur Barings Haustür klingelte es. Baring kniff die Augen zu engen Schlitzen zusammen, als er an die Tür ging und durch den Spion blickte. Er sah einen kleinen, unscheinbaren Mann, der ungeduldig von einem Fuß auf den anderen trat. Baring betätigte die Sprechanlage. "Wer sind Sie?", knurrte er.
"Herr Baring? Arthur Baring, der berühmte Schauspieler?"
"Sind Sie von der Presse? Dann verschwinden Sie!"
"Lassen Sie mich bitte herein, Herr Baring! Ich bin nicht von der Presse!"
Baring wollte schon die Gegensprechanlage abschalten, da fuhr der kleine Mann fort: "Es geht um etwas, das sie vor ein paar Tagen in den Park gebracht haben... Herr Baring? Hören Sie mich noch? Ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn ich die Angelegenheit weiter von hier draußen mit Ihnen bespreche!"
Für Arthur Baring wirkte das wie ein Schlag vor den Kopf. Er fühlte seinen Puls rasen und schluckte. Nur ruhig Blut!, versuchte er sich einzureden und öffnete die Tür.
Der kleine Mann grinste breit. "Ja, Sie sind es wirklich! Arthur Baring - ich habe Sie so oft im Fernsehen bewundert..."
"Kommen Sie zur Sache!", brummte Baring und bat den Mann herein. "Wie heißen Sie übrigens?" Der Besucher machte eine unbestimmte Geste.
"Mein Name tut im Augenblick nichts zur Sache. Es ist vielmehr Ihr Name, der hier möglicherweise zur Debatte steht. Ihr guter Name..." Sie gingen ins Wohnzimmer. Der Besucher nahm Platz, Baring hingegen blieb stehen und musterte sein Gegenüber ungeduldig.
"Es war sehr klug von Ihnen, mich hereinzulassen", erklärte der kleine Mann gedehnt. "Und das lässt mich hoffen, dass wir auch in allem anderen zu einer vernünftigen Einigung kommen werden..."
"Wovon sprechen Sie?"
"Haben Sie schon Zeitung gelesen?"
"Was soll das?"
"Der Mord an ihrem Agenten ist das beherrschende Thema auf den Gesellschaftsseiten..."
"Er wurde im hiesigen Stadtpark überfallen und ausgeraubt, als er spazieren ging", erklärte Baring. "Wahrscheinlich hat er sich gewehrt und..."
"Das glaubt die Polizei!", gab der Besucher mit listigem Gesicht zu bedenken. "Jedenfalls steht es so in den Zeitungen. Aber wir beide, Herr Baring, wir wissen es doch besser..."
"Was wollen Sie damit andeuten?", fragte der Schauspieler unwirsch. Und bei sich dachte er: Erst einmal abwarten, was er wirklich in den Händen hat!
"Wir beide wissen, Herr Baring, dass Sie Ihren Agenten Fritz Berger umgebracht haben. Ich kann nur vermuten, was Ihr Motiv wahr. Vielleicht ist es so, wie es seit Wochen die Boulevard-Zeitungen schreiben: Dass Sie aus dem Vertrag mit Berger herauswollten, dass aber Berger nicht im Traum daran dachte, sie gehen zu lassen - jetzt, wo Sie es geschafft haben, er kräftig an Ihnen verdienen könnte und man schon von Angeboten aus Hollywood munkelt!"
Baring lachte verkrampft. "Ich soll also Berger umgebracht haben. Dann sind Sie also einer der Privatdetektive, die Bergers Frau beauftragt hat, um mir nachzuspionieren..." Der Besucher schüttelte den Kopf. "Sie irren sich. Aber es ist tatsächlich jemand auf der anderen Straßenseite, der Ihr Haus beobachtet... Nein, ich bin einfach jemand, der sich gedacht hat, dass Ihnen mein Schweigen vielleicht, sagen wir hunderttausend Mark wert ist! Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass es wohl das Ende Ihrer Karriere wäre, wenn ich zur Polizei ginge und dort ausplaudern würde, was ich beobachtet habe!"
"Verlassen Sie mein Haus, wer auch immer Sie sind! Ich muss mir das nicht anhören!"