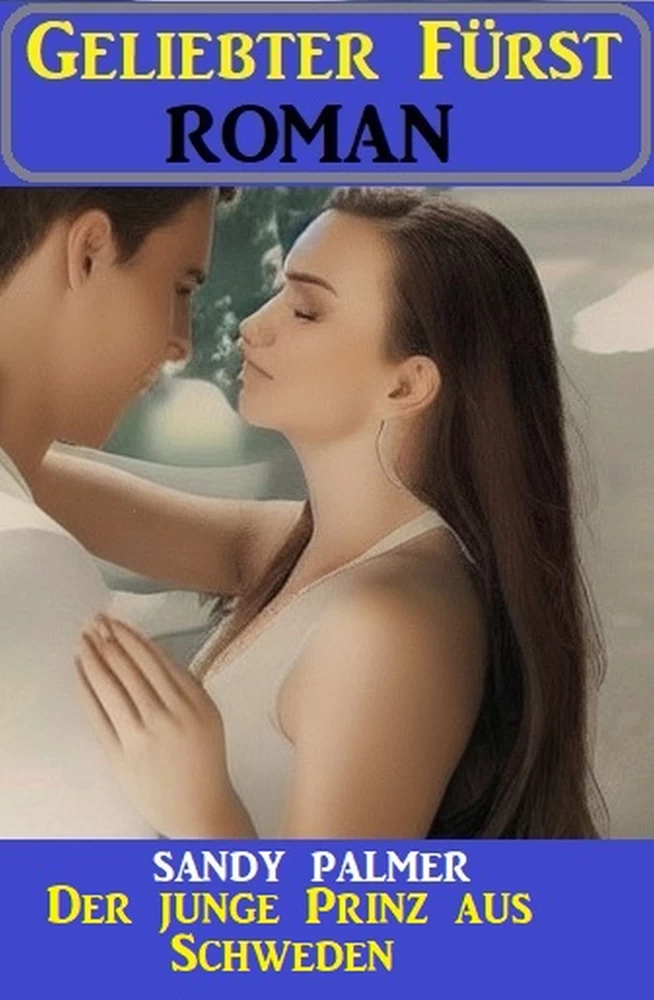Zusammenfassung
Die beiden jungen Menschen, der blonde Schwede und die schöne Baroness, verbringen zauberhafte Stunden miteinander, bis Bettina die wahre Identität des geliebten Mannes erfährt. Für sie bricht eine Welt zusammen...
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
Der junge Prinz aus Schweden: Geliebter Fürst Roman
Sandy Palmer
Als Bettina von Hegenau den sympathischen Dr. Ingmar Bergström zum ersten Mal sieht, weiß sie, dass sie ihr Herz verloren hat. Auch Ingmar Bergström verliebt sich auf den ersten Blick in die bezaubernde, blutjunge Baroness, die nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters die Verantwortung für das „Schloss-Hotel Hegenau“ übernommen hat.
Die beiden jungen Menschen, der blonde Schwede und die schöne Baroness, verbringen zauberhafte Stunden miteinander, bis Bettina die wahre Identität des geliebten Mannes erfährt. Für sie bricht eine Welt zusammen...
*
„Gib doch schon zu, Bettina, dass du in Studienrat Walther verliebt bist!"
Dagmar von Schröben sah ihre Freundin, die zwanzigjährige Baronesse von Hegenau, herausfordernd an.
Das Gespräch fand in dem vornehmen Internat „Haus Siglinde" in Bad Pyrmont statt, in welchem junge Damen aus ersten Kreisen untergebracht waren, um Fremdsprachen zu erlernen.
„Dass ich nicht lache!", antwortete Bettina. „Er ist doch nicht der Typ, in den man sich so einfach verliebt."
„Da hast du recht. Er ist zu ernst und zu gesetzt. Ein würdiger, älterer Herr!"
Dagmar warf einen schnellen Seitenblick auf Bettina, die mit hochgezogenen Knien in einem Sessel hockte und ein Loch in die Tapete starrte.
Was sie wohl sehen mochte in der Ferne, in die sie blickte?
Dagmar nahm an, dass es Studienrat Walther war, den Bettina vor ihrem geistigen Auge erblickte, den schlanken, eleganten, zurückhaltenden Vierziger mit den silbernen Schläfen.
Auf jeden Fall hatte Dagmars Schuss ins Schwarze getroffen, denn Bettina fuhr aus ihrer Versunkenheit empor, warf mit einer temperamentvollen Kopfbewegung das blonde Haar in den Nacken und blitzte ihre Zimmergenossin zornig an.
„Hast du ,würdiger, älterer Herr' gesagt?“
„Ja, das habe ich“, bestätigte Dagmar.
„Das ist eine Bosheit. Es klingt, als wäre er ein Großvater. Dabei ist er ein Mann in den besten Jahren."
„Du bist also doch verliebt!", stellte Dagmar sachlich fest. „Ich habe es mir schon gedacht, weil du so anders geworden bist."
„Anders? Wieso anders?"
Bettina stieg von ihrem Sessel herunter und schob die Hände in die Hosentaschen. Sie trug hautenge graue Hosen und einen dunkelgrünen Pulli. Ihre Erscheinung war genau das, was daheim in dem Hotel ihres Vaters gebraucht wurde, wo sie künftig hinter der Rezeption sitzen und die Gäste empfangen und beraten sollte. Zu diesem Zweck war das Sprachstudium gedacht.
Bettinas Vater, Baron von Hegenau, war seit sieben Jahren Witwer. Sein Gut war nicht mehr rentabel gewesen. Er hatte seinen Landbesitz also veräußern müssen und aus dem an einem See gelegenen Herrenhaus ein Hotel gemacht, aus dessen Erträgen er seinen und Bettinas Lebensunterhalt bestritt.
Bettina wollte gerade ihr schönes, langes Blondhaar mit einer störrischen Kopfbewegung rückwärts schleudern, als ihr einfiel, dass Studienrat Walther Burschikosität an einem jungen Mädchen nicht schätzte.
Um seinetwillen unterließ sie es und fragte mit einem sanften Kopfneigen nochmals: „Ich wüsste wirklich nicht, was an mir anders geworden wäre."
„Du bist nicht mehr du selbst", sagte Dagmar. „Früher konnte dir keine Tanzerei toll genug sein, und beim Sport warst du die aktivste von uns. Du hast geflirtet, wo du gingst und standest und machtest dich über alle deine Verehrer lustig. Jetzt rauchst du nicht mehr..."
„Studienrat Walther hat uns über die Schädlichkeit des Rauchens aufgeklärt. Du weißt, dass es sich neulich so ergab, dass wir in der Unterrichtsstunde darüber sprachen."
„Aber keine von uns hat es sich zu Herzen genommen, nur du! Du bist schon drei Wochen nicht mehr ausgegangen."
„Die seichten Gespräche dieser Jünglinge langweilen mich", seufzte Bettina und lehnte sich an die Wand.
„Ja, ich weiß, seit du in den Studienrat verknallt bist, kann dir eine Unterhaltung nicht gebildet genug sein. Du bist angesteckt von seinem Bildungsfimmel!"
„Willst du damit sagen, dass er hochgestochen ist?“
„Jawohl, genau das will ich sagen. Außerdem hat er ja keinen Mumm. Er ist gar kein richtiger Mann."
„Wie primitiv du dich ausdrückst, Dagmar."
„Meinethalben primitiv, aber doch wenigstens gesund und normal. Deine Schwärmerei für einen Mann, der dein Vater sein könnte, ist geradezu lächerlich,"
Dagmar hatte sich in Wut geredet. Ganz rot war sie im Gesicht geworden.
„Du solltest an die frische Luft gehen und dich beruhigen", riet Bettina ihr. „Ich ziehe es jedenfalls vor, jetzt einen Einkaufsbummel zu machen, statt ein solches Gespräch fortzuführen."
Sie nahm ihre Lederjacke und Tasche mit dem Schulterriemen vom Haken an der Tür und verließ den Raum.
Zweifellos tat auch Bettina dieser Spaziergang sehr gut, denn sie kehrte nach anderthalb Stunden beschwingt und mit einem Lächeln auf den Lippen zurück. Immerhin war ihr die Freude zuteil geworden, auf der Hauptgeschäftsstraße Studienrat Walther zu begegnen und ein Lächeln und einen sehr freundlichen Gruß zu erhaschen.
Als sie jedoch die feierlich-steife Empfangshalle des Pensionats betrat, stand dort die Direktorin in ihrer strengen, dunklen Kleidung, die sie immer trug, wie eine düstere Schicksalsgöttin und sah ihr mit ernsten Augen entgegen.
So ernst, so unheilschwanger war dieser Blick, dass Bettina das Lächeln verging. Sie wunderte sich nicht mehr, als die Direktorin auf sie zukam und in bedeutungsvollem Ton sagte: „Ich habe mit Ihnen zu reden, mein Kind. Es ist etwas geschehen."
Irgendetwas Schreckliches war passiert. Sie spürte es wie einen kühlen Luftzug, der durch die Halle strich und ihr eine Gänsehaut auf die runden, weichen Arme trieb.
Mit weit geöffneten Augen folgte Bettina der alten Dame. Hart und gepresst schlug ihr Herz gegen die Rippen. Sie hatte plötzlich Angst, schreckliche Angst.
Die erste Tür links in der Halle war diejenige, die zum Arbeitszimmer der Direktorin führte. Diese öffnete sie und ließ Bettina zuerst eintreten.
Das war absolut ungewöhnlich, denn gemeinhin rauschte die Dame majestätisch voran, und die Schülerinnen hatten zu folgen. Das Ungewöhnliche dieser Rücksichtnahme verdoppelte nur Bettinas Angstgefühl. Sie kam sich vor wie eine Kranke, die man schonen musste.
War es denn so entsetzlich, was geschehen war?
„Es ist ein Anruf gekommen", sagte die Direktorin, „ein Anruf aus Hegenau."
„Kommt...?", wollte Bettina fragen, aber die Worte blieben ihr in der Kehle stecken.
Kommt mein Vater mich besuchen?, hatte sie fragen wollen, denn davon war in den letzten Briefen, die sie gewechselt hatten, die Rede gewesen.
Aber schon sagte die Direktorin: „Es handelt sich um Ihren Vater, mein liebes Kind."
Es ist nichts, dachte Bettina verbissen. Es kann ja nichts sein. Das ist doch nicht möglich. Sie wollte es einfach nicht wahrhaben.
Und dann flüsterte sie: „Ist ihm etwas zugestoßen?"
Das Fräulein nickte. Die schweren Augenlider senkten sich halb über die Pupillen, als sie zu Boden schaute.
„Leider ja. Er ist einem Herzschlag erlegen.“
„Nein!", schrie Bettina auf. „Nein, das kann nicht sein!" Und dann drückte sie die gekrümmten Finger vor den immer noch aufgerissenen Mund, dessen bleiche Lippen zu zucken begannen.
„Sie müssen sich fassen, meine liebe Bettina, denn es wird jetzt viel auf Sie einstürmen!", dozierte die Direktorin. „Alle Ihre Energie werden Sie brauchen."
Ein Schluchzen antwortete ihr. Ihre Worte drangen gar nicht in Bettinas Bewusstsein. Das junge Mädchen tat das, was ein Kind eben tut, wenn es unglücklich und ratlos ist. Bettina weinte.
Ziemlich hemmungslos weinte sie, denn es hatte sie noch niemand gelehrt, ihre Gefühle zu beherrschen und Schmerz zu ertragen. Sie suchte mit fahrigen Handbewegungen in der Tasche ihrer grauen Hose nach einem Taschentuch. Natürlich hatte sie keines bei sich. Taschentücher vergaß Bettina grundsätzlich. Die Direktorin opferte in einem Anfall von Menschlichkeit das eigene, nach Lavendel duftende Tüchlein, das sie immer in der Kleidertasche trug.
„Danke", stammelte Bettina und tupfte die Tränen ab. Ihre schönen Augen waren gerötet, über ihre Wangen rannen unaufhaltsam neue Tränen. Sie zitterte wie Espenlaub.
„Nun, nun", begütigte die Direktorin in der Art, wie man mit kleinen Kindern spricht, „nun, nun, Sie müssen sich fassen! Gleich kann der nächste Anruf kommen. Dann müssen Sie gerüstet sein."
„Was für ein Anruf?“, schluchzte Bettina und lehnte sich gegen die Schulter der strengen Direktorin, die ihr plötzlich einen Arm um die Schulter gelegt hatte und Trost zu spenden versuchte.
„Ein Herr Weinheber wollte wieder anrufen, wenn Sie daheim wären. Ich habe gesagt, dass Sie in die Stadt gegangen wären. Zum Abendessen würden Sie gewiss zurück sein."
„Und was will er von mir?", fragte sie halb erstickt. „Papa ist tot, oh, mein Vater ist tot!"
„Gewiss, Kind, er ist tot, aber vielleicht will Ihnen dieser Herr Weinheber sagen, wie es dazu gekommen ist. Und dann muss Ihr Herr Vater ja auch beigesetzt werden, nicht wahr? Sie müssen nach Hause fahren und alles in die Hand nehmen. Sie sind doch seine einzige Erbin."
Bettinas Schluchzen wurde augenblicklich leiser. Es klang nur noch wie der zarte Ruf eines kleinen, erschreckten Vogels. Die Direktorin spürte, wie der Körper des Mädchens sich in ihrer Umarmung steif machte. Bettina war plötzlich wie erstarrt. Sie hatte die Augen weit geöffnet und starrte vor sich hin.
Etwas Dunkles, Drohendes war plötzlich aufgestanden. Über den nackten, bloßen Schmerz hinaus zuckten all diese Vorstellungen durch ihr Hirn: Das große Hotel am See! Der Anbau, der noch nicht fertig war! Die vielen Angestellten, die alle auf sie starrten! Die Scharen der Gäste! Die Ströme der Anspruchsvollen und Nörgelnden, der Redseligen, Lästigen, der Schweigsamen und Kritischen. Zahlen, Kontoauszüge, Hauptbücher! Kribbelnde Geschäftigkeit, die mit einem Schlage stillstand. Schwarzgekleidete Menschen. Alle sahen ihr entgegen...
„Sie sind doch seine einzige Erbin. Sie müssen nach Hause fahren und alles in die Hand nehmen“, hatte die Direktorin gesagt.
„Nein", flüsterte Bettina kaum hörbar, „nein, das kann ich nicht! Das kann ich doch alles gar nicht. Woher sollte ich das denn können?"
Und dann machte sie sich langsam, wie schlaftrunken, aus dem Arm der Institutsleiterin frei und strich sich über die Stirn.
Es war ihr plötzlich klar geworden, dass der Lebensabschnitt ihrer Kindheit endgültig zu Ende war, und dass sie mit dem heutigen Tage erwachsen zu sein hatte.
Ihr Lippen zuckten immer noch, denn sie wollte ja weinen wie ein Kind. Aber ihr Verstand hatte zu arbeiten begonnen und suchte, das Chaos zu klären, vor dem sie sich fürchtete.
Sie fürchtete sich sehr. Sie kam sich vor wie ein kleines Mädchen, das plötzlich im Nachthemd auf einem Rummelplatz steht. Alle zerrten an ihr. Alle fragten, johlten, schrien. Sie drehten sie rechts herum und links herum. Ihr Hemd war schon ganz zerfetzt, und sie hielt es vor der Brust mühsam zusammen. Grell, bunt, laut und unendlich vielfältig war die Umgebung, die sie nicht verstand. Sie fürchtete sich. Sie wollte weinen und davonlaufen. Aber sie musste erwachsen sein.
„Das lernt sich alles, mein Kind", sagte die Direktorin jetzt, die entfernt eine Ahnung haben mochte von dem, was in Bettinas Seele vorging. „Wenn man es können muss, dann kann man es auch. Das kommt ganz plötzlich. Sie werden es schon schaffen."
In diesem Augenblick klingelte das Telefon.
Bettina fuhr zusammen, als hätte man sie gestoßen. Sie stürzte auf den Apparat zu, der sie mit der Heimat verbinden würde. Dann jedoch warf sie den Kopf zurück und sah die Direktorin fragend an. Die nickte gewährend. Das junge Mädchen streckte die Hand aus und nahm den Hörer ab. Sie zögerte eine Sekunde, ihn zu ergreifen. Dann aber fasste sie fest zu.
„Hallo", sagte sie leise, ganz leise, „hier ist Bettina von Hegenau."
„Theodor Weinheber!", hörte sie eine Männerstimme sagen, deren Klang in ihr plötzlich wieder Erinnerungen weckte an unbeschwerte Tage im Hause ihres Vaters.
Theodor Weinheber hieß der Empfangschef. Er war um die Fünfzig und stammte aus einem rheinischen Hotelbetrieb. Immer war er heiter, freundlich und ausgeglichen gewesen und in kritischen Situationen die Ruhe selbst.
„Ich nehme an, Baronesse", sagte die Männerstimme, „dass man Ihnen bereits mitgeteilt hat, was geschehen ist."
„Ja, ich weiß." Sie brachte nur ein paar heisere, spröde Worte zustande.
„Mein aufrichtiges Beileid, Baronesse! Auch wir sind alle tief erschüttert. Es kam so unerwartet."
„Wie ist es geschehen?", flüsterte sie.
Sie staunte ja, dass er ihre leisen Worte verstand, aber er musste sie verstanden haben, denn er begann zu erklären:
„Heute Vormittag, als die Post kam, hat er sich sehr geärgert. Er sprach nicht darüber, aber er kam mit einem roten Kopf aus seinem Büro gestürzt und war den ganzen Tag über sehr aufgeregt. Ja, und dann kam am späten Nachmittag das Telefongespräch. Ich hörte ihn schreien am Apparat, aber ich konnte nichts verstehen. Dann gab es plötzlich einen Bums, und etwas Schweres fiel hin. Ich lief gleich hinüber. Da sah ich Ihren Vater hinter dem Schreibtisch auf dem Fußboden liegen. Er hatte im Stehen telefoniert und den Apparat mit sich heruntergerissen, als ihn ein
Herzschlag traf und er umfiel. Das ist alles."
„Also durch eine Aufregung fand er den Tod? Sein Herz war angegriffen, ich weiß es."
„Ja, er muss irgendeinen Ärger gehabt haben! Wir wissen alle nicht, was es war. Auf dem Schreibtisch wurde nichts Außergewöhnliches gefunden. Wir haben dann den Arzt gerufen, der auch nicht mehr helfen konnte und den Totenschein ausstellte. Montag wird er beerdigt, Baronesse! Wann werden Sie hier sein?"
„Ich komme", sagte sie mit fremder Stimme merkwürdig fest. „Ich komme mit dem ersten Zug morgen früh. Morgen Abend bin ich da. Sie müssen inzwischen für alles sorgen."
„Frau Wunderlich und ich machen das schon", versicherte Theo Weinheber. „Wir werden Ihnen beistehen, wo wir können. Es ist alles nicht einfach für Sie. Aber wir halten alle zu Ihnen. Darüber sind wir uns einig."
„Danke", hauchte sie, „vielen Dank."
„Die Verwandten verständigen Sie wohl?", fragte er noch. „Sie können sie ja telefonisch erreichen, oder vielleicht telegrafieren Sie auch?“
Der Gedanke, mit Vetter Archibald reden zu müssen, verursachte ihr Unbehagen. Sie hatte ihn nie besonders leiden mögen. Er und seine Frau waren Menschen, die ein Geschöpf wie Bettina nie verstehen würden, der Gefühlsdinge über alles gingen.
„Ich werde telegrafieren", sagte sie.
„Gut, dann ist wohl alles klar. Ich lasse Ihr Zimmer zurechtmachen und erwarte Sie daheim. Ich wünsche Ihnen eine so gute Nacht, wie das möglich ist. Auf Wiedersehen!“
„Auf Wiedersehen", flüsterte sie. Dann legte sie ganz behutsam den Hörer auf, als könnte sie ihren toten Vater mit einer heftigen Geste stören.
*
Am nächsten Morgen um neun Uhr fuhr sie. Der Hausdiener brachte sie zur Bahn. Er lenkte den Wagen der Direktorin und trug Bettinas Gepäck. Hastig hatte sie sich von allen Mitschülerinnen und der Leiterin des Pensionats verabschiedet. Sie hatte so gut wie gar nicht geschlafen. Sie war aus dem Arbeitszimmer der Direktorin nach oben in ihr Stübchen getaumelt, das sie mit Dagmar teilte. Dagmar sowie zwei andere Mädchen warteten hier auf sie, um zu erfahren, was eigentlich geschehen war.
Weinend hatte Baronesse Bettina berichtet. Die erschrockene Teilnahme der Freundinnen weichte die dünne Kruste von Beherrschung auf, die sie sich gerade zurechtgelegt hatte, und Schmerz und Zukunftsangst überwältigten sie.
Schließlich gab Dagmar ihr Baldrian zu schlucken, und Bettina beruhigte sich. Sie machte sich daran, ihre Koffer zu packen und diesen oder jenen Gegenstand ihres persönlichen Besitzes zum Andenken zu verschenken. Zwischendurch telefonierte sie und gab das Telegramm an Vetter Archibald auf. Dann packte sie weiter, legte die Reisekleidung zurecht und war endlich gegen ein Uhr nachts fertig.
Um acht Uhr morgens musste sie aus dem Haus. Um halb sieben musste sie aufstehen. Es blieben ihr fünfeinhalb Stunden Ruhe, einer Ruhe, die sie nicht finden konnte.
Kaum hatte sie das Licht gelöscht und die Augen geschlossen, erschien vor ihr das Bild ihres Vaters, wie sie ihn von den letzten Ferien her in Erinnerung hatte. Kraftvoll, männlich, vital und heiter regierte er seinen Betrieb, lachte und streichelte alle kleinen Kümmernisse seiner einzigen Tochter hinweg und schien von unerschöpflichem Optimismus erfüllt.
Immer war er so gewesen. Sie kannte ihn gar nicht anders. „Papa macht das schon!“ Wie oft hatte sie diese Redewendung benutzt in dem felsenfesten Vertrauen, dass es einfach nichts auf der Welt gäbe, was ihr Vater nicht meistern und wieder in Ordnung bringen würde. Erst jetzt wusste sie, wie herrlich beruhigend dieses felsenfeste Vertrauen gewesen war. Nichts hatte sie umwerfen können. Der starke, zuverlässige, immer liebevolle und muntere Papa stand ja hinter ihr.
Sie hatte begonnen, herzbrechend in ihre Kissen zu schluchzen, als ihr klar wurde, wie allein sie jetzt war. Ein mutterloses Kind war sie schon lange gewesen, aber der Schmerz war überwunden und fast vergessen. Der Vater hatte sie ja stets getröstet und allen Kummer hinweg gestreichelt.
„Wir zwei, wir haben uns lieb und bleiben zusammen", hatte er immer gesagt.
Nun, sie waren nicht immer zusammengeblieben. Bettina hatte ins Internat gemusst, und das lärmvolle Leben unter hundert Kindern hatte sie selten oder nie zur Besinnung kommen lassen. Zur Besinnung worauf? Dass sie eine Halbwaise war? Ach, Unsinn, sie hatte ja den besten, zärtlichsten Vater, den man sich nur denken konnte. Wozu sich also Gedanken machen?
Danach war die Zeit im Pensionat gekommen, wo es wiederum Ablenkungen gegeben hatte: Die Freundinnen, die Schwärmerei, die erste heimliche Liebe...
So hatte Baronesse Bettina bis zu dieser furchtbaren Stunde im Zimmer der Direktorin gelebt. Und jetzt lag sie in ihrem Pensionatsbett, schluchzte und schluckte und wusste, dass alle Sicherheit und Zuflucht für immer dahin waren. Ein kleines Mädchen lag in den Kissen und weinte fassungslos.
Ja, so hatte diese Nacht ausgesehen. Vergeblich hatte sich Dagmar von Schröber zu Bettina auf den Bettrand gesetzt und ihr über den zuckenden Rücken gestrichen. Es hatte auch keinen Erfolg, dass sie wieder mit der Baldrianflasche kam.
Bettina weinte sich die Augen rot, bis sie endlich vollkommen erschöpft gegen vier Uhr in einen unruhigen Schlummer fiel.
Es war also kein Wunder, dadd sie heute blass war. Ihre Augen brannten. Seltsam verloren und verstört war der Ausdruck dieser schönen, hellbraunen Augensterne mit den grünen Sprenkeln darin. Die Blässe des Gesichts hatte auch das Make-up nicht zu verbergen vermocht, ebenso wie die dunklen Schatten unter den Augen.
Sie sah erbarmungswürdig aus in ihrem dunkelblauen Kostüm. Ein anderes Kleidungsstück, das dem Trauerfall angemessen gewesen wäre, besaß sie nicht. Sie musste sich erst daheim mit dem Passenden versorgen. Aber gerade durch diese Improvisation und Bettinas vollkommen verwandelten Gesichtsausdruck wurde die unerwartete Gewalt des Schicksalsschlages, der sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen hatte, deutlich.
Der Hausdiener brachte sie zum Bahnhof und half ihr in den Zug hinein. Sie bekam einen guten Platz. Jetzt stand der vierschrötige Bursche auf dem Bahnsteig und wartete auf die Abfahrt. Da kam schon das Signal.
Baronesse Bettina stand am Fenster und winkte matt. Als der Zug anruckte, stürzten ihr die Tränen aus den Augen. Blind vor Tränen starrte sie aus dem Fenster und sah, wie die Gestalt des Mannes immer kleiner wurde.
Schließlich war der Hausdiener nur noch ein Punkt. Da schloss Bettina das Fenster und sank auf ihren Platz.
*
An diese Heimreise nach Hegenau konnte sich Baronesse Bettina später überhaupt nicht erinnern. Wie in einem Nebel glitten die Bilder der Landschaft und die Gesichter der Mitreisenden an ihr vorüber. Sie nahm an keinem allgemeinen Gespräch teil. Ein paar Stunden saß sie zurückgelehnt im Polster mit geschlossenen Augen und dachte an den toten Vater. Als sie in Hegenau ankäm, war sie zum Umfallen müde.
„Guten Abend!", sagte Theo Weinheber. „Und herzlich willkommen!"
Der Empfangschef holte sie vom Bahnhof ab und fand, dass sie aussah wie ein Bild des Jammers.
Der eilige Versuch, kurz vor dem Aussteigen noch etwas Farbe in das Gesicht zu bringen, war zwecklos gewesen.
Bleich und müde schaute es unter dem flüchtig aufgetragenen Puder hervor, ein verstörtes Kindergesicht, das sich am liebsten an eine Schulter gepresst und dort verborgen hätte.
Aber Theo Weinhebers Schulter kam dafür nicht infrage, denn er war nur ein Angestellter, und das hilflose kleine Mädchen war seine Chefin.
Ich muss sie daran erinnern, dass sie jetzt meine Vorgesetzte ist, dachte er voller Unbehagen, denn es schien ihm grausam. Aber einer musste es ihr sagen, und er war der erste, mit dem sie zusammentraf.
So nahm er nach dem begrüßenden Händedruck ihre Koffer und ging mit ihr zu seinem Wagen. Bettina trug nur ihre winzige Handtasche.
„Mit dem Morgenzug dürfte Ihr Vetter ankommen", teilte ihr Theo Weinheber mit. „Ein Telegramm kündigte seine Ankunft an."
„Muss ich Vetter Archibald abholen?", erkundigte sie sich kindlich.
„Nein, zum Abholen haben Sie keine Zeit. Schließlich muss der Betrieb ja weiterlaufen und Disziplin bewahrt werden. Außerdem nehmen Sie die Vorbereitungen für die Beisetzung in Anspruch. Das dürfte jeder einsehen."
Bettina wurde sich bewusst, dass sie vollkommen ratlos gewesen wäre, wenn nicht Theo Weinheber für sie gedacht und er ihr Ratschläge gegeben hätte.
Klein und in sich zusammengesunken saß sie neben ihm im Auto und fror. Ihr war so jämmerlich zumute. Ob man sie wohl ein wenig schlafen lassen würde? Oder wurde heute noch viel von ihr erwartet?
Als hätte Theo Weinheber ihre Gedanken erraten, sagte er mit dem Blick geradeaus auf die Fahrbahn: „Sie werden sich erst etwas erfrischen auf Ihrem Zimmer und dann zu Ihren Angestellten sprechen, Baronesse! Alle werden sich für fünf Minuten im Büro Ihres Vaters versammeln, so dass Sie Gelegenheit haben, ihnen guten Tag zu sagen und sie ein bisschen zu ermutigen."
„Ermutigen?" Sie war überrascht, dass sie ihre Angestellten ermutigen sollte. War sie selbst nicht am tiefsten getroffen von diesem Schicksalsschlag?
„Ja, natürlich", nickte er. „Es gibt doch nur mannigfache Schwierigkeiten. Trotz aller Anteilnahme an Ihrer Trauer ist jeder sich selbst der Nächste. Darüber dürfen Sie sich keine Illusionen machen. Alle fragen sich, ob Sie das Hotel werden halten können, und was aus ihren Stellungen werden wird.“
„Oh!" Sie begann das mühsam zu begreifen.
„Natürlich spricht das niemand aus. Das wäre ja taktlos. Aber glauben Sie mir, ich kenne die Menschen! Sie machen sich insgeheim alle Sorgen, und die müssen Sie unbedingt zerstreuen."
„Ich begreife nicht ganz, warum die Leute sich sorgen. Das Hotel ist eine Goldgrube.“
Er zuckte mit den Schultern. „Ich weiß nicht, ob es eine Goldgrube ist. Manchmal sieht die Fassade großartig aus, und dahinter verbergen sich die Schattenseiten. Ich würde Ihnen wünschen, dass es nicht so ist. Aber das werden erst die nächsten Tage zeigen, wenn Sie sich mit den geschäftlichen Dingen befassen. Zunächst ist es wichtig, Stimmung zu machen und zu zeigen, dass jemand da ist, der das Steuer in die Hand nimmt."
„Aber ich — ich...", stammelte sie und rang ihre schmalen Hände. Hilflos brach sie ab.
„Ich weiß, was Sie sagen wollen. Sie könnten das nicht, Sie wären dieser Aufgabe nicht gewachsen! Es tut mir leid, Sie müssen es sein! Nehmen Sie sich eisern zusammen, Baronesse! Wir werden Ihnen helfen, wo wir können, Frau Wunderlich und ich. Es geht jetzt um das Lebenswerk Ihres Vaters und um Ihre eigene Zukunft. Sie haben kein anderes Erbe als das Hotel, denn ein Bankguthaben besaß Ihr Vater nicht, das weiß ich zufällig genau, weil er mit mir darüber gesprochen hat. Sein einziges Kapital war der Betrieb. Sie müssen das Hotel in Gang halten und möglichst noch den Umsatz steigern."
Der Wagen bog jetzt in die mit Pappeln bestandene Allee ein, die zum Gutshaus führte. Dann hielt er vor dem Hotel.
Es war ein zweistöckiges, breit hin gelagertes Gebäude mit einem Balkon, der von Säulen getragen wurde und den Eingang überdachte. Durch diese Tür kam man in die Halle, die noch im Schmuck der Ahnenbilder und Jagdtrophäen prangte.
Man hatte nur einige Sesselgruppen und niedrige Rauchtische aufgestellt und im Hintergrund neben der Treppe eine Theke für die Rezeption errichtet.
Der grüne Salon war jetzt das Frühstückszimmer der Gäste, die Bibliothek mit den holzgetäfelten Wänden das Rauchzimmer. Der ehemalige Gartensaal, der sich in einem rechtwinkelig zum Haus verlaufenden Anbau in den Garten hinein erstreckte, war das Restaurant geworden, wo man die Mahlzeiten einnehmen konnte.
Glastüren führten von dort auf die Terrasse, die einen Blick auf den See erlaubte. Die Pfeiler, auf denen die Terrasse ruhte, standen unmittelbar am Ufer des Sees, und darunter begann der Bootssteg, an dem einige Ruderboote vertäut lagen, und von dem aus die Gäste, die es nach einem erfrischenden Bad gelüstete, in die blaue Flut springen konnten.
Weit und breit gab es kein anderes Haus. Der See war von Waldungen lieblich eingerahmt. Rechts erstreckte sich an seinem Ufer eine Liegewiese, auf der im Sommer die Gartenbetten und Sonnenschirme für die Gäste standen und wie farbenfrohe riesige Blumen wirkten. Am jenseitigen Ufer konnte man endlose Spaziergänge rund um den See und durch die Wälder unternehmen.
Wunderschön war dieser Besitz, und Bettina liebte ihn sehr. Hier hatte sie ihre glückliche Kindheit verbracht. Auf keinen Fall durfte das alles jetzt verlorengehen.
Sie befahl sich selber, Haltung anzunehmen, als sie jetzt aussteigen musste. Sie war die junge Herrin des Schloss-Hotels Hegenau. Aller Augen blickten auf sie. Sie durfte keine Schwäche zeigen, das hatte Theo Weinheber ihr hinreichend klargemacht.
Baronesse Bettina stieg aus und ging auf das Haus zu. Theo hielt für sie die Glastür der Halle auf.
Hinter der Rezeption saß Johanna Wunderlich, die Beschließerin, und machte vertretungsweise für Theo diesen Dienst. Sie war seit langen Jahren im Hause und besaß viele Erfahrungen.
Jetzt schaute sie auf und sprang vom Stuhl empor, als sie Bettina erkannte. Sie kam auf sie zu und schloss die Baronesse in ihre Arme.
„Ach, mein liebes Kind", stammelte sie. „Es ist schrecklich! Ihr Vater war ein so guter Mensch. Er wird uns fehlen. Wir haben ihn alle gern gehabt." Eine Träne kullerte langsam die faltenreiche Wange mit dem sorgfältigen Make-up herab, und Bettina wusste plötzlich instinktiv, dass Johanna Wunderlich gewillt war, jetzt die Stelle einer Mutter einzunehmen und ihr in jeder Lage beizustehen, obwohl sie selber so tief und ehrlich um den Baron von Hegenau trauerte, dass sie die Tränen nicht zurückhalten konnte.
„Nicht weinen, liebe Frau Wunderlich", sagte sie leise und tätschelte der Älteren den Rücken. „Er hatte einen leichten Tod und ist nun bei Mama. Aber wir wollen tun, als ob er immer noch unter uns wäre.“
Sie wusste selbst nicht, wo sie diese Worte hernahm. Sie waren plötzlich da, auch die Gefasstheit und die Stärke, an die die andere sich anlehnen konnte.
Ein kleines Wunder war geschehen. Bettina wuchs mit ihren Aufgaben, und der Himmel schenkte ihr inmitten ihres tiefen Kummers die nötige Kraft.
*
Am Sonntagmorgen war Vetter Archibald da. Er war der Sohn von ihres Vaters einzigem Bruder, der schon das Zeitliche gesegnet hatte. Aber er glich seinem verstorbenen Vater aufs Haar.
Nie hatte Bettina sich so bis zum Erschrecken klargemacht, wie verschieden ihr Vater und sein Bruder gewesen waren.
Jetzt sah sie mit leichtem Schauder die spitze Nase des Vetters und die grellen, unangenehm aufmerksamen, hellblauen Augen. Sie sah die beiden scharfen Mundfalten und die verkniffenen, schmalen Lippen und fühlte, dass dieser Mann in der Meinung lebte, vom Leben benachteiligt zu sein.
Sie hätte zwar nicht zu sagen gewusst, worin diese Benachteiligung bestehen sollte, denn er hatte Frau und Kind, Haus und Stellung und war ein geachteter Mann, ein Beamter des gehobenen Dienstes…
Aber es war ja auch gleich, ob die Benachteiligung wirklich bestand oder nur in Vetter Archibalds Einbildung; wichtig war einzig und allein, dass er die Gier, den schrecklichen Hunger der Zukurzgekommenen mitbrachte, und dass sich Bettina dieser Eindruck beklemmend auf die Seele legte.
Sie empfing den Vetter in einem schlichten Kleid aus Jersey, das einmal himmelblau gewesen war, und das sie hatte einfärben lassen. Es war am Samstagabend gebracht worden.
Johanna hatte daran gedacht, das alles zu veranlassen. Sie hatte auch den Sarg ausgesucht, das Totenhemd und die Kissen, den Blumenschmuck und das ganze Arrangement der Feier.
„Du hast sehr umsichtige Angestellte, Bettina", bemerkte Vetter Archibald, nachdem er Bettina begrüßt hatte. „Hoffentlich gelingt es dir, sie zu halten. Ich sehe darin ein großes Problem für ein so junges Mädchen wie dich."
Zehn Jahre älter als Bettina war der Vetter. Er gehörte zu der Sorte von Menschen, die alles besser wissen.
„Besonders, da du doch vom Hotelfach so gut wie nichts verstehst!", meinte er jetzt noch bösartig hinzufügen zu müssen.
Sein langer Schädel war von dünnem, blondem Haar bedeckt. Wenn er die rötlichen Hände aneinander rieb, klang es wie Papier. Bettina bekam eine Gänsehaut, als sie es zum ersten Mal hörte.
Nein, Archibald war ganz anders als ihr Vater. Wie konnten nur die Mitglieder einer Familie so verschieden sein? Breitschultrig und rundgesichtig war der Papa gewesen, immer heiter, immer strahlend. Etwas Gemütliches war von ihm ausgegangen, das auch alle seine Gäste bezauberte. Vetter Archibald aber brachte etwas Lähmendes mit sich. Bettina fürchtete sich insgeheim ein bisschen, aber wem hätte sie das sagen sollen?
Es kann tröstlich sein, wenn bei einer Beerdigung die Sonne scheint. Der Montag war ein solcher Tag, der eine erste Frühlingsahnung brachte.
Der Schnee war geschmolzen und zerronnen. Kleine weiße Wölkchen segelten rasch an einem winddurchatmeten blauen Himmel dahin, als die Trauergemeinde um die Gruft stand. Auf einer kahlen Weide, die ein Nachbargrab beschattete, sang ein Star. Die Schleifen an den Kränzen flatterten. Der Wind spielte respektlos mit dem Talar des Geistlichen.
Dieser sprach: „Und dennoch siegt das Leben. Wir glauben an die Auferstehung, wir glauben an die Erneuerung.“ Baronesse Bettinas Augen waren ohne Tränen. Sie wusste, dass es so ihrem immer fröhlichen Vater am liebsten gewesen wäre.
An diesem Montag war das Hotel geschlossen. An der Haustür hing eine schwarze Schleife. Sie war um die schmiedeeiserne Türklinke gewunden, und auch ihre langen Enden flatterten im Frühlingswind. Leise rauschte der See.
Im Speisesaal war die Tafel für die Trauergäste gedeckt. Sie saßen zusammen und sprachen über den Verblichenen. Nicht weit von Vetter Archibald entfernt hatte Dr. Krummbart, der Notar, seinen Platz. Er war der Anwalt der Familie von Hegenau und sollte am nächsten Tage mit den Hinterbliebenen über das Testament reden.
Die Stimmen schwirrten durcheinander. Irgendetwas war unwirklich, fand Bettina, entweder das Grab da draußen oder dieses höchst normale Beisammensein. Sie versuchte, sich den Friedhof und den frischen Grabhügel mit den Kränzen vorzustellen, aber es gelang ihr nicht, denn der Bürgermeister redete über ihren Kopf hinweg zu dem Sparkassenvorstand allzu laut über die Gewerbesteuer.
Baronesse Bettina lächelte in einer Pause der zahllosen Gespräche melancholisch vor sich hin. Es war ein durch und durch erwachsenes Lächeln. Sie machte sich die Vergänglichkeit alles Irdischen klar und erkannte, wie rasch ihr Vater von all diesen Menschen, die ihn auf seinem letzten Gang begleitet hatten, vergessen sein würde.
Am nächsten Vormittag saßen Vetter Archibald und sie im Arbeitszimmer ihres Vaters.
Es war ein Raum im Erdgeschoß, der ein breites Fenster zur Straße hatte. Zu erreichen war er durch eine braune Tür, die in der Holztäfelung der Wände des Vestibüls beinahe verschwand, so unauffällig war sie angebracht. „Privat“ stand in schlanken Messingbuchstaben daran.
Neben dieser Tür war das Office, hinter dem Theo Weinheber seinen Platz hatte. An der Wand hinter seinem Schreibtisch befand sich das Brett mit den Zimmerschlüsseln, fünfzehn an der Zahl, und ein schmales Regal mit Fächern für die eingehende Post der Gäste. Vor dem Schreibtisch blieb gerade so viel Platz, dass man sich an der halbkreisförmigen Theke bewegen konnte.
Vetter Archibald war aus seinem Zimmer gekommen, Bettina aus dem Souterrain, wo sich die Küchen- und Vorratsräume befanden.
Theo hatte den Hausburschen nach ihnen geschickt, um sie wissen zu lassen, dass der Rechtsanwalt eingetroffen sei.
Und nun saßen sie in dem behaglichen Raum, in dem der Baron von Hegenau bis vor wenigen Tagen gearbeitet hatte. Vetter Archibald hatte in sehr aufrechter, um nicht zu sagen, steifer Haltung auf dem mit grauem Stoff bezogenen kleinen Sofa Platz genommen. Bettina saß in dem einzigen Sessel, der diesseits des Schreibtisches stand.
Dr. Krummbart, ein breitgesichtiger, etwas vierschrötiger Fünfziger, der sich immer betont jovial gab, nahm den Platz hinter dem Schreibtisch des verstorbenen Hausherrn ein, und für ein paar Minuten hatte Baronesse Bettina gegen ein heftiges Unbehagen anzukämpfen, als sie ihn da sitzen und geschäftig seine Akten auspacken sah. Ihrem Vater hatte dieser Platz gehört, und es war ihr nicht recht, dass jemand anderes ihn so einfach einnahm.
Aber sie vergaß dieses Unbehagen jetzt, denn der Anwalt begann mit seinen Ausführungen, und sie brauchte ihre ganze Aufmerksamkeit, um ihn richtig zu verstehen. Er sprach zwar ganz deutlich, aber er sprach von Dingen, die ihr fremd waren, und so musste sie sich gewaltig konzentrieren.
„Verehrte Baronesse, Herr Baron, kommen wir also gleich zur Sache — der Klärung des Nachlasses unseres verehrten Verstorbenen. Ich glaube, ich mache Ihnen keine unangenehm überraschende Eröffnung, wenn ich Ihnen mitteile, dass keine Reserven in Form eines Bankkontos oder Sparguthabens vorhanden sind, ebenso wenig Wertpapiere oder Aktien. Was der Verstorbene besaß, steckt in diesem Hotel, das nach ihm in den Besitz seiner einzigen Tochter übergeht. Ein Testament ist hierüber vorhanden. Ich verlese es nunmehr."
Und mit leiser Stimme las er den Text des sehr kurzen Vermächtnisses.
Das Testament enthielt keinerlei Überraschungen. Bettina atmete ein klein wenig auf. Sie wusste immer noch nicht, warum ihr so beklommen zumute war. Ganz offensichtlich hatte sie sich vor irgendwelchen Hirngespinsten gefürchtet.
„Der Nachlass bereitet uns somit keine Schwierigkeiten", fuhr Dr. Krummbart fort. „Es wird nicht erheblich sein, meine liebe Baronesse, was Sie an Erbschaftssteuer zahlen müssen, da das Hotel noch im Aufbau begriffen war, als Ihr Herr Vater starb. Von den Hypotheken, mit denen der Ausbau des früheren Herrenhauses zu einem Hotel vorgenommen worden ist, wurde nur ein geringer Teil abgezahlt. Sie werden fleißig arbeiten müssen, wenn Sie die Position halten wollen."
Ehe Bettina sich dazu äußern konnte, ergriff Vetter Archibald das Wort.
Er beugte sich auf dem Sofa vor und stützte eine Hand mit abgewinkeltem rechten Arm auf sein spitzes Knie. Mit der linken Hand fuchtelte er nervös in der Luft herum.
„Das ist es ja, was mich so besorgt macht!", rief er aus. „Denn es wird Ihnen ja wohl kaum bekannt sein, Herr Doktor, dass ich noch eine Forderung an meinen Onkel habe."
„Eine Forderung?", murmelte Bettina kopfschüttelnd.
Ihr war der übermäßige Eifer zuwider, mit dem Archibald von Hegenau seine Ansprüche anmeldete. Von Schulden ihres Vaters, die dieser gegen seinen Neffen hatte, war ihr außerdem nie etwas bekannt gewesen.
„Auf diese Forderung wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen", nickte Dr. Krummbart. „Es ist selbstverständlich, dass Ihre Kusine sie erfüllen muss. Mit dem Erbe übernimmt sie auch diese Verpflichtung."
„Was für eine Verpflichtung?", rief Bettina ängstlich aus.
„Ich habe deinem Vater vor nunmehr fünf Jahren zwanzigtausend Mark geliehen“, informierte Vetter Archibald sie. „Er brauchte diese Summe für die Befestigung der Zufahrt und für die Anlage der Terrasse über dem See und des Bootsstegs für Gäste. Durch die Hypothek für den Ausbau war das Herrenhaus schon mehr als genug belastet. Die Banken wollten nichts mehr geben. Er konnte sich also nur von privaten Gläubigern Geld beschaffen. Darum wandte er sich an mich, und ich lieh ihm den Betrag gegen Erteilung eines Schuldscheins."
„Vergessen Sie bitte nicht, hinzuzusetzen, Herr von Hegenau, dass Sie Ihrem Onkel das Geld zu erhöhten Zinsen liehen, nämlich zu einem Zinssatz, der genau das Doppelte der jeweils geltenden Bankzinsen betragen sollte. Der Betrag sollte nach einer Laufzeit von zehn Jahren in einer Summe getilgt werden."
Dr. Krummbart zeigte sich sehr orientiert und konnte sich abschließend eine Bemerkung nicht verkneifen. „Sie machten ein sehr gutes Geschäft", sagte er noch.
„Den Eindruck habe ich auch", murmelte Bettina, und etwas deutlicher fügte sie hinzu: „Ich werde also ebenfalls jeweils zum Jahresende die doppelten Bankzinsen zahlen, genau wie Papa es getan hat."
Doch Vetter Archibald schüttelte heftig den Kopf.
„Ich habe das Darlehn ja gekündigt", rief er aus. „Telefonisch habe ich deinen Vater davon unterrichtet, dass ich das Geld brauche. Es sind zwar erst fünf Jahre der Laufzeit herum, doch ich benötige den Betrag."
„Und wie hat Papa reagiert?", wollte Bettina wissen.
„Er hat sich sehr aufgeregt und ins Telefon gebrüllt. Er beschuldigte mich, ich wollte ihn ruinieren."
„Es kann gut sein, dass der verstorbene Baron damit durchaus recht hatte", ließ sich Dr. Krummbart vernehmen. „Dasselbe würde für die Erbin gelten. Woher soll sie einen so hohen Betrag so plötzlich und unvorbereitet nehmen?"
„Das ist Bettinas Sache“, antwortete Vetter Archibald. „Ich will es jetzt haben, das Geld. Ich kündige den Vertrag. Das ist schließlich mein gutes Recht."
„Gewiss, Herr von Hegenau, gewiss! Niemand will Ihnen dieses Recht nehmen, am wenigsten die Baronesse, nicht wahr?"
Er suchte den Aufgeregten zu beschwichtigen und warf Bettina einen ermunternden Blick zu.
„Wie soll ich es denn zurückzahlen?", stammelte die junge Baronesse ratlos. „Wovon denn? Es ist doch kein Kapital vorhanden."
„Das ist mir gleich", sagte der Vetter und setzte sich hin, als hätte er einen Stock verschluckt. „Ich muss jetzt an meine Kinder denken. Wir brauchen das Geld für deren Ausbildung."
„Wenn Sie es sofort brauchen, dann würde das bedeuten, dass die Baronesse das Hotel verkaufen müsste", sagte der Anwalt.
Offenbar war das aber nicht im Sinne des Vetters. Er hatte ganz andere Ziele.
Archibald von Hegenau fuhr sich mit der linken Hand über den Schädel, während er seine Rechte wieder auf das Knie stützte. Das Sonnenlicht des Märzvormittags blinkte in den randlosen Gläsern seiner Brille und ließ die Mundfalten noch schärfer erscheinen als sonst.
„Kann Bettina nicht Geld aufnehmen?“, schlug er vor.
„Nein, das Hotel ist noch zu hoch belastet."
„Ach ja, ja! Ich fürchte, das Ganze war recht leichtsinnig von meinem Onkel. Er dürfte sich ein bisschen übernommen haben, nicht wahr?“
Lauernd sah Vetter Archibald den Anwalt an.
Dr. Krummbart zuckte mit den Schultern. „Der Baron war durchaus der Mann, diese Aufgabe zu meistern. Er hätte in der kommenden Saison vieles wieder herausgeholt. Mit seinem Tod hat eben niemand gerechnet. Außerdem hatte er, als er aus dem Herrenhaus ein Hotel machte, gar keine andere Wahl. Der viel zu kleine landwirtschaftliche Betrieb war nicht mehr rentabel, wie Sie wissen. Eine andere Möglichkeit zur Existenz bot sich ihm nicht.“
„Man muss aber immer auf Rückschläge gefasst sein", dozierte Archibald mit seiner rostig klingenden Stimme.