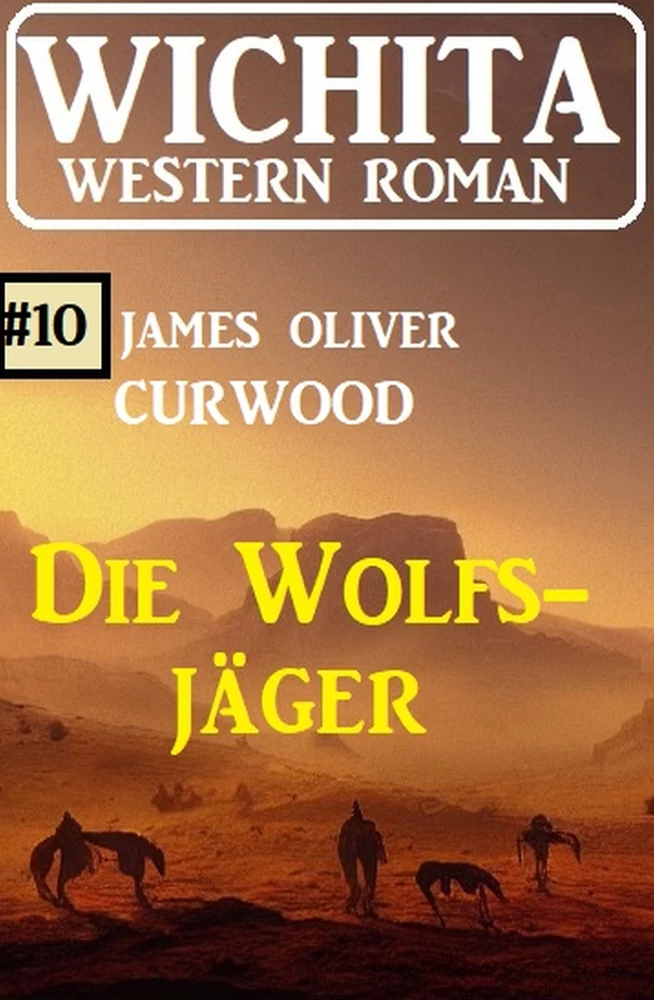Zusammenfassung
Knapp dreißig Jahre vor der Zeit, von der wir hier schreiben, verließ ein junger Mann namens John Newsome die große Stadt London in Richtung Neue Welt. Das Schicksal hatte ein hartes Spiel mit dem jungen Newsome gespielt - es hatte ihm zuerst beide Elternteile genommen und ihn dann in einer einzigen unvorhergesehenen Drehung des Rades des wenigen Besitzes beraubt, den er geerbt hatte. Wenig später kam er nach Montreal, und da er als junger Mann über eine gute Ausbildung und beträchtlichen Ehrgeiz verfügte, konnte er sich leicht eine Stelle sichern und sich das Vertrauen seiner Arbeitgeber erarbeiten, so dass er eine Anstellung als Faktor in Wabinosh House erhielt, einer Post tief in der Wildnis des Nipigon-Sees.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Die Wolfsjäger: Wichita Western Roman 10
von James Oliver Curwood
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
KAPITEL I
DER KAMPF IM WALD
Der kalte Winter lag tief in der kanadischen Wildnis. Über ihr ging der Mond auf, wie ein rot pulsierender Ball, der die weite weiße Stille der Nacht in ein schimmerndes Licht tauchte. Kein Laut durchbrach die Stille der Trostlosigkeit. Es war zu spät für das Leben des Tages, zu früh für das nächtliche Umherstreifen und die Stimmen der Geschöpfe der Nacht. Wie das Becken eines großen Amphitheaters lag der gefrorene See im Licht des Mondes und einer Milliarde Sterne. Jenseits des Sees erhob sich der Fichtenwald, schwarz und abweisend. Entlang der näheren Ränder standen schweigende Tamarakwände, die sich in der erdrückenden Umklammerung von Schnee und Eis krümmten, eingeschlossen von undurchdringlicher Finsternis.
Eine riesige weiße Eule huschte aus dieser Schwärze heraus, dann wieder zurück, und ihr erster zitternder Ruf ertönte leise, als ob die mystische Stunde der Stille für die Nachtmenschen noch nicht vorbei wäre. Der Schnee des Tages hatte aufgehört zu liegen, kaum ein Lufthauch rührte die eisbedeckten Zweige der Bäume. Dennoch war es bitterkalt - so kalt, dass ein Mensch, der sich nicht bewegte, innerhalb einer Stunde erfroren wäre.
Plötzlich wurde die Stille von einem seltsamen, erregenden Geräusch durchbrochen, das wie ein großer Seufzer klang, aber nicht menschlich war - ein Geräusch, das das Blut in Wallung brachte und die Finger am Gewehrschaft zucken ließ. Es kam aus der Dunkelheit der Tamaraks. Danach herrschte eine tiefere Stille als zuvor, und die Eule schwebte wie eine geräuschlose Schneeflocke über den gefrorenen See hinaus. Nach einigen Augenblicken kam sie wieder, schwächer als zuvor. Einer, der sich in der Waldarbeit auskannte, hätte sich tiefer in die Schwärze geschlichen und gelauscht, sich gewundert und beobachtet, denn in dem Geräusch hätte er den wilden, halb besiegten Ton des Leidens und der Qualen eines verwundeten Tieres erkannt.
Langsam und mit der ganzen Vorsicht, die aus der Erfahrung dieses Tages resultierte, schritt ein riesiger Elchbulle in den Schein des Mondes hinaus. Sein prächtiger Kopf, der unter dem Gewicht seines mächtigen Geweihs nach unten hing, war neugierig über den See nach Norden gerichtet. Seine Nasenlöcher waren gebläht, seine Augen funkelten, und er hinterließ eine Blutspur. In einer Entfernung von einer halben Meile erreichte er den Rand des Fichtenwaldes. Etwas sagte ihm, dass er dort Sicherheit finden würde. Ein Jäger hätte gewusst, dass er bis zum Tod verwundet war, als er sich in den fußtiefen Schnee des Sees schleppte.
Ein Dutzend Ruten von den Tamaracks entfernt blieb er stehen, den Kopf hochgeworfen, die langen Ohren nach vorne gerichtet und die Nasenlöcher halb in den Himmel gestreckt. In dieser Haltung lauscht ein Elch, wenn er in einer dreiviertel Meile Entfernung eine Forelle platschen hört. Jetzt herrschte nur die große, unendliche Stille, die nur durch den klagenden Schrei der Schneeeule auf der anderen Seite des Sees unterbrochen wurde. Noch immer stand das große Tier unbeweglich da, eine kleine Blutlache wuchs auf dem Schnee unter seinen Vorderbeinen. Was war das Geheimnis, das in der Schwärze des Waldes lauerte? War es eine Gefahr? Das schärfste menschliche Gehör hätte nichts entdecken können. Doch in den langen, schlanken Ohren des Elchbullen, die schräg über die schweren Platten seiner Hörner hinausragten, war ein Geräusch zu hören. Das Tier hob den Kopf noch höher in den Himmel, schnupperte nach Osten, nach Westen und zurück in den Schatten der Tamaraks. Aber es war der Norden, der ihn festhielt.
Von jenseits der Fichtenbarriere kam bald ein Geräusch, das ein Mensch hätte hören können - weder der Anfang noch das Ende eines Heulens, aber etwas Ähnliches. Von Minute zu Minute wurde es deutlicher, mal lauter, mal fast verstummend, aber immer näher kommend - der ferne Jagdruf des Wolfsrudels! Was die Schlinge des Henkers für den Mörder, was die Gewehre für den verurteilten Spion sind, das ist der Jagdschrei der Wölfe für das verwundete Tier der Wälder.
Der Instinkt lehrte dies den alten Bullen. Er senkte den Kopf, richtete sein riesiges Geweih an den Schultern auf und machte sich im langsamen Trab auf den Weg nach Osten. Er ging ein Risiko ein, indem er das offene Gelände überquerte, aber für ihn war der Fichtenwald sein Zuhause, und dort konnte er Zuflucht finden. In seinem rohen Hirn rechnete er damit, dass er dorthin gelangen konnte, bevor die Wölfe aus der Deckung kamen. Und dann...
Wieder blieb er stehen, so plötzlich, dass seine Vorderbeine sich unter ihm verdoppelten und er in den Schnee stürzte. Diesmal ertönte aus der Richtung des Wolfsrudels der schrille Klang eines Gewehrs! Es mochte eine Meile oder zwei Meilen entfernt sein, aber die Entfernung minderte nicht die Angst, die es dem sterbenden König des Nordens einjagte. An jenem Tag hatte er dasselbe Geräusch gehört, und es hatte ihm einen rätselhaften, schwächenden Schmerz in die Eingeweide getrieben. Mit äußerster Anstrengung brachte er sich auf die Beine, schnupperte noch einmal nach Norden, Osten und Westen, dann drehte er sich um und vergrub sich in der schwarzen, gefrorenen Tamarakwildnis.
Mit dem Geräusch des Gewehrschusses kehrte wieder Stille ein. Es mochte fünf oder zehn Minuten gedauert haben, als ein langes, einsames Heulen von der anderen Seite des Sees herüberschallte. Es endete mit dem scharfen, schnellen Heulen eines Wolfes auf der Fährte und wurde einen Augenblick später von anderen Wölfen aufgegriffen, bis das Rudel wieder in voller Stärke heulte. Fast gleichzeitig schoss eine Gestalt vom Waldrand aus auf das Eis zu. Nach einem Dutzend Schritten hielt sie inne und wandte sich wieder der schwarzen Fichtenwand zu.
"Kommst du mit, Wabi?"
Eine Stimme antwortete aus dem Wald. "Ja. Beeil dich, lauf!"
Auf diese Weise aufgefordert, wandte der andere sein Gesicht noch einmal über den See. Er war ein junger Mann von nicht mehr als achtzehn Jahren. In seiner rechten Hand trug er einen Knüppel. Sein linker Arm war, als wäre er schwer verletzt, in eine Schlinge gewickelt, die aus einem schweren Schal eines Holzfällers improvisiert worden war. Sein Gesicht war zerkratzt und blutete, und sein ganzes Erscheinungsbild zeigte, dass er der völligen Erschöpfung nahe war. Einige Augenblicke lang rannte er durch den Schnee, dann blieb er taumelnd stehen. Sein Atem kam in schmerzhaften Stößen. Der Knüppel glitt ihm aus den nervösen Fingern, und da er sich der tödlichen Schwäche bewusst war, die ihn überkam, versuchte er nicht, ihn wiederzuerlangen. Fuß um Fuß kämpfte er sich weiter, bis plötzlich seine Knie nachgaben und er in den Schnee sank.
Vom Rande des Fichtenwaldes lief jetzt ein junger Indianer auf die Oberfläche des Sees hinaus. Sein Atem ging schnell, aber eher vor Aufregung als vor Ermüdung. Hinter ihm, weniger als eine halbe Meile entfernt, hörte er den schnell herannahenden Schrei des Jagdtrupps, und einen Augenblick lang beugte er seine geschmeidige Gestalt dicht über den Schnee, um mit der Schärfe seiner Rasse die Entfernung der Verfolger zu messen. Dann suchte er nach seinem weißen Begleiter und sah nicht den unbeweglichen Fleck, der die Stelle markierte, wo der andere gefallen war. Ein Schreckensblick schoss ihm in die Augen, und als er sein Gewehr zwischen die Knie klemmte, legte er die Hände trompetenartig an den Mund und stieß einen Signalruf aus, der in einer stillen Nacht wie dieser eine Meile weit zu hören war.
"Wa-hoo-o-o-o-o-o! Wa-hoo-o-o-o-o-o-o!"
Auf diesen Schrei hin taumelte der erschöpfte Junge im Schnee auf die Beine und setzte mit einem Antwortruf, der nur schwach an die Ohren des Indianers drang, seine Flucht über den See fort. Zwei oder drei Minuten später tauchte Wabi neben ihm auf.
"Schaffst du es, Rod?", rief er.
Der andere bemühte sich zu antworten, aber seine Antwort war kaum mehr als ein Keuchen. Bevor Wabi ihm die Hand reichen konnte, um ihn zu stützen, hatte er seine letzte Kraft verloren und war ein zweites Mal in den Schnee gefallen.
"Ich fürchte, ich kann es nicht tun, Wabi", flüsterte er. "Ich-bin-besetzt-"
Der junge Indianer ließ sein Gewehr fallen, kniete sich neben den verwundeten Jungen und stützte dessen Kopf auf seine eigenen, schweren Schultern.
"Es ist nur noch ein kleines Stück, Rod", drängte er. "Wir können es schaffen und uns auf einen Baum retten. Wir hätten uns dort hinten auf einen Baum setzen sollen, aber ich wusste nicht, dass du so weit weg warst; und es gab eine gute Chance, ein Lager zu errichten, mit drei Patronen, die für den offenen See übrig waren."
"Nur drei!"
"Das ist alles, aber bei diesem Licht sollte ich zwei davon zählen lassen. Hier, halt dich an meinen Schultern fest! Schnell!"
Er wälzte sich wie ein Klappmesser vor seinem halb am Boden liegenden Begleiter. Von hinten ertönte plötzlich ein Chor der Wölfe, lauter und deutlicher als zuvor.
"Sie sind ins Freie gestürmt, und in zwei Minuten haben wir sie auf dem See", rief er. "Gib mir deine Arme, Rod! So! Kannst du das Gewehr halten?"
Er richtete sich auf, taumelte unter dem Gewicht des anderen und machte sich im Halbschritt auf den Weg zu den entfernten Tamarinden. Jeder Muskel in seinem kräftigen jungen Körper war bis zur äußersten Spannung angespannt. Noch deutlicher als seine hilflose Last erkannte er die Gefahr, die ihnen im Nacken saß.
Drei Minuten, vier Minuten noch, und dann...
Ein schreckliches Bild brannte in Wabis Gehirn, ein Bild, das er seit seiner Kindheit mit sich herumgetragen hatte, das Bild eines anderen Kindes, das vor seinen Augen von diesen Gesetzlosen des Nordens zerrissen und verstümmelt worden war, und er erschauderte. Er wusste, was ihr Schicksal sein würde, wenn er die drei verbleibenden Kugeln nicht rechtzeitig abfeuerte, wenn er nicht rechtzeitig den Rand der Tamaraks erreichte. Da blitzte in seinem Kopf eine letzte Möglichkeit auf. Er könnte seinen verwundeten Begleiter fallen lassen und sich in Sicherheit bringen. Aber dieser Gedanke brachte Wabi zu einem grimmigen Lächeln. Es war nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam ihr Leben riskiert hatten, und an jenem Tag hatte Roderick tapfer für den anderen gekämpft und war derjenige gewesen, der leiden musste. Wenn sie starben, dann in Gesellschaft. Wabi entschied sich dafür und umklammerte die Arme des anderen noch fester. Er war sich ziemlich sicher, dass der Tod sie beide erwartete. Sie konnten zwar den Wölfen entkommen, aber die Zuflucht eines Baumes mit dem gefräßigen Rudel, das unter ihnen Wache hielt, bedeutete nur ein schmerzloseres Ende durch Kälte. Doch solange es Leben gab, gab es auch Hoffnung, und er eilte weiter durch den Schnee, lauschte auf die Wölfe hinter sich und spürte mit jedem Augenblick deutlicher, dass seine eigenen Ausdauerfähigkeiten schnell am Ende waren.
Aus irgendeinem Grund, den Wabi sich nicht erklären konnte, hatte das Jagdrudel aufgehört, Zunge zu geben. Es vergingen nicht nur die vorgesehenen zwei Minuten, sondern fünf davon, ohne dass die Tiere auf dem See erschienen. War es möglich, dass sie die Spur verloren hatten? Da kam dem Indianer der Gedanke, dass er vielleicht einen der Verfolger verwundet hatte und dass die anderen, als sie seine Verletzung entdeckten, sich auf ihn stürzten und nun an einem der kannibalischen Festmahle teilnahmen, die sie bisher gerettet hatten. Kaum hatte er an diese Möglichkeit gedacht, wurde er von einer Reihe langer Heulgeräusche aufgeschreckt, und als er zurückblickte, sah er ein Dutzend oder mehr dunkle Objekte, die sich schnell über ihre Spur bewegten.
Nicht einmal eine Achtelmeile vor ihnen lag der Tamarakwald. Sicherlich konnte Rod diese Entfernung zurücklegen!
"Lauf, Rod!", rief er. "Du bist jetzt ausgeruht. Ich werde hier bleiben und sie aufhalten!"
Er löste die Arme des anderen, und dabei fiel sein Gewehr aus dem nervenlosen Griff des weißen Jungen und vergrub sich im Schnee. Als er sich von seiner Last befreite, sah er zum ersten Mal die Totenblässe und die teilweise geschlossenen Augen seines Gefährten. Mit einem neuen Schrecken, der sein treues Herz erfüllte, kniete er neben der Gestalt, die so schlaff und leblos dalag, seine glühenden Augen wanderten von dem grässlichen Gesicht zu den herannahenden Wölfen, sein Gewehr in den Händen. Jetzt konnte er die Wölfe ausmachen, die wie Ameisen aus dem Fichtenwald kamen. Ein Dutzend von ihnen war fast in Schussweite. Wabi wusste, dass er sich mit dieser Vorhut des Rudels befassen musste, wenn es ihm gelingen sollte, die Verfolger aufzuhalten. Er ließ sie immer näher herankommen, bis die ersten kaum noch zweihundert Fuß entfernt waren. Dann sprang der Indianer mit einem plötzlichen Schrei auf und stürzte furchtlos auf sie zu. Diese unerwartete Bewegung, die er beabsichtigt hatte, hielt die vordersten Wölfe für einen Augenblick in einer zusammengekauerten Gruppe an, und in diesem günstigen Moment richtete Wabi sein Gewehr auf und schoss. Ein langes Schmerzensgeheul zeugte von der Wirkung des Schusses. Kaum hatte er begonnen, feuerte Wabi erneut, diesmal mit solch tödlicher Präzision, dass einer der Wölfe hoch in die Luft sprang und leblos inmitten des Rudels zurücktaumelte, ohne auch nur einen Laut von sich zu geben.
Wabi rannte zu dem am Boden liegenden Roderick, zog ihn schnell auf den Rücken, umklammerte sein Gewehr mit dem Arm und lief wieder zu den Tamarinden. Nur einmal blickte er zurück, und dann sah er, wie sich die Wölfe in einer knurrenden, kämpfenden Menge um ihre geschlachteten Kameraden versammelten. Erst als er den Schutz der Tamarinden erreicht hatte, legte der Indianerjunge seine Last ab, und dann ließ er sich in seiner eigenen Erschöpfung auf den Schnee fallen, die schwarzen Augen vorsichtig auf die feiernde Meute gerichtet. Wenige Minuten später erkannte er dunkle Flecken auf dem weißen Schnee, und bei diesen Anzeichen für das Ende des Festmahls kletterte er in die niedrigen Zweige einer Fichte und zog Roderick hinter sich her. Erst dann gab der verwundete Junge ein sichtbares Lebenszeichen von sich. Langsam erholte er sich von der Ohnmacht, die ihn überwältigt hatte, und konnte sich nach einiger Zeit mit der Hilfe von Wabi sicher auf einen höheren Ast stellen.
"Das ist schon das zweite Mal, Wabi", sagte er und legte dem anderen liebevoll eine Hand auf die Schulter. "Einmal vom Ertrinken, einmal von den Wölfen. Ich habe eine Menge mit dir zu begleichen!"
"Nicht nach dem, was heute passiert ist!"
Das düstere Gesicht des Indianers hob sich, bis die beiden sich in die Augen blickten, mit einem Blick voller Liebe und Vertrauen. Es dauerte nur einen Augenblick, und ihr Blick richtete sich instinktiv auf den See. Das Wolfsrudel war deutlich zu sehen. Es war das größte Rudel, das Wabi in seinem ganzen Leben in der Wildnis je gesehen hatte, und er schätzte, dass es mindestens ein halbes Hundert Tiere umfasste. Wie gefräßige Hunde, denen man ein paar Fleischreste zugeworfen hatte, rannten die Wölfe umher, schnüffelten hier und da, als hofften sie, einen Happen zu finden, der ihnen vielleicht entgangen war. Dann blieb einer von ihnen auf der Fährte stehen, warf sich halb in die Hocke und stieß wie ein bellender Hund einen Jagdschrei aus, der zum Himmel gerichtet war.
"Es sind zwei Rudel. Ich dachte, es sei zu groß für eine", rief der Indianer. "Siehst du, ein Teil von ihnen nimmt die Fährte auf, und die anderen bleiben zurück und nagen an den Knochen des toten Wolfes. Wenn wir jetzt nur noch unsere Munition und das andere Gewehr hätten, das uns die Mörder abgenommen haben, würden wir ein Vermögen machen. Was..."
Wabi hielt mit einer Plötzlichkeit inne, die Bände sprach, und der stützende Arm, den er um Rods Taille gelegt hatte, straffte sich, bis er den verwundeten Jungen zusammenzucken ließ. Beide Jungen starrten in starrem Schweigen. Die Wölfe drängten sich um eine Stelle im Schnee, die auf halbem Weg zwischen der Tamarakhütte und dem Ort des jüngsten Festmahls lag. Die ausgehungerten Tiere verrieten ungewöhnliche Erregung. Sie waren auf die Blutlache und die rote Spur gestoßen, die der sterbende Elch hinterlassen hatte!
"Was ist los, Wabi?", flüsterte Rod.
Der Indianer antwortete nicht. Seine schwarzen Augen leuchteten mit einem neuen Feuer, seine Lippen waren in ängstlicher Erwartung gespalten, und er schien in seinem gespannten Interesse kaum zu atmen. Der verwundete Junge wiederholte seine Frage, und wie als Antwort wich die Meute nach Westen aus und bewegte sich in einer schwarzen, schweigenden Masse in eine Richtung, die sie hundert Meter von den jungen Jägern entfernt in die Tamaraks bringen würde.
"Eine neue Fährte!", hauchte Wabi. "Eine neue Fährte, und zwar eine heiße! Hört! Sie geben keinen Laut von sich. Das ist immer so, wenn sie kurz vor dem Erlegen sind!"
Während sie sich umschauten, verschwanden die letzten Wölfe im Wald. Einige Augenblicke lang herrschte Stille, dann ertönte ein Chor von Heulern tief aus dem Wald hinter ihnen.
"Das ist unsere Chance", rief der Indianer. "Sie sind wieder ausgebrochen, und ihr Wild..."
Er hatte seinen Arm von Rods Hüfte genommen und wollte sich gerade zu Boden sinken lassen, als die Meute erneut in ihre Richtung abbog. Ein schweres Krachen im Unterholz, keine zehn Ruten entfernt, ließ Wabi eilig nach seinem Sitzplatz kraxeln.
"Schnell - höher hinauf!", warnte er aufgeregt. "Sie kommen hier heraus, direkt unter uns! Wenn wir es schaffen, so hoch zu kommen, dass sie uns weder sehen noch riechen können..."
Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, als eine riesige, schattenhafte Masse an ihnen vorbeirannte, nicht mehr als fünfzig Meter von der Fichte entfernt, in der sie Zuflucht gesucht hatten. Beide Jungen erkannten ihn als Elchbullen, obwohl keiner von ihnen auf die Idee kam, dass es sich um dasselbe Tier handelte, auf das Wabi am selben Tag vor ein paar Meilen geschossen hatte. Die gefräßige Meute folgte ihm dicht auf den Fersen. Ihre Köpfe hingen dicht an der blutigen Fährte, und zwischen ihren klaffenden Kiefern drangen hungrige, knurrende Schreie hervor, als sie über die kleine Öffnung fast bis zu den Füßen der jungen Jäger fegten. Es war ein Anblick, mit dem Rod nie gerechnet hatte, und der selbst den erfahreneren Wabi faszinierte. Keiner der beiden Jugendlichen gab einen Laut von sich, als sie auf die wilden, hungrigen Gesetzlosen der Wildnis hinunterstarrten. Für Wabi bedeutete dieser Anblick des Rudels eine schicksalhafte Geschichte, für Rod bedeutete er nichts anderes als die Tragödie, die sich vor seinen Augen abspielen sollte. Der scharfe Blick des Indianers sah im weißen Mondlicht lange, dünne Körper, die fast bis auf Haut und Knochen ausgehungert waren; für seinen Gefährten schien die heranstürmende Meute nur aus flinken, kräftigen Tieren zu bestehen, die durch die Nähe ihrer Beute zu fast teuflischen Anstrengungen getrieben wurden.
Im Nu waren sie verschwunden, aber in diesem Augenblick ihres Vorbeiziehens entstand ein Bild, das Roderick Drew ein Leben lang in Erinnerung bleiben sollte. Und es sollte ein noch tragischeres, noch aufregenderes Bild folgen. Für den benommenen, halb ohnmächtigen jungen Jäger schien es nur noch ein Augenblick zu sein, bevor die Meute den alten Bullen überholte. Er sah, wie sich das todgeweihte Ungeheuer umdrehte, hörte in der Stille das Schnappen der Kiefer, das Knurren der hungrigen Tiere und ein Geräusch, das ein großes, hektisches Stöhnen oder ein sterbendes Brüllen hätte sein können. In Wabis Adern tanzte das Blut mit der Erregung, die seine Vorväter zum Kampf anspornte. Keine Zeile der Tragödie, die sich vor seinen Augen abspielte, entging dem Sohn der Wildnis. Es war ein großartiger Kampf! Er wusste, dass der alte Stier in dem einseitigen Zweikampf um Zentimeter sterben würde und dass es am Ende mehr als einen Kadaver geben würde, an dem sich die Überlebenden laben konnten. Leise griff er nach oben und berührte seinen Gefährten.
"Jetzt ist unsere Zeit gekommen", sagte er. "Komm schon - still und auf dieser Seite des Baumes!"
Er rutschte Fuß für Fuß hinunter, wobei er Rod half, und als beide den Boden erreicht hatten, bückte er sich wie zuvor, damit der andere auf seinen Rücken steigen konnte.
"Ich schaffe es allein, Wabi", flüsterte der verwundete Junge. "Heb mich doch mal am Arm hoch, ja?"
Mit dem Arm des Indianers um seine Taille machten sich die beiden auf den Weg in die Tamarakwälder. Fünfzehn Minuten später kamen sie an das Ufer eines kleinen zugefrorenen Flusses. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses, etwa hundert Meter weiter, bot sich ihnen ein Anblick, den beide wie aus einem gemeinsamen Impuls heraus mit einem Freudenschrei begrüßten. In der Nähe des Ufers, geschützt durch einen dichten Fichtenwald, brannte ein helles Lagerfeuer. Auf Wabis weithin hörbaren Ruf hin erschien eine schemenhafte Gestalt im Schein des Feuers und erwiderte den Schrei.
"Mukoki!", rief der Indianer.
"Mukoki!", lachte Rod, froh, dass das Ende nahe war.
Noch während er sprach, schwankte er schwindelig, und Wabi ließ sein Gewehr fallen, um seinen Begleiter vor dem Sturz in den Schnee zu bewahren.
KAPITEL II
WIE WABIGOON EIN WEISSER MANN WURDE
Hätten die jungen Jäger in die Zukunft blicken können, wäre ihr Lagerfeuer in dieser Nacht auf dem gefrorenen Ombabika vielleicht eines ihrer letzten gewesen, und ein paar Tage später hätten sie sich wieder am Rande der Zivilisation befunden. Hätten sie den glücklichen Ausgang der Abenteuer, die vor ihnen lagen, voraussehen können, wären sie vielleicht trotzdem weitergezogen, denn die Liebe zum Nervenkitzel ist stark im Herzen einer robusten Jugend. Aber diese Einsichtsfähigkeit blieb ihnen versagt, und erst in späteren Jahren, als die geliebten Menschen an ihren eigenen Kaminen in der Nähe waren, wurde ihnen das ganze Bild enthüllt. Und in jenen Tagen, als sie sich mit ihren Familien um die knisternden Holzscheite des Winters versammelten und ihre frühe Jugend noch einmal durchlebten, wussten sie, dass alles Gold der Welt sie nicht dazu bringen würde, sich von ihren Erinnerungen an das vergangene Leben zu trennen.
Knapp dreißig Jahre vor der Zeit, von der wir hier schreiben, verließ ein junger Mann namens John Newsome die große Stadt London in Richtung Neue Welt. Das Schicksal hatte ein hartes Spiel mit dem jungen Newsome gespielt - es hatte ihm zuerst beide Elternteile genommen und ihn dann in einer einzigen unvorhergesehenen Drehung des Rades des wenigen Besitzes beraubt, den er geerbt hatte. Wenig später kam er nach Montreal, und da er als junger Mann über eine gute Ausbildung und beträchtlichen Ehrgeiz verfügte, konnte er sich leicht eine Stelle sichern und sich das Vertrauen seiner Arbeitgeber erarbeiten, so dass er eine Anstellung als Faktor in Wabinosh House erhielt, einer Post tief in der Wildnis des Nipigon-Sees.
Im zweiten Jahr seiner Herrschaft in Wabinosh - ein Factor ist in seinem Gebiet praktisch König - kam ein Indianerhäuptling namens Wabigoon auf den Posten, und mit ihm seine Tochter Minnetaki, zu deren Ehren in späteren Jahren eine Stadt benannt wurde. Minnetaki war eine junge Frau und besaß eine Schönheit, die man bei indianischen Mädchen nur selten findet. Wenn es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gibt, dann entstand sie in dem Moment, als John Newsomes Blick auf diese schöne Prinzessin fiel. Von da an besuchte er das Dorf von Wabigoon, das dreißig Meilen tiefer in der Wildnis lag, häufig. Minnetaki erwiderte von Anfang an die Zuneigung des jungen Faktors, aber ein wichtiger Grund verhinderte die Heirat. Seit langem wurde Minnetaki von einem mächtigen jungen Häuptling namens Woonga umworben, den sie zutiefst verabscheute, von dessen Gunst und Freundschaft aber der Fortbestand der Herrschaft ihres Vaters über seine Jagdgründe abhing.
Mit dem Auftauchen des jungen Häuptlings entbrannte eine erbitterte Rivalität zwischen den beiden Bewerbern, die in zwei Mordanschlägen auf Newsome und einem Ultimatum von Woonga an Minnetakis Vater endete. Minnetaki selbst antwortete auf dieses Ultimatum. Es war eine Antwort, die das Feuer des Hasses und der Rache in Woongas Brust zu fieberhafter Hitze entfachte. In einer dunklen Nacht griff er an der Spitze einer Schar seines Stammes das Lager von Wabigoon an, um die Prinzessin zu entführen. Der Angriff war zwar in gewisser Weise erfolgreich, doch sein Hauptziel scheiterte. Wabigoon und ein Dutzend seiner Stammesangehörigen wurden getötet, aber schließlich wurde Woonga vertrieben.
Ein schneller Bote brachte die Nachricht vom Angriff und vom Tod des alten Häuptlings zum Wabinosch-Haus, und Newsome eilte mit einem Dutzend Männer seiner Verlobten und ihrem Volk zu Hilfe. Es kam zu einem Gegenangriff auf Woonga, und er wurde unter großen Verlusten tief in die Wildnis getrieben. Drei Tage später wurde Minnetaki auf der Hudson Bay Post zu Newsomes Frau.
Von dieser Stunde an begann eine der blutigsten Fehden in der Geschichte der großen Handelsgesellschaft; eine Fehde, die, wie wir noch sehen werden, sogar bis in die zweite Generation andauern sollte.
Woonga und sein Stamm waren nun nichts anderes als Gesetzlose und machten so erfolgreich Jagd auf die Überreste des toten Wabigoon-Volkes, dass letztere fast ausgerottet wurden. Diejenigen, die übrig geblieben waren, zogen in die Nähe der Post. Die Jäger von Wabinosh House wurden überfallen und erschlagen. Indianer, die zum Handel an den Posten kamen, wurden als Feinde betrachtet, und die Jahre schienen nur wenig daran zu ändern. Die Fehde bestand immer noch. Die Geächteten wurden als "Woongas" bezeichnet, und ein Woonga galt als gutes Ziel für das Gewehr eines jeden Mannes.
In der Zwischenzeit kamen zwei Kinder zur Welt, die die glückliche Verbindung von Newsome und seiner schönen indianischen Frau segneten. Eines davon, das älteste, war ein Junge, der zu Ehren des alten Häuptlings den Namen Wabigoon erhielt und kurz Wabi genannt wurde. Das andere war ein drei Jahre jüngeres Mädchen, und Newsome bestand darauf, dass sie Minnetaki genannt wurde. Seltsamerweise ging das Blut von Wabi fast rein auf seine indianischen Vorfahren zurück, während Minnetaki, je älter sie wurde, weniger die wilde Schönheit ihrer Mutter und mehr die sanftere Lieblichkeit der weißen Rasse entwickelte, wobei ihre Fülle an weichem, tiefschwarzem Haar und ihre großen dunklen Augen im Kontrast zur helleren Haut ihres Vaters standen. Wabi dagegen war ein Indianer, von den Mokassins bis zum Scheitel, dunkelhäutig, sehnig, flink wie ein Luchs, und jeder Instinkt in ihm schrie nach dem Leben in der Wildnis. Dennoch war ihm eine kaukasische Schlauheit und Intelligenz in die Wiege gelegt, die über den Faktor selbst hinausging.
Eine von Newsomes Hauptfreuden im Leben war die Erziehung seiner Braut aus dem Wald gewesen, und es war der Ehrgeiz beider, die kleine Minnetaki und ihren Bruder so zu erziehen, wie es weiße Kinder tun. Folglich begannen sowohl Mutter als auch Vater ihre Ausbildung bei der Post; sie wurden auf die Schule des Faktors geschickt und verbrachten zwei Winter in Port Arthur, damit sie die Vorteile einer gut ausgestatteten Schule genießen konnten. Die Kinder erwiesen sich als ungewöhnlich aufgeweckte Schüler, und als Wabi sechzehn und Minnetaki zwölf Jahre alt waren, hätte man an ihrer Art zu sprechen nicht erkennen können, dass in ihren Adern indianisches Blut floss. Dennoch waren beide durch den gemeinsamen Wunsch ihrer Eltern mit dem Leben der Indianer vertraut und konnten die Sprache des Volkes ihrer Mutter fließend sprechen.
Etwa zu dieser Zeit wurden die Woongas bei ihren Raubzügen besonders wagemutig. Diese Gesetzlosen gaben nicht mehr vor, ihren Lebensunterhalt mit ehrlichen Mitteln zu verdienen, sondern machten unterschiedslos Jagd auf Trapper und andere Indianer, raubten und töteten, wann immer sich eine sichere Gelegenheit bot. Der Hass auf die Bewohner von Wabinosch House wurde vererbt, und die Woonga-Kinder wuchsen mit diesem Hass in ihren Herzen auf. Der wahre Grund für die Fehde war von vielen vergessen worden, nicht aber von Woonga selbst. Schließlich wurde er so dreist, dass die Provinzregierung ein Kopfgeld auf ihn und eine Reihe seiner berüchtigtsten Anhänger aussetzte. Eine Zeit lang wurden die Geächteten aus dem Land vertrieben, aber der blutrünstige Häuptling selbst konnte nicht gefasst werden.
Als Wabi siebzehn Jahre alt war, wurde beschlossen, dass er für ein Jahr auf eine große Schule in den Staaten geschickt werden sollte. Gegen diesen Plan wehrte sich der junge Indianer - fast alle Menschen betrachteten ihn als Indianer, und Wabi war stolz darauf - mit allen ihm zur Verfügung stehenden Argumenten. Er liebte die Wildnis mit der Leidenschaft der Rasse seiner Mutter. Der Gedanke an eine große Stadt mit ihren überfüllten Straßen, ihrem Lärm, ihrer Betriebsamkeit und ihrem Schmutz widerstrebte ihm. Da flehte Minnetaki ihn an, nur für ein Jahr zu gehen und dann zurückzukommen, um ihr von allem zu erzählen, was er gesehen hatte, und sie zu lehren, was er gelernt hatte. Wabi liebte seine schöne kleine Schwester mehr als alles andere auf der Welt, und sie war es, die ihn schließlich mehr als seine Eltern dazu bewegte, zu gehen.
Drei Monate lang widmete sich Wabi gewissenhaft seinen Studien in Detroit. Doch mit jeder Woche wuchsen seine Einsamkeit und seine Sehnsucht nach Minnetaki und seinen Wäldern. Jeder Tag wurde für ihn zu einer schmerzhaften Aufgabe. An Minnetaki schrieb er dreimal in der Woche, und dreimal in der Woche schrieb das kleine Mädchen im Wabinosch-Haus lange, aufmunternde Briefe an ihren Bruder - obwohl sie nur etwa zweimal im Monat nach Wabi kamen, denn nur so oft ging der Briefträger von der Post aus.
Zu dieser Zeit in seinem einsamen Schulleben lernte Wabigoon Roderick Drew kennen. Roderick war, so wie Wabi sich zu dieser Zeit vorstellte, ein Kind des Unglücks. Sein Vater war gestorben, bevor er sich erinnern konnte, und das Vermögen, das er hinterlassen hatte, war im Laufe der Jahre langsam dahin geschrumpft. Rod verbrachte gerade seine letzte Schulwoche, als er Wabigoon kennenlernte. Die Not war zu seinem grimmigen Herrn geworden, und in der folgenden Woche sollte er arbeiten gehen. Wie der Junge seinem indianischen Freund die Situation beschrieb, hatte seine Mutter "bis zuletzt dafür gekämpft, ihn in der Schule zu halten, aber jetzt war seine Zeit abgelaufen." Wabi nahm den weißen Jungen wie eine Oase in einer riesigen Wüste auf. Nach einiger Zeit wurden die beiden fast unzertrennlich, und ihre Freundschaft gipfelte darin, dass Wabi in das Haus der Drews einzog. Mrs. Drew war eine gebildete und kultivierte Frau, und ihr Interesse an Wabigoon war fast das einer Mutter. In dieser Umgebung wurden die Ecken und Kanten im Benehmen des Indianerjungen geglättet, und seine Briefe an Minnetaki waren mehr und mehr mit begeisterten Beschreibungen seiner neuen Freunde gefüllt. Nach einiger Zeit erhielt Mrs. Drew einen Dankesbrief von der Mutter der Prinzessin in Wabinosh House, und so entstand eine angenehme Korrespondenz zwischen den beiden.
Es gab nun nur noch wenige einsame Stunden für die beiden Jungen. An den langen Winterabenden, wenn Roderick mit seiner Arbeit fertig war und Wabi seine Studien beendet hatte, saßen sie vor dem Feuer, und der Indianerjunge beschrieb ihnen das herrliche Leben in der weiten nördlichen Wildnis; und Tag für Tag und Woche für Woche wuchs in Rods Brust der Wunsch, dieses Leben zu sehen und zu leben. Tausend Pläne wurden geschmiedet, tausend Abenteuer erdacht, und die Mutter lächelte und lachte und plante mit ihnen.
Doch irgendwann war alles zu Ende, und Wabi kehrte zurück zu seiner Prinzessin, zu Minnetaki und zu seinen Wäldern. Den Jungen standen Tränen in den Augen, als sie sich trennten, und die Mutter weinte um den Indianerjungen, der zu seinem Volk zurückkehrte. Viele der folgenden Tage waren für Roderick Drew schmerzhaft. Acht Monate hatten eine neue Natur in ihm geweckt, und als Wabi ging, war es, als ob ein Teil seines eigenen Lebens mit ihm gegangen wäre. Der Frühling kam und ging, und dann der Sommer. Jede Post aus dem Wabinosch-Haus brachte Briefe für die Drews, und nie ließ ein indianischer Kurier ein Paket bei der Post fallen, das nicht ein Bündel Briefe für Wabigoon enthielt.
Dann, im Frühherbst, als die Septemberfröste die Blätter des Nordens rot und golden färbten, kam der lange Brief aus Wabi, der Freude, Aufregung und Besorgnis in das kleine Haus der Mutter und ihres Sohnes brachte. Er wurde begleitet von einem Brief des Faktors selbst, einem weiteren von der Mutter der Prinzessin und einem winzigen Zettel von Minnetaki, die die anderen anflehte, dass Roderick und Mrs. Drew den Winter bei ihnen im Wabinosch-Haus verbringen könnten.
"Ihr braucht keine Angst zu haben, eure Stellung zu verlieren", schrieb Wabigoon. "Wir werden hier oben in diesem Winter mehr Geld verdienen als du in drei Jahren in Detroit. Wir werden Wölfe jagen. Das Land ist voller Wölfe, und die Regierung setzt eine Prämie von fünfzehn Dollar für jeden erlegten Skalp aus. Vor zwei Wintern habe ich vierzig erlegt, und dabei habe ich kein Geschäft daraus gemacht. Ich habe einen zahmen Wolf, den wir als Lockvogel benutzen. Machen Sie sich keine Gedanken über ein Gewehr oder so etwas. Wir haben alles hier."
Mehrere Tage lang berieten Mrs. Drew und ihr Sohn über die Situation, bevor sie eine Antwort an die Newsomes schickten. Roderick plädierte dafür, malte sich die herrlichen Zeiten aus, die sie erleben würden, die Gesundheit, die sie dadurch erlangen würden, und trug ein Dutzend verschiedener Argumente vor, die für die Annahme der Einladung sprachen. Seine Mutter hingegen war von Zweifeln geplagt. Ihre Finanzen waren erschreckend niedrig, und Rod würde ein sicheres, wenn auch kleines Einkommen aufgeben, von dem sie jetzt gut leben konnten. Seine Zukunft sah rosig aus, und in diesem Winter würde er in dem Handelshaus, in dem er angestellt war, auf zehn Dollar pro Woche aufsteigen. Schließlich kamen sie zu einer Übereinkunft. Mrs. Drew würde nicht nach Wabinosh House gehen, aber sie würde Roderick erlauben, den Winter dort zu verbringen, und eine entsprechende Nachricht wurde in die Wildnis geschickt.
Drei Wochen später kam die Antwort von Wabigoon. Am zehnten Oktober würde er sich mit Rod in Sprucewood am Black Sturgeon River treffen. Von dort würden sie mit dem Kanu den Sturgeon River hinauf zum Sturgeon Lake fahren, eine Portage zum Lake Nipigon nehmen und das Wabinosh House erreichen, bevor das Eis des frühen Winters sie einsperrte. Die Vorbereitungen waren schnell getroffen, und am vierten Tag nach dem Erhalt von Wabis Brief warteten Rod und seine Mutter auf den Zug, der den Jungen in sein neues Leben führen sollte. Erst am elften Tag kam er in Sprucewood an. Wabi erwartete ihn dort in Begleitung eines Indianers von der Post, und noch am selben Nachmittag wurde die Reise den Black Sturgeon River hinauf angetreten.
KAPITEL III
RODERICK SIEHT DEN FUSSABDRUCK
Rod war nun zum ersten Mal in seinem Leben in das Herz der Wildnis eingetaucht. Er saß im Bug des Kanus aus Birkenrinde, das sie den Sturgeon hinaufbrachte, und Wabi dicht hinter ihm. Er genoss die wilde Schönheit der Wälder und Sümpfe, durch die sie fast so geräuschlos wie Schatten glitten, sein Herz klopfte vor freudiger Erregung, und seine Augen waren ständig auf der Hut vor dem Großwild, von dem Wabi ihm sagte, dass es überall um sie herum war. Über seinen Knien lag Wabis Repetiergewehr, bereit zum sofortigen Einsatz. Die Luft war scharf und frisch, wie es die Nachtfröste hinterlassen hatten. Manchmal schlossen tiefe goldene und purpurne Wälder sie ein, manchmal reichten schwarze Fichtenwälder bis an den Fluss heran, dann wieder zogen sie lautlos durch große Tamarakensümpfe. In dieser weiten Einöde herrschte eine geheimnisvolle Stille, abgesehen von den gelegentlichen Geräuschen des wilden Lebens. Rebhühner trommelten in den Wäldern, Entenschwärme stiegen fast bei jeder Kurve mit großem Flügelschlag auf, und einmal, am späten Morgen des ersten Tages, wurde Rod durch ein Krachen im Unterholz aufgeschreckt, das kaum einen Steinwurf vom Kanu entfernt war. Er sah, wie sich die Schösslinge drehten und bogen, und hörte Wabi hinter sich flüstern:
"Ein Elch!"
Das waren Worte, bei denen seine Hände zitterten und sein ganzer Körper vor Erwartung bebte. Er hatte nichts mehr von der Gelassenheit des alten Jägers an sich, nichts von der fast stoischen Gleichgültigkeit, mit der die Männer des großen Nordens die Geräusche der wilden Dinge um sie herum hören. Rod hatte sein erstes Großwild noch nicht gesehen.
Dieser Moment kam am Nachmittag. Das Kanu war leicht um eine Biegung des Flusses herumgeschlittert. Hinter dieser Biegung hatte sich ein Haufen totes Treibholz am Ufer verkeilt, und dieses Treibholz war, als die späte Sonne hinter den Wäldern versank, in ein warmes gelbes Licht getaucht. Und in diesem Schein sonnte sich, wie er es in den nahenden Winternächten gerne tut, ein Tier, dessen Anblick Rod einen spitzen, erregten Schrei entlockte. In einem Augenblick hatte er erkannt, dass es ein Bär war. Das Tier war völlig überrumpelt und weniger als ein halbes Dutzend Ruten entfernt. Blitzschnell und ohne zu wissen, was er tat, zog der Junge sein Gewehr an die Schulter, zielte schnell und schoss. Der Bär kletterte bereits das Treibholz hinauf, hielt aber beim Schuss plötzlich inne, rutschte aus, als wolle er zurückfallen, und setzte dann seinen Rückzug fort.
"Du hast ihn getroffen!", rief Wabi. "Schnell - versuch's noch einmal!"
Rods zweiter Schuss schien keine Wirkung zu haben. In seiner Aufregung sprang er auf, vergaß, dass er sich in einem schwachen Kanu befand, und gab einen letzten Schuss auf das große schwarze Tier ab, das gerade über den Rand des Treibholzes verschwinden wollte. Sowohl Wabi als auch sein indianischer Gefährte warfen sich auf die Uferseite ihrer Birke und gruben ihre Paddel tief ins Wasser, aber ihre Bemühungen waren vergeblich, ihren leichtsinnigen Kameraden zu retten. Durch die Erschütterung seines Gewehrs aus dem Gleichgewicht gebracht, stürzte Rod rückwärts in den Fluss, doch bevor er Zeit hatte, unterzugehen, griff Wabi zu ihm hinüber und packte ihn am Arm.
"Rühr dich nicht vom Fleck - und halte das Gewehr fest!", warnte er. "Wenn wir versuchen, dich hier reinzuholen, gehen wir alle über Bord!" Er gab dem Indianer ein Zeichen, der das Kanu langsam an Land schwenkte. Dann grinste er in Rods tropfendes, unglückliches Gesicht.
"Mein Gott, der letzte Schuss war ein Geniestreich für einen Anfänger! Du hast deinen Bären erwischt!"
Trotz seiner unbequemen Position stieß Rod einen Freudenschrei aus, und kaum hatten seine Füße festen Boden berührt, löste er sich aus Wabis Griff und stürzte sich auf das Treibholz. Auf der Spitze des Treibholzes fand er den Bären, der durch einen Schuss in die Seite und einen weiteren in den Kopf so tot war, wie man es nur sein konnte. Er stand neben seinem ersten großen Wild, tropfte und zitterte und blickte auf die beiden hinunter, die ihr Kanu an Land zogen, und stieß eine Reihe triumphierender Rufe aus, die noch eine halbe Meile weit zu hören gewesen wären.
"Das ist ein Lager und ein Feuer für dich", lachte Wabi und eilte zu ihm hin. "Du hast mehr Glück, als ich dachte, Rod. Wir werden heute Abend ein prächtiges Festmahl haben und ein Feuer aus diesem Treibholz, das dir zeigen wird, was das Leben hier oben im Norden lebenswert macht. Ho, Muky", rief er dem alten Indianer zu, "schneidest du diesen Kerl bitte zurecht? Ich werde das Lager aufschlagen."
"Können wir das Fell behalten?", fragte Rod. "Es ist mein erstes, weißt du, und..."
"Natürlich können wir das. Hilf uns mit dem Feuer, Rod, dann erkältest du dich nicht."
In der Aufregung, ihr erstes Lager aufzuschlagen, vergaß Rod fast, dass er bis auf die Haut durchnässt war und dass die Nacht über sie hereinbrach. Der erste Schritt war das Errichten eines Feuers, und bald warf ein großes, knisterndes, fast rauchloses Feuer sein Licht und seine Wärme im Umkreis von dreißig Fuß aus. Wabi holte Decken aus dem Kanu, zog einen Teil seiner eigenen Kleider aus, zwang Rod, sich zu entkleiden, und schon bald war der Junge in trockene Kleidung gehüllt, während seine nassen Sachen dicht ans Feuer gehängt wurden. Zum ersten Mal sah Rod, wie eine Unterkunft in der Wildnis gebaut wurde. Fröhlich pfeifend holte Wabi eine Axt aus dem Kanu, ging an den Rand der Zedern und hieb Armvoll für Armvoll von Schösslingen und Ästen. Rod band sich seine Decken um und half beim Tragen, wobei er eine lächerliche und groteske Figur abgab, da er bei seinen Bemühungen ungeschickt herumstolperte. Innerhalb einer halben Stunde nahm der Zedernunterstand Gestalt an. Zwei gekrümmte Bäumchen wurden im Abstand von acht Fuß in den Boden gerammt, und von einem zum anderen wurde ein weiteres Bäumchen, das in den Krümmungen ruhte, gesetzt, das den Firstpfahl bildete; und von diesem Pfahl aus liefen ein halbes Dutzend anderer schräg in die Erde und bildeten ein Gerüst, auf dem die Zedernzweige aufgeschichtet wurden. Als der alte Indianer mit seinem Bären fertig war, war das Haus fertig, und mit seinen Betten aus duftenden Zweigen, dem großen Lagerfeuer davor und der dichten Wildnis um sie herum, die mit dem Herannahen der Nacht immer schwärzer wurde, dachte Rod, dass nichts in einem Bilderbuch oder einer Geschichte der Realität dieses Augenblicks gleichkommen konnte. Und als ein paar Augenblicke später große Bärensteaks über einem Haufen Kohlen brutzelten und sich der Geruch von Kaffee mit dem von auf einem heißen Stein brutzelnden Mehlkuchen vermischte, wusste er, dass seine sehnlichsten Träume wahr geworden waren.
In dieser Nacht lauschte Rod im Schein des Lagerfeuers den spannenden Geschichten von Wabi und dem alten Indianer und lag bis fast zum Morgengrauen wach, um dem gelegentlichen Heulen eines Wolfs, dem geheimnisvollen Plätschern des Flusses und den schrillen Tönen der Nachtvögel zu lauschen. In den folgenden drei Tagen gab es abwechslungsreiche Erlebnisse: An einem frostigen Morgen, bevor die anderen wach waren, stahl er sich mit Wabis Gewehr aus dem Lager und schoss zweimal auf einen Rothirsch, den er beide Male verfehlte; es gab ein aufregendes, aber erfolgloses Rennen mit einem schwimmenden Karibu im Sturgeon Lake, auf das Wabi selbst dreimal erfolglos aus großer Entfernung schoss.
Es war an einem herrlichen Herbstnachmittag, als Wabis scharfe Augen zum ersten Mal die Blockhäuser der Post entdeckten, die sich an den Rand des scheinbar unendlichen Waldes schmiegten. Als sie sich näherten, wies er Rod freudig auf die verschiedenen Gebäude hin - das Lager der Firma, die kleine Ansammlung von Angestelltenwohnungen und das Haus des Faktors, in dem Rod willkommen geheißen werden sollte. Zumindest hatte Roderick selbst gedacht, dass es dort sein würde. Doch als sie näher kamen, schoss plötzlich ein einzelnes Kanu aus dem Uferbereich, und die jungen Jäger sahen ein weißes Taschentuch, das ihnen zum Gruß zuwinkte. Wabi antwortete mit einem Freudenschrei und feuerte sein Gewehr in die Luft.
"Es ist Minnetaki!", rief er. "Sie sagte, sie würde nach uns Ausschau halten und uns entgegenkommen!"
Minnetaki! Ein kleiner Nervenkitzel schoss durch Rod. Wabi hatte sie ihm an jenen Winterabenden zu Hause tausendmal beschrieben; mit der Liebe und dem Stolz eines Bruders hatte er sie immer in ihre Gespräche und Pläne einbezogen, und irgendwie hatte Rod sie nach und nach sehr lieb gewonnen, ohne sie je gesehen zu haben.
Die beiden Kanus näherten sich rasch, und in wenigen Minuten waren sie nebeneinander. Mit einem fröhlichen Lachen beugte sich Minnetaki vor und küsste ihren Bruder, während ihre dunklen Augen einen neugierigen Blick auf den Jungen warfen, von dem sie so viel gelesen und gehört hatte.
Zu diesem Zeitpunkt war Minnetaki fünfzehn Jahre alt. Wie das Geschlecht ihrer Mutter war sie schlank, fast von weiblicher Größe und unbewusst so anmutig in ihren Bewegungen wie ein Rehkitz. Ihr leicht gewelltes, rabenschwarzes Haar umrahmte eines der hübschesten Gesichter, das Rod je gesehen hatte, und in dem schweren seidenen Zopf, der ihr über die Schulter fiel, waren einige rote Herbstblätter verwoben. Als sie sich in ihrem Kanu aufrichtete, schaute sie Rod an und lächelte, und als er sich höflich bemühte, seine Mütze auf zivilisierte Weise zu heben, verlor er dieses Kleidungsstück in einem plötzlichen Windstoß. Sofort brach ein allgemeines Gelächter aus, dem sich sogar der alte Indianer anschloss. Der kleine Zwischenfall trug mehr zur Kameradschaft bei als alles andere, was hätte passieren können, und wieder lachte Minnetaki in Rods Gesicht und drängte ihr Kanu in Richtung der schwimmenden Mütze.
"Du solltest so etwas erst tragen, wenn es kalt wird", sagte sie, nachdem sie die Mütze geholt und ihm gereicht hatte. "Wabi tut es, aber ich nicht!"
"Dann werde ich es auch nicht tun", erwiderte Rod galant, und bei Wabis Lachanfall erröteten beide.
In dieser ersten Nacht auf der Post stellte Rod fest, dass Wabi bereits alle Pläne für die Winterjagd gemacht hatte und dass die komplette Ausrüstung des weißen Jungen in dem ihm zugewiesenen Zimmer im Haus des Faktors auf ihn wartete - eine tödlich aussehende fünfschüssige Remington, die der von Wabi ähnelte, ein langläufiger Revolver mit schwerem Kaliber, Schneeschuhe und ein Dutzend anderer Artikel, die man für eine lange Expedition in die Wildnis braucht. Wabi hatte auch ihre Jagdgebiete abgesteckt. Die Wölfe in der unmittelbaren Umgebung des Postens, wo sie ständig von den Indianern und den Männern des Faktors gesucht wurden, waren äußerst vorsichtig geworden und nicht sehr zahlreich, aber in der fast unbesiedelten Wildnis hundert Meilen weiter nördlich und östlich überrannten sie das Land förmlich und töteten Elche, Karibus und Hirsche in großer Zahl.
In dieser Region wollten die Wabi ihr Winterquartier aufschlagen. Der Weg dorthin sollte schnellstmöglich beschritten werden, denn das Blockhaus, in dem sie die bitterkalten Monate verbringen würden, sollte noch vor dem Einsetzen des starken Schnees gebaut werden. Es wurde daher beschlossen, dass die jungen Jäger innerhalb einer Woche aufbrechen sollten, begleitet von Mukoki, dem alten Indianer, einem Cousin des getöteten Wabigoon, dem Wabi den Spitznamen Muky gegeben hatte und der ihm seit seiner frühesten Kindheit ein treuer Kamerad gewesen war.
Rod machte das Beste aus den sechs Tagen, die ihm auf dem Posten zugestanden wurden, und während Wabi während der kurzen Abwesenheit seines Vaters in Port Arthur half, die Geschäfte des Kompanieladens zu führen, gab die reizende kleine Minnetaki unserem Helden seine ersten Lektionen im Holzhandwerk. Im Kanu, mit dem Gewehr und im Lesen der Zeichen des Waldlebens erweckte Wabis Schwester immer mehr Bewunderung in Rod. Sie über eine frisch angelegte Fährte gebeugt zu sehen, mit geröteten Wangen, vor Aufregung funkelnden Augen und reichem Haar, das von der Wärme der Sonne erfüllt war, war ein Bild, das selbst das Herz eines Achtzehnjährigen in Begeisterung versetzte, und hundertmal schwor sich der Junge im Geiste, dass "sie ein Ziegelstein" war, von den Spitzen ihrer hübschen Mokassinfüße bis zum Scheitel ihres noch hübscheren Kopfes. Mindestens ein halbes Dutzend Mal äußerte er dieses Gefühl gegenüber Wabi, und Wabi stimmte mit großer Begeisterung zu. Als die Woche fast vorüber war, waren Minnetaki und Rod tatsächlich gute Freunde geworden, und der junge Wolfsjäger begrüßte nicht ohne ein gewisses Bedauern den Morgen des Tages, an dem sie ihre Reise in die Wildnis antreten sollten.
Minnetaki war eine der ersten, die an der Post aufstanden. Rod war nur selten hinter ihr. Aber an diesem Morgen war er spät dran und hörte das Mädchen schon eine halbe Stunde, bevor er angezogen war, draußen pfeifen - Minnetaki konnte auf eine Weise pfeifen, die ihn oft mit Neid erfüllte. Als er herunterkam, war sie bereits am Waldrand verschwunden, und Wabi, der ihm ebenfalls voraus war, war mit Mukoki damit beschäftigt, ihre Ausrüstung zu verpacken. Es war ein herrlicher Morgen, klar und frostig, und Rod bemerkte, dass sich in der Nacht eine dünne Eisschicht auf dem See gebildet hatte. Ein oder zwei Mal drehte sich Wabi in Richtung Wald und gab seinen Signalruf ab, erhielt aber keine Antwort.
"Ich verstehe nicht, warum Minnetaki nicht zurückkommt", bemerkte er achtlos, während er einen Schulterriemen um ein Bündel schnallte. "Das Frühstück ist im Handumdrehen fertig. Mach dich auf die Suche nach ihr, ja, Rod?"
Rod war nicht abgeneigt und lief zügig den Weg entlang, von dem er wusste, dass er bei Minnetaki beliebt war, und der ihn bald zu einem kieseligen Strandabschnitt führte, an dem sie häufig ihr Kanu zurückließ. Dass sie erst vor wenigen Minuten hier gewesen war, konnte er daran erkennen, dass das Eis um die Birkenrinde gebrochen war, als hätte das Mädchen die Dicke des Eises getestet, indem es das leichte Boot ein paar Meter weit hinausgeschoben hatte. Ihre Schritte führten eindeutig das steile Ufer hinauf und in den Wald hinein.
"O Minnetaki-Minnetaki!"
rief Rod laut und lauschte. Es kam keine Antwort. Wie von einer Vorahnung getrieben, die er sich selbst nicht erklären konnte, eilte der Junge tiefer in den Wald hinein, den schmalen Pfad entlang, den Minnetaki genommen haben musste. Fünf Minuten - zehn Minuten - und er rief erneut. Noch immer gab es keine Antwort. Vielleicht war das Mädchen noch nicht so weit gegangen, oder sie hatte den Weg in den dichten Wald verlassen. Ein Stück weiter gab es eine weiche Stelle im Weg, wo ein großer Baumstamm vor einem halben Jahrhundert verrottet war und eine satte schwarze Erde hinterlassen hatte. Deutlich waren darin die Abdrücke von Minnetakis Mokassins zu erkennen. Eine ganze Minute lang blieb Rod stehen und lauschte, ohne einen Laut von sich zu geben. Warum er schwieg, hätte er nicht erklären können. Aber er wusste, dass er eine halbe Meile von der Post entfernt war, und dass Wabis Schwester zur Frühstückszeit nicht hier sein sollte. In dieser Minute der Stille studierte er unbewusst die Spuren im Boden. Wie klein die Füße des hübschen Indianermädchens waren! Und er bemerkte auch, dass ihre Mokassins, anders als die meisten Mokassins, einen leichten Absatz hatten.
Aber schon nach einem weiteren Augenblick wurde seine Inspektion unterbrochen. War das ein Schrei, den er weit vor sich hörte? Sein Herz schien aufzuhören zu schlagen, sein Blut raste - und in einem weiteren Augenblick rannte er wie ein Hirsch den Pfad hinunter. Zwanzig Ruten weiter mündete der Pfad in eine Öffnung im Wald, die durch ein großes Feuer entstanden war, und auf halbem Weg durch diese Öffnung bot sich dem Jungen ein Anblick, der ihn bis ins Mark erschreckte. Da war Minnetaki, ihr langes Haar fiel lose über ihren Rücken, ein Tuch war um ihren Kopf gebunden - und zu beiden Seiten schleppte sie ein Indianer schnell in den gegenüberliegenden Wald!
So lange, wie er drei Atemzüge hätte machen können, stand Rod wie erstarrt vor Entsetzen. Dann kehrten seine Sinne zu ihm zurück, und jeder Muskel in seinem Körper schien sich in Bewegung zu setzen. Seit Tagen hatte er mit seinem Revolver geübt, und er steckte jetzt im Halfter an seiner Seite. Sollte er ihn benutzen? Oder könnte er Minnetaki treffen? Zu seinen Füßen sah er einen Knüppel, den er sich schnappte und durch die Öffnung rannte, wobei der weiche Boden das Geräusch seiner Schritte dämpfte. Als er ein Dutzend Meter hinter den Indianern war, stolperte Minnetaki in einem plötzlichen Versuch, sich zu befreien, und als einer ihrer Entführer sich halb umdrehte, um sie auf die Füße zu ziehen, sah er den wütenden Jungen, der sich mit erhobener Keule wie ein Dämon auf sie stürzte. Ein furchtbarer Schrei von Rod, ein Warnschrei des Indianers, und der Kampf begann. Der Knüppel des Jungen fiel mit erdrückender Wucht auf die Schulter des zweiten Indianers, und bevor er sich von diesem Schlag erholen konnte, wurde er von dem anderen von hinten in einem würgenden, tödlichen Griff gepackt.
Durch den plötzlichen Angriff befreit, riss Minnetaki das Tuch weg, das ihr Augen und Mund verband. Blitzschnell erfasste sie die Situation. Zu ihren Füßen richtete sich der verwundete Indianer halb auf, und neben ihm lagen Rod und der andere in enger Umarmung auf dem Boden und kämpften. Sie sah den tödlichen Griff des Indianers um die Kehle ihres Beschützers, das bleiche Gesicht und die weit aufgerissenen Augen, und mit einem großen, schluchzenden Schrei hob sie die heruntergefallene Keule auf und ließ sie mit aller Kraft auf den Kopf der Rothaut fallen. Zweimal, dreimal hob und senkte sich die Keule, und der Griff um Rods Kehle lockerte sich. Ein viertes Mal hob sich die Keule, doch diesmal wurde sie von hinten aufgefangen, und eine riesige Hand umklammerte die Kehle des tapferen Mädchens, so dass der Schrei auf ihren Lippen in einem Keuchen erstarb. Doch die Erleichterung gab Rod seine Chance. Mit einer gewaltigen Kraftanstrengung griff er nach seinem Pistolenholster, zog die Waffe heraus und drückte sie dicht an den Körper seines Angreifers. Ein dumpfer Schuss ertönte, und mit einem Schmerzensschrei warf sich der Indianer nach hinten. Als der zweite Indianer den Schuss hörte und die Wirkung auf seinen Kameraden sah, löste er seinen Griff um Minnetaki und rannte in den Wald. Als Rod sah, wie Minnetaki schluchzend und verängstigt zusammenbrach, vergaß er alles andere, als zu ihr zu laufen, ihr das Haar zu streichen und sie mit allen ihm zur Verfügung stehenden jungenhaften Versicherungen zu trösten.
Hier fanden Wabi und der alte Indianerführer sie fünf Minuten später. Als sie den ersten durchdringenden Angriffsschrei von Rod hörten, waren sie in den Wald gerannt und hatten sich dabei von den zwei oder drei schrillen Schreien leiten lassen, die Minnetaki während des Kampfes unbewusst ausgestoßen hatte. Dicht hinter ihnen, Ärger witternd, folgten zwei der Postangestellten.
Die versuchte Entführung von Wabis Schwester, Rods heldenhafte Rettung und der Tod eines der Entführer, der als einer von Woongas Männern erkannt wurde, sorgten sieben Tage lang für Aufsehen bei der Post.
Die jungen Wolfsjäger dachten nicht mehr ans Aufgeben. Es war offensichtlich, dass Woonga wieder in der Nähe war, und Wabi und Rod durchkämmten zusammen mit einer Schar von Indianern und Jägern tagelang die Wälder und Sümpfe. Doch die Woongas verschwanden so plötzlich, wie sie gekommen waren. Erst als Wabi sich von Minnetaki das Versprechen abholte, nicht mehr ohne Begleitung in die Wälder zu gehen, erlaubte sich der junge Indianer, die unterbrochenen Pläne wieder aufzunehmen.
Minnetaki war in Rufweite, als sich die Woongas ohne Vorwarnung auf sie stürzten, ihre versuchten Schreie erstickten, sie wegschleppten und sie zwangen, allein über die weiche Erde zu gehen, wo Rod ihre Schritte gesehen hatte, so dass jeder, der ihr folgte, annehmen konnte, sie sei allein und in Sicherheit. Diese Tatsache rief das Dutzend weißer Familien auf dem Posten auf den Plan, und vier der fähigsten indianischen Fährtenjäger im Dienst wurden beauftragt, sich ausschließlich der Jagd auf die Gesetzlosen zu widmen, wobei ihr Einsatzgebiet in keiner Richtung mehr als zwanzig Meilen von Wabinosh House entfernt liegen sollte. Mit diesen Vorsichtsmaßnahmen glaubte man, dass Minnetaki und anderen jungen Mädchen der Post nichts passieren konnte.
Es war also an einem Montag, dem vierten November, als Rod, Wabi und Mukoki sich endlich den Abenteuern zuwandten, die sie im großen Norden erwarteten.
KAPITEL IV
RODERICKS ERSTER EINDRUCK VOM JÄGERLEBEN
Zu dieser Zeit war es bitterkalt. Die Seen und Flüsse waren zugefroren und ein leichter Schnee bedeckte den Boden. Die jungen Wolfsjäger und der alte Indianer, die bereits zwei Wochen hinter ihren Plänen zurücklagen, machten einen Gewaltmarsch um das nördliche Ende des Nipigon-Sees und fanden sich am sechsten Tag am Ombabika-Fluss wieder, wo sie wegen eines dichten Schneesturms anhalten mussten. Sie schlugen ein provisorisches Lager auf, und während sie dieses Lager errichteten, entdeckte Mukoki Anzeichen von Wölfen. Es wurde daher beschlossen, ein oder zwei Tage zu bleiben und die Jagdgründe zu erkunden. Am Morgen des zweiten Tages schoss Wabi auf den alten Elchbullen, der wenige Stunden später ein so tragisches Ende fand, und verwundete ihn, und noch am selben Morgen machten die beiden Jungen eine lange Tour nach Norden, in der Hoffnung, dass sie sich in einem guten Wildgebiet befanden, was auch bedeutete, dass es dort viele Wölfe gab.
So blieb Mukoki allein im Lager zurück. Wabi und seine Begleiter hatten in ihrem Bestreben, vor dem Einsetzen des schweren Schnees so viel wie möglich zurückzulegen, nicht angehalten, um nach Wild zu jagen, und sechs Tage lang bestand ihr einziges Fleisch aus Speck und gerupftem Wildbret. Mukoki, dessen ungeheurer Appetit nur von der Schlauheit übertroffen wurde, mit der er sich an das Wild heranpirschte, um es zu sättigen, beschloss, die Vorräte während der Abwesenheit der anderen möglichst aufzustocken, und verließ zu diesem Zweck am späten Nachmittag das Lager, um, wie er voraussah, nicht länger als eine Stunde oder so zu bleiben.
Bei sich trug er zwei kräftige Wolfsfallen, die er sich über die Schultern gehängt hatte. Mukoki schlich vorsichtig am Flussufer entlang, Augen und Ohren auf der Suche nach Wild, und stieß plötzlich auf den erfrorenen und halb aufgefressenen Kadaver eines Rothirsches. Es war offensichtlich, dass das Tier entweder am Tag oder in der Nacht zuvor von Wölfen getötet worden war, und aus den Spuren im Schnee schloss der Indianer, dass nicht mehr als vier Wölfe an der Schlachtung und dem Festmahl beteiligt gewesen waren. Daß diese Wölfe zurückkehren würden, um ihr Festmahl fortzusetzen, wahrscheinlich noch in dieser Nacht, versicherten Mukoki seine zahlreichen Erfahrungen als Wolfsjäger, und er hielt lange genug inne, um seine Fallen aufzustellen, die er anschließend mit drei oder vier Zoll Schnee bedeckte.
Als er seine Jagd fortsetzte, stieß der alte Indianer bald auf die frische Spur eines Rehs. Da er davon ausging, dass das Tier in dem tiefen Schnee keine weite Strecke zurücklegen würde, nahm er die Fährte rasch auf. Eine halbe Meile weiter blieb er abrupt stehen und stöhnte vor lauter Überraschung. Ein anderer Jäger hatte die Fährte aufgenommen!
Mit erhöhter Vorsicht ging Mukoki nun weiter. Zweihundert Meter weiter nahm ein zweites Paar Mokassinfüße die Verfolgung auf, und wenig später noch ein drittes!
Mehr von der Neugier als von der Hoffnung geleitet, sich einen Anteil an der Beute zu sichern, schlich der Indianer lautlos und schnell durch den Wald. Als er aus einem dichten Fichtenwald auftauchte, durch den ihn die Spuren führten, erlebte Mukoki eine weitere Überraschung: Er stolperte fast über den Kadaver des Rehs, dem er gefolgt war. Eine kurze Untersuchung überzeugte ihn davon, dass die Ricke mindestens zwei Stunden zuvor erschossen worden war. Die drei Jäger hatten ihr Herz, die Leber und die Zunge herausgeschnitten und auch das Hinterviertel mitgenommen, während der Rest des Tierkörpers und die Haut übrig geblieben waren! Warum hatten sie diesen wertvollsten Teil ihrer Beute vernachlässigt? Mit einem neuen Schimmer des Interesses in seinen Augen untersuchte Mukoki sorgfältig die Mokassinspuren. Bald entdeckte er, dass die Indianer vor ihm in großer Eile waren und dass sie sich, nachdem sie das beste Fleisch von der Ricke abgeschnitten hatten, auf den Weg gemacht hatten, um die verlorene Zeit durch Laufen wieder aufzuholen!
Mit einem weiteren erstaunten Grunzen kehrte der alte Indianer zu dem Kadaver zurück, zog schnell die Haut ab, wickelte die Vorderviertel und Rippen der Ricke darin ein und machte sich, so beladen, auf den Heimweg. Es war schon dunkel, als er das Lager erreichte. Wabi und Rod waren noch nicht zurückgekehrt. Er machte ein großes Feuer und hängte die Rippen der Ricke auf einen Spieß und wartete gespannt auf ihr Erscheinen.
Eine halbe Stunde später hörte er den Schrei, der ihn schnell zu Wabi führte, der den teilweise bewusstlosen Rod in seinen Armen hielt.
Es dauerte nur wenige Augenblicke, um den verletzten Jungen zum Lager zu tragen, und erst als Rod in ihrer Hütte auf einem Haufen Decken lag und die Wärme des Feuers ihn wiederbelebte, gab Wabi dem alten Indianer eine Erklärung.
"Ich glaube, er hat einen gebrochenen Arm, Muky", sagte er. "Hast du heißes Wasser?"
"Angeschossen?", fragte der alte Jäger, ohne auf die Frage zu achten. Er ließ sich neben Rod auf die Knie fallen und streckte seine langen braunen Finger ängstlich aus. "Angeschossen?"
"Nicht mit einem Knüppel getroffen. Wir trafen drei indianische Jäger, die im Lager waren und uns einluden, mit ihnen zu essen. Während wir aßen, sprangen sie uns auf den Rücken. Rod hat es erwischt - und sein Gewehr verloren!"
Mukoki zog dem verwundeten Jungen schnell die Kleider aus und entblößte seinen linken Arm und seine Seite. Der Arm war geschwollen und fast schwarz, und auf Rods Körper befand sich ein großer blauer Fleck, etwas oberhalb der Taille. Mukoki war notwendigerweise ein Chirurg, ein Arzt, wie man ihn nur in der weiten, unbeleuchteten Wildnis findet, wo die Natur der Lehrer ist. Er untersuchte ihn grob, drückte und drehte das Fleisch und die Knochen, bis Rod vor Schmerz aufschrie, aber am Ende klang ein glücklicher Triumph in seiner Stimme, als er sagte:
"Kein Knochen gebrochen - hier am meisten verletzt!" und er berührte den Bluterguss. "Beinahe eine gebrochene Rippe - nicht ganz. Das hat mir den Wind aus den Segeln genommen und mich sehr krank gemacht. Will gutes Abendbrot, heißen Kaffee - reibe dich mit Bärenfett ein, dann geht's besser!"
Rod, der seine Augen geöffnet hatte, lächelte schwach, und Wabi stieß einen halben Freudenschrei aus.
"Nicht so schlimm, wie wir dachten, was, Rod?", rief er. "Muky kannst du nichts vormachen! Wenn er sagt, dass dein Arm nicht gebrochen ist - nun, er ist es nicht, und das ist alles, was zählt. Lass mich dich in diese Decken einwickeln, und bald gibt es ein Abendessen, das die Schmerzen aus dir herausbrutzeln wird. Ich rieche Fleisch - frisches Fleisch!"
Mit einem vergnügten Glucksen sprang Mukoki auf und lief dorthin, wo die Rippen der Ricke langsam über dem Feuer brutzelten. Sie waren bereits satt braun und ihr tropfender Saft erfüllte die Nasenlöcher mit einem appetitlichen Geruch. Als Wabi das Rezept von Mukoki auf die Wunden seines Kameraden aufgetragen und sie verbunden hatte, war das verlockende Festmahl schon vor ihnen ausgebreitet.
Als ein großer Teil der Rippchen zusammen mit Maismehlkuchen und einer Tasse dampfenden Kaffees vor ihm stand, konnte Rod ein fröhliches, wenn auch etwas verlegenes Lachen nicht unterdrücken.
"Ich schäme mich für mich selbst, Wabi", sagte er. "Ich habe hier so viel Ärger gemacht, wie ein hilfloses Kind, und jetzt stelle ich fest, dass ich nicht einmal die Ausrede eines gebrochenen Arms habe, und dass ich hungrig wie ein Bär bin! Sieht ziemlich gelb aus, nicht wahr? Als ob ich mich zu Tode erschreckt hätte! So wahr mir Gott helfe, ich wünschte fast, mein Arm wäre gebrochen!"
Mukoki hatte seine Zähne in einem riesigen Stück fetter Rippe vergraben, aber er ließ sie mit einem großen kichernden Grunzen wieder herunter, sein halbes Gesicht mit den ersten Ergebnissen seines Festmahls verschmiert.
"Ganz schön krank", erklärte er. "Mir wird noch mehr schlecht - sehr schlecht! Vielleicht viel kotzen!"
"Waugh!", kreischte Wabi. "Was ist das für eine freudige Nachricht, Rod?" Seine Heiterkeit hallte weit in die Nacht hinaus. Plötzlich ertappte er sich und spähte misstrauisch in die Düsternis jenseits des Kreises aus Feuerlicht.
"Meinst du, sie würden uns folgen?", fragte er.
Es folgte ein vorsichtiges Schweigen, und der Indianerjunge erzählte Mukoki schnell die Abenteuer des Tages, wie sie im Herzen des Waldes, einige Meilen jenseits des Sees, auf die indianischen Jäger gestoßen waren, ihre scheinbar ehrliche Gastfreundschaft angenommen hatten und mitten in ihrer Mahlzeit von ihnen angegriffen worden waren. Der Überfall kam so plötzlich und unerwartet, dass einer der Indianer mit Rods Gewehr, Munitionsgürtel und Revolver entkam, bevor er aufgehalten werden konnte. Wabi befand sich unter den beiden anderen Indianern, als Rod ihm zu Hilfe kam, was zur Folge hatte, dass er zwei schwere Schläge mit einem Knüppel oder einem Gewehrschaft einstecken musste. Der Indianerjunge hatte sich so hartnäckig an seine eigene Waffe geklammert, dass seine Angreifer nach einem kurzen Kampf in das dichte Unterholz flüchteten, offenbar zufrieden mit der Ausrüstung des weißen Jungen.
"Sie gehörten zweifellos zu Woongas Leuten", schloss Wabi. "Es ist mir ein Rätsel, warum sie uns nicht getötet haben. Sie hatten ein halbes Dutzend Gelegenheiten, auf uns zu schießen, aber sie schienen uns keinen großen Schaden zufügen zu wollen. Entweder haben die Maßnahmen, die auf der Post ergriffen wurden, sie dazu gebracht, sich zu bessern, oder-"
Er hielt inne, mit einem besorgten Blick in den Augen. Sofort erzählte Mukoki von seinem eigenen Erlebnis und von der geheimnisvollen Eile der drei Indianer, die das Reh erlegt hatten.
"Das ist wirklich seltsam", erwiderte der junge Indianer. "Sie können nicht die gewesen sein, die wir getroffen haben, aber ich wette, sie gehören zur selben Bande. Es würde mich nicht wundern, wenn wir auf eines von Woongas Verstecken gestoßen wären. Wir dachten immer, dass er sich in der Region Thunder Bay im Westen aufhält, und genau dort hält Vater jetzt nach ihm Ausschau. Wir haben in ein Hornissennest gestochen, Muky, und das Einzige, was wir tun können, ist, so schnell wie möglich aus diesem Land zu verschwinden!"
"Wir würden gerade jetzt einen guten Schuss abgeben", sagte Rod und blickte hinüber zu der dichten Schwärze auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses, wo das Mondlicht die Wand der Finsternis noch undurchdringlicher zu machen schien.
Während er sprach, ertönte hinter ihm ein leises Geräusch, die Bewegung eines Körpers, der sich leise hinter der Wand aus Fichtenzweigen bewegte, dann ein neugieriges, verdächtiges Schnüffeln und danach ein leises Winseln.
"Hör zu!"
Wabis Befehl kam in einem angespannten Flüsterton. Er lehnte sich dicht an die Äste, spaltete sie heimlich und steckte langsam den Kopf durch die Öffnung.
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2023
- ISBN (ePUB)
- 9783738973709
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2023 (März)
- Schlagworte
- wolfsjäger wichita western roman