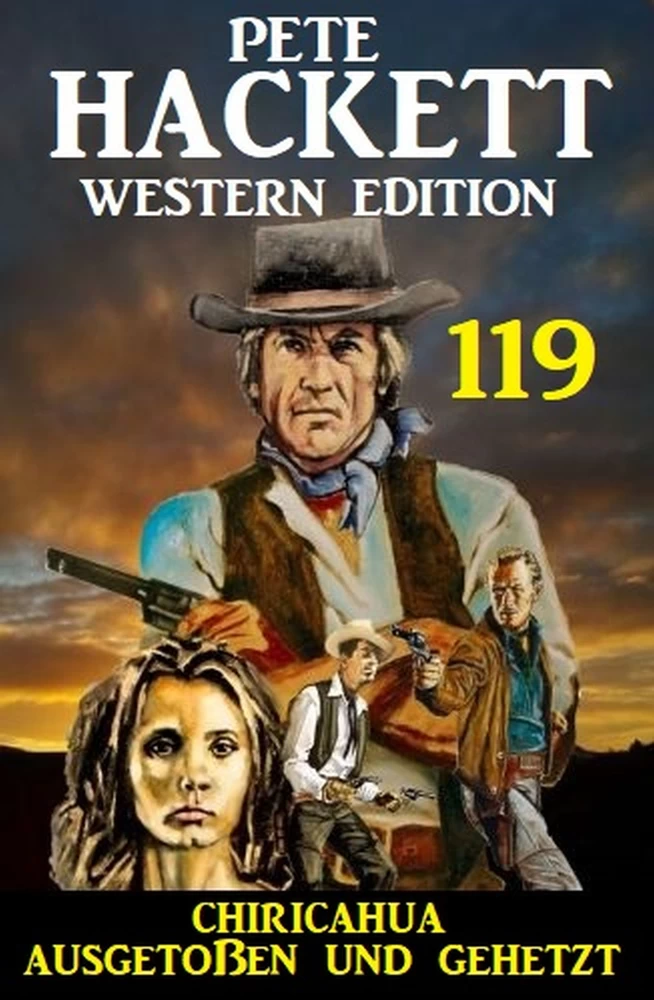Zusammenfassung
Es waren über hundertfünfzig Apachen, hauptsächlich Chiricahuas. Das personifizierte Elend, in zerschlissene Kleidung gehüllt, frierend und hungrig, heruntergekommen und Mitleid erregend. Die Gesichter waren ausgezehrt, die Augen lagen tief in den Höhlen. Diese Menschen waren offensichtlich am Ende. Abbild einer aussterbenden Rasse...
Geronimo machte sein Versprechen wahr. Er hatte die verstreut in Mexiko lebenden Apachen um sich geschart und brachte sie nun nach San Carlos. Zwar hatte er General Crook im Mai des Vorjahres versprochen, innerhalb von zwei Monaten nach San Carlos zu kommen, und daraus waren fast neun Monate geworden - aber er hielt sein Wort.
Einige Krieger trieben eine Rinderherde. Es waren ungefähr dreihundertfünfzig Stück Vieh, die Geronimo nach Norden treiben ließ. Er wollte die Rinder mit ins Reservat nehmen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
Chiricahua - Ausgestoßen und gehetzt: Pete Hackett Western Edition 119
Chiricahua
Band 6
Western von Pete Hackett
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war - eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung."
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress.
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© 2012 der Digitalausgabe 2012 by AlfredBekker/CassiopeiaPress
Band 6
Ausgestoßen und gehetzt
Februar 1884. Es war klirrend kalt. Ein Zug von Indianern bewegte sich auf mexikanischem Territorium in Richtung Norden. Pferde zogen Schleppbahren, auf denen das Hab und Gut der Apachen lag. Einige Frauen trugen kleine Kinder. Sie hatten um sich und die Kinder zerschlissene Decken geschlungen. Beim Atmen bildeten sich weiße Dampfwolken vor den Gesichtern.
Es waren über hundertfünfzig Apachen, hauptsächlich Chiricahuas. Das personifizierte Elend, in zerschlissene Kleidung gehüllt, frierend und hungrig, heruntergekommen und Mitleid erregend. Die Gesichter waren ausgezehrt, die Augen lagen tief in den Höhlen. Diese Menschen waren offensichtlich am Ende. Abbild einer aussterbenden Rasse...
Geronimo machte sein Versprechen wahr. Er hatte die verstreut in Mexiko lebenden Apachen um sich geschart und brachte sie nun nach San Carlos. Zwar hatte er General Crook im Mai des Vorjahres versprochen, innerhalb von zwei Monaten nach San Carlos zu kommen, und daraus waren fast neun Monate geworden - aber er hielt sein Wort.
Einige Krieger trieben eine Rinderherde. Es waren ungefähr dreihundertfünfzig Stück Vieh, die Geronimo nach Norden treiben ließ. Er wollte die Rinder mit ins Reservat nehmen.
Ein Weißer befand sich unter den Apachen. Auch er hatte sich eine Decke über die Schultern geworfen. Seine Haare waren nackenlang, sein Gesicht von Wind, Sonne, Regen und Schnee gegerbt. Er war kaum von den Rothäuten zu unterscheiden. Zusammengesunken saß er auf seinem Pferd. Neben ihm ritt Geronimo, der den Zug anführte. Es war Tyler Whitlock, der Mann, der im Arizona-Territorium wegen Doppelmordes gesucht wurde und der sich in New Mexiko ebenfalls nicht blicken lassen durfte, weil er zusammen mit einigen Apachen eine Herde von fünfhundert Herefords gestohlen hatte.
Mexikanische Soldaten beobachteten den Zug der Apachen in Richtung der Staaten. Die Männer atmeten auf. Es sah aus, als würde sich Geronimo endlich in sein Schicksal fügen und sich der Übermacht der Armee unterwerfen.
Keiner dieser Männer hatte Mitleid mit den Apachen. Die Herzen waren abgestumpft, in den meisten Gemütern hatte sich Hass auf diese abgerissenen Gestalten eingenistet. Zu viel Blut war in den vergangenen Jahren geflossen. Und man fürchtete die Apachen. Ja, man fürchtete diese heruntergekommenen Gestalten wie der Teufel das Weihwasser. Denn sie waren unberechenbar, gnadenlos und grausam.
Drei Tage hatten Geronimos Verhandlungen mit General Crook im Mai gedauert. Dann war Geronimo bereit gewesen, ins Reservat White Mountain zurückzukehren.
Voraus ritten vier Kundschafter, die den besten Weg für die Krieger, Squaws und Kinder suchten. Viele der Apachen waren geschwächt und erschöpft. Hinter ihnen lagen zig Meilen Wildnis und die Entbehrungen eines strengen Winters. Einige waren auf dem Weg vor Schwäche gestorben.
»Was wirst du tun, sobald wir die Grenze erreichen?«, fragte Geronimo und musterte Whitlock von der Seite.
»Ich werde nicht mit hinübergehen«, erwiderte der ehemalige Lieutenant und zuckte mit den Schultern. »Was ich genau mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht gehe ich nach Texas. Dort werde ich nicht gesucht. Mal sehen. Zunächst werde ich mich noch für einige Zeit in Mexiko verkriechen.«
»Du bist ein guter Mann, Whitlock«, sagte Geronimo. »Warum hat der Große Geist nicht alle weißen Männer so geschaffen wie dich?«
Whitlock lachte verbittert auf. »Das musst du den Großen Geist schon selber fragen, Geronimo. Dass du je eine Antwort auf deine Frage erhältst, ist jedoch unwahrscheinlich.«
Sie ritten durch unwirtliche Ödnis. Die Hügel waren verschneit, Büsche und Bäume reckten ihre kahlen Äste zum Himmel. Sich durch den oftmals knietiefen Schnee einen Weg zu bahnen war mühsam. Einige Hunde rannten neben dem Zug her. Hundegebell erhob sich. Müde zogen die Pferde die Hufe durch den Schnee. Sie gingen mit hängenden Köpfen, schnaubten und prusteten.
»Warum gehst du nicht mit uns nach San Carlos?«, fragte Geronimo. »Du bist einer von uns geworden. Du könntest dich im Reservat verstecken und...«
»Das glaubst du doch wohl selbst nicht, Geronimo«, unterbrach ihn Whitlock. »Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis man mich erkennen und mir Gesetzesmänner auf den Hals hetzen würde, die mich verhaften und einsperren. Nein, Geronimo. Ich will nicht für eine Tat gehängt werden, die ich nicht begangen habe.«
»Das sehe ich ein«, murmelte der Häuptling. »Es ist schade. Du bist kein Mörder. Warum wollen das die Leute, die dich jagen, nicht begreifen?«
»Weil es die Aussage eines Kopfgeldjägers gibt, der behauptet, dass ich Redford und Billinger in Tombstone tötete, ohne ihnen eine Chance zu lassen.«
Von nun an schwiegen sie wieder. Plötzlich erhob sich hinter ihnen Geschrei. Sie zerrten die Pferde in den Stand und blickten nach hinten. Ein halbes Dutzend Apachen standen auf einem Haufen zusammen und einige von ihnen beugten sich über etwas. Weitere Apachen liefen hinzu. Whitlock und Geronimo zogen die Pferde herum und ritten zurück. Eine Squaw war zusammengebrochen. Sie lag verkrümmt am Boden und atmete rasselnd. Zwei Krieger versuchten, sie auf die Beine zu stellen, aber sie knickten wieder weg und die Squaw fiel auf die Knie nieder. Der Kopf pendelte vor ihrer Brust. Sie war am Ende.
»Legt sie auf eine der Schleppbahren«, gebot Geronimo.
Die beiden Krieger hoben die Frau auf...
Whitlock und Geronimo setzten sich wieder an die Spitze der Kolonne. Sie kamen nur langsam voran. Eine Eskorte mexikanischer Soldaten zog östlich von ihnen nach Norden. Auch im Westen ritt parallel zu ihrer Route eine Patrouille. Die Mexikaner wollten sicher gehen, dass die Apachen ohne Umwege zur Grenze zogen, hielten sich aber von ihnen fern.
Sie erreichten die Grenze. Ihre Ankunft war gemeldet worden. Drüben verharrten zwei Kompanien Kavalleristen auf ihren Pferden. Whitlock blieb zurück. Er verabschiedete sich von Geronimo. »Vielleicht kreuzen sich unsere Wege noch einmal«, sagte der Häuptling. »Ich werde mich immer daran erinnern, dass du ein Freund der Apachen bist.«
»Überlassen wir es dem Schicksal«, erwiderte Whitlock. »Ich wünsche dir und deinen Leuten jedenfalls alles Gute, Geronimo, und hoffe für euch, dass all eure Erwartungen erfüllt werden. General Crook meint es ehrlich. Solange er im Department Arizona das Sagen hat, wird es euch an nichts mangeln. Leb wohl, Geronimo. Wenn Gott es will, begegnen wir uns irgendwann wieder.«
Whitlock durfte den Mexikanern nicht in die Hände fallen, denn sie hätten ihn sicherlich in die Staaten ausgeliefert und man würde ihn wegen zweifachen Mordes vor Gericht stellen. Einsamkeit umgab ihn, das Gefühl von Verlorenheit verstärkte sich.
Es gelang ihm, sich von den Mexikanern unbemerkt zwischen die Hügel zu schlagen.
Geronimo und seine Leute überschritten die Grenze, wo sie von den Kavalleristen in Empfang genommen wurden. Ein Major ritt vor Geronimo hin. »Alle deine Krieger haben ihre Waffen abzugeben«, befahl er. »Auch Pfeil und Bogen, Messer und Tomahawks. Was sind das für Rinder, die ihr treibt?«
»Sie gehören mir«, behauptete Geronimo. Seine Brauen hatten sich düster zusammengeschoben, über seiner Nasenwurzel hatten sich zwei senkrechte Falten gebildet. »Wir treiben sie nach San Carlos und werden lange Zeit keinen Mangel an Fleisch haben.«
»Du hast diese Rinder gestohlen!«, stieß der Major hervor und gab einigen Kavalleristen den Befehl, die Herde zu übernehmen.
»Warum nimmst du mir meine Rinder weg?«, fragte Geronimo zornig, mit Protest im Tonfall.
»Weil du sie geraubt hast«, versetzte der Major hart. »Wir werden die Herefords entweder ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben, oder wir verkaufen sie und sorgen dafür, dass er den Erlös für die Herde erhält.«
Geronimos Miene verkniff sich. Er beobachtete, wie die Soldaten die Herde übernahmen und forttrieben. Der Häuptling war unzufrieden. Er war der Meinung, dass es sich bei der Herde um einen ordentlichen Fleischvorrat für seine Leute handelte. Die ganze Angelegenheit gefiel ihm nicht. Sie wurden nicht empfangen, wie das einem Gegner gebührt, der sich freiwillig ergeben hat. Man behandelte sie wie gefangene Verbrecher. Aber er sagte nichts und ließ sich die unwürdige Behandlung gefallen. Denn er wollte den Frieden, ebenso wie General Crook.
Die Apachenkrieger gaben ihre Waffen ab.
Geronimo wurde verhört. »Bei euch hat sich ein Mann namens Tyler Whitlock verkrochen«, sagte der Major. »Wir wissen das, denn er hat deinen Männern geholfen, eine Herde Rinder zu stehlen. Wo befindet sich Whitlock jetzt? Er wird wegen Mordes und Viehdiebstahles in Arizona und New Mexiko gesucht.«
»Whitlock ist ein guter Mann«, erwiderte der Häuptling. »Er hat die beiden Männer nicht ermordet. Sie zwangen ihn, nach dem Revolver zu greifen. Whitlock hat mir die Geschichte erzählt. Und er sprach die Wahrheit.«
»Das ist nicht die Antwort auf meine Frage?«, sagte der Major ungeduldig.
»Er ist in Mexiko geblieben.«
Der Major presste die Lippen zusammen. »Eines Tages erwischen wir ihn.«
Am nächsten Tag setzte sich der Zug in Bewegung. Das Ziel war San Carlos.
*
Der Ordonnanzsoldat legte General Crook einen Stapel Zeitungen auf den Schreibtisch. »Sie sind heute mit der Postkutsche gekommen, Sir«, sagte der Soldat. »Der Tucson-Mirror, der Santa Fe-Express, die Phoenix-Post und der Tombstone Epitaph. Die Ausgaben enthalten jeweils einen Artikel über Geronimo.«
»Danke«, sagte der General und griff nach den Zeitungen. Es waren Ausgaben, die zum Teil schon zwei Wochen alt waren.
Geronimo wieder in White Mountain, hieß der Artikel im Tucson Mirror. Geronimo in Arizona!, war der Bericht im Tombstone Epitaph überschrieben, Untertitel: Der Mörder und Brandstifter soll für seine Verbrechen leer ausgehen. - Ein Meilenstein in der Indianerpolitik, hieß es im Santa Fe-Express. Der General las: Geronimo und mehr als hundertfünfzig Apachen sind nach Arizona zurückgekehrt. Sie wurden nach San Carlos gebracht. All die Gräueltaten, die die Apachen in Mexiko, Arizona und New Mexiko vollbracht haben, sollen ungesühnt bleiben. Sie haben im Reservat sogar ihre Waffen zurückerhalten.
Jeder Weiße, der einen anderen umbringt, landet am Galgen. Geronimos Taten bleiben ungestraft. Man belohnt die aufrührerischen Apachen sogar noch, indem man ihnen Land überlässt, das Weiße urbar gemacht haben, indem man ihnen innerhalb des Reservats Freizügigkeit gewährt und mit ihnen Lieferverträge über Heu, Stroh, Gemüse, Weizen und Mais abschließt.
Warum wird Geronimo nicht vor Gericht gestellt? Er hat Ranches und Haziendas überfallen, brutal getötet, geraubt und gebrandschatzt. Wo bleibt die Gerechtigkeit in unserem Land?
Der General hörte zu lesen auf. Er nahm die Phoenix-Post in die Hand. Hier lautete die Schlagzeile: Renitente Apachen kehren friedlich nach White Mountain zurück. Der General las den Untertitel: Keine Sanktionen wegen der Straftaten, die die Apachen begangen haben, vorgesehen.
Auch in diesem Artikel wurde bemängelt, dass man Geronimo derart zuvorkommend behandelte und ihn für seine Verbrechen nicht zur Rechenschaft zog. Unter anderem hieß es: ...haben die Verantwortlichen bei der Armee scheinbar nicht begriffen, dass Geronimo kein Mann des Friedens ist. Solange er lebt, ist San Carlos ein Pulverfass, in das nur der berühmte Funke zu fallen braucht. Wenn man Geronimo für seine Straftaten nicht mit aller Härte zur Rechenschaft zieht, gibt es keine Ruhe. Er wird geradezu ermuntert, bei der nächstbesten Gelegenheit wieder mit seinen Kriegern das Reservat zu verlassen und dort weiterzumachen, wo er sich im Mai des vorigen Jahres General Crook gegenüber bereit erklärt hatte, aufzuhören.
Der General griff wieder nach dem Tucson Mirror.
Die Apachen sind mit ihrem Anführer Geronimo ins Reservat White Mountain zurückgekehrt, schrieb der Reporter: Sie haben gemordet und gebrandschatzt. Weiße Männer, Frauen und Kinder wurden grausam getötet und skalpiert. Und nun behandelt die Armee diese bestialischen Mörder wie Kriegsgefangene und honoriert ihre Grausamkeit noch mit Landzuteilungen und Lieferverträgen ...
Der General legte die Zeitungen zur Seite, erhob sich, ging zur Tür und öffnete sie. »Ordonnanz!«
»Sir!« Die drei Soldaten, die in dem Büro Dienst versahen, waren aufgesprungen und hatten Haltung angenommen.
»Ich will in spätestens einer halben Stunde sämtliche Kompanieführer hier in der Kommandantur versammelt haben.«
»Jawohl, Sir!«
Der General ging zu seinem Schreibtisch zurück, ließ sich schwer auf seinen Stuhl fallen und seufzte.
Eine halbe Stunde später waren die Offiziere in der Kommandantur versammelt. »Die namhaften Zeitungen im Land machen gegen Geronimo Furore«, begann der General. »Man fordert seinen Kopf.«
»Es wäre nur gerecht, wenn man ihn vor Gericht stellen, anklagen und hängen würde«, erklärte ein Captain.
»Man würde einen neuen Apachenaufstand provozieren«, versetzte der General.
»Den man mit aller Härte und Kompromisslosigkeit niederschlagen müsste«, rief ein Major. »Die Armee ist den Apachen um ein Zehnfaches, vielleicht sogar um Zwanzigfaches überlegen. Nachsicht zu üben wäre fehl am Platz. Man muss ein Exempel stationieren.«
»Ich bin nicht für eine gewaltsame Lösung«, gab der General zu verstehen. »Blut ist genug geflossen. Auf beiden Seiten. Unsere zehn- oder zwanzigfache Übermacht hat uns nichts genützt. Wenn Geronimo nicht freiwillig aufgehört hätte, könnte er nach wie vor seinen Guerillakrieg gegen uns führen, ohne dass wir ihm groß etwas entgegenzusetzen hätten.«
»Die Öffentlichkeit verlangt seinen Kopf!«, rief ein anderer Major. »Die Volksseele kocht, weil niemand einsehen will, dass die Armee den Apachen für seine Gräueltaten nicht bestraft.«
»Man ist sicher auch in Washington nicht begeistert darüber, dass Geronimo leer ausgehen soll«, rief wieder der Captain, der vorhin schon einmal das Wort ergriffen hatte.
»Geronimo hat mein Wort«, kam es von Crook. »Ebenso wie er sein Wort gehalten hat und mit seinen Leuten nach San Carlos gekommen ist, werde ich mein Wort halten und ihn für seine Taten nicht zur Rechenschaft ziehen. Alles andere würde einen erneuten Aufstand der Apachen nach sich ziehen. Ich will aber, dass der Friede im Land erhalten bleibt.«
»Ihr Wort in allen Ehren, Sir«, sagte der Major. »Aber Sie sollten es nicht über den Willen einer breiten Öffentlichkeit stellen. Die Unzufriedenheit mit der Armeeführung im Department wächst. Bald werden die Zeitungen nicht nur Geronimos Kopf fordern, sondern auch Konsequenzen für die nach ihrer Meinung unzulängliche Indianerpolitik im Arizona-Territorium. Und Washington wird sich dem Druck der Öffentlichkeit beugen müssen.«
»Von welchen Konsequenzen sprechen Sie, Major?«, fragte der General und ließ seinen Blick über die angespannten Gesichter schweifen.
»Von Ihrer Ablösung, Sir.« Die vier Worte fielen wie Hammerschläge.
»Das lasse ich auf mich zukommen«, erklärte der General unerschütterlich.
*
Wochen waren ins Land gezogen. Längst war der Schnee verschwunden, der Frühling hatte Einzug gehalten. Tyler Whitlock hatte Mexiko verlassen. Unter dem Namen Jesse Stewart hatte er am Pecos River eine Heimstatt erworben. Und er begann, ein Haus zu bauen. Die Bank von Roswell hatte ihm ein Darlehen gewährt. Whitlock kaufte einen flachen Farmwagen, Bretter und Balken und ihm blieb noch genügend Geld, um sich ein paar Stück Vieh und Saatgut anzuschaffen, wenn er erst einmal das Haus und der Stall erbaut sein würden.
Er hatte mit der Vergangenheit abgeschlossen.
Es war ein heißer Tag im September, als Whitlock nach Roswell kam, um einige Vorräte zu kaufen. Vor den Wagen hatte er sein Pferd gespannt. Er war mit einem schwarz-weiß karierten Hemd und einer blauen Leinenhose bekleidet, auf seinem Kopf saß ein verbeulter Calgary-Hut.
Vor dem Store zügelte Whitlock das Pferd. Der Wagen kam zum Stehen. Whitlock schlang die Zügel um den Bremshebel und sprang vom Wagenbock. Staub wallte unter seinen Füßen. In der Stadt herrschte Alltag. Menschen bewegten sich auf den Gehsteigen zu beiden Seiten der Straße. Fuhrwerke rollten auf der Fahrbahn, Reiter zogen vorüber. Kinder spielten am Straßenrand, Hunde lagen in den Schatten und dösten.
Whitlock zog den Revolvergurt etwas in die Höhe, richtete das Holster, reckte die breiten Schultern, dann ging er in den Laden. Die Türglocke bimmelte. Allan Welby, der Storeinhaber, stand hinter dem Verkaufstresen und bediente eine Frau mittleren Alters, deren Rock bis zu den Knöcheln reichte und deren Bluse bis zum Hals geschlossen war. Sie hatte die Haare hochgesteckt und zu einem Dutt gebunden. Sie vermittelte einen strengen Eindruck.
Whitlock wartete, bis sie fertig war und bezahlt hatte, er nickte der Lady zu und griff an die Krempe seines Hutes, als sie an ihm vorüber zur Tür ging. Die Türglocke bimmelte, als sie den Laden verließ. Bei Whitlock hatte sie einen hochmütigen Eindruck hinterlassen.
Allan Welby sagte: »Das war unsere Lehrerin, Miss Flaubert. Sie bringt sogar die frechsten Lümmel zur Raison. Hallo, Mr. Stewart. Wie kommen Sie voran?«
»Ganz gut. Das Haus ist halb fertig. Ich denke, dass ich im Herbst die ersten Felder pflügen kann.«
»Alleine eine Farm aufzubauen ist fast aussichtslos. Aber darüber haben wir schon etliche Male gesprochen. Was brauchen Sie?«
»Mehl, Zucker, Kaffee, Bohnen und eine ganze Reihe weiterer Dinge. Ich habe alles aufgeschrieben. Während Sie mir die Waren zusammenstellen, gehe ich ein Bier trinken.«
»Gehen Sie nur.«
Whitlock überließ dem Storeinhaber die Liste der Dinge, die er in den nächsten Monaten benötigte, verließ den Store, tätschelte draußen seinem Pferd den Hals, dann überquerte er die Straße und ging in den Saloon.
Es war Mittagszeit und es gab nur drei Gäste. Im Saloon war es düster. Es roch nach kaltem Rauch und verschüttetem Bier. Der Boden war mit Sägemehl bestreut.
Whitlock ging zum Tresen und bestellte ein Bier. Als es der Keeper vor ihn hinstellte, nahm er einen durstigen Zug.
Einer der Gäste sagte: »Verdammte Hitze heute. Wie geht es euch da draußen am Pecos? Vor zwei Wochen ist ein Mann mit 2.000 Rindern in diesen Landstrich gekommen. Er will am Pecos eine Ranch gründen. Kommt von Texas herüber. Sein Name ist Jack Halloway. Er hat ein halbes Dutzend Männer mitgebracht.«
»Viel Arbeit«, sagte Whitlock. »Aber das Geld, um Handwerker bezahlen zu können, habe ich nicht. Manchmal bin ich nahe daran, aufzugeben. Aber dann denke ich daran, dass es ein guter Platz ist, und das gibt mir Auftrieb. Von Jack Halloway habe ich gehört. Er hat das Regierungsland östlich von meiner Parzelle besetzt. Nun, ich werde wohl einen Zaun ziehen, der mein Land begrenzt und verhindert, dass Longhorns auf meine Felder laufen und sie verwüsten.«
»Das heißt, Sie schneiden Halloways Rinder vom Pecos ab«, sagte einer der Gäste. »Wenn das mal keinen Ärger gibt.«
»Nördlich und südlich von mir siedeln auch Leute«, sagte Whitlock. »Wenn Halloways Rinder nicht genügend Wasser haben, muss er eben weiterziehen. Wir haben unsere Parzellen ordnungsgemäß erworben und unser Anspruch auf das Land ist durch das Heimstättengesetz rechtlich verbürgt.«
Ein Mann betrat den Saloon. Knarrend und quietschend schwangen hinter ihm die Türpendel aus. Er hielt eine Zeitung in der Hand, kam zum Tresen, warf die Zeitung darauf und sagte: »Diese verdammten Apachen geben keine Ruhe. Sie haben in der Nähe von Florence eine Ranch überfallen und einige Dutzend Rinder gestohlen. Ruhe wird erst einkehren, wenn Geronimo, dieser Teufel in Menschengestalt, am Ende eines Strickes zappelt. – Gib mir einen Brandy, Joe.«
»Ich habe von einer mexikanischen Bande gehört, die im Grenzgebiet für Unruhe sorgt. Kann es nicht sein, dass sie...«
»Nein, das waren die Apachen. Geronimo gibt keine Ruhe. Sozusagen vor den Augen der Armee plündert und brandschatzt er. Ich sage euch, was Sache ist: Crook ist unfähig. Wobei ich nicht mal Crook alleine die Schuld geben möchte. Es krankt auf der ganzen Linie. Solange Washington zuschaut...«
Der Mann brach ab und stürzte den Brandy hinunter, den ihm der Keeper eingeschenkt hatte.
»Gibt es einen Beweis, dass es die Apachen waren?«, fragte Whitlock. Er hielt seinen Bierkrug in der Rechten, die Linke lag lose auf dem Handlauf des Tresens.
»Der Santa Fe-Express schreibt es. Warum sollte ich daran zweifeln? Diesen roten Halunken traue ich alles zu. Seit Jahren sorgen diese Teufel für Unruhe. Man muss sie ausmerzen – mit Stumpf und Stiel. - Gib mir noch einen, Joe.« Der Bursche schickte sein Brandyglas auf die Reise. Es schlitterte über den Tresen und der Keeper fing es geschickt auf.
»Man darf nicht alles glauben, was die Zeitungen so schreiben«, gab Whitlock zu bedenken. »Diese Schmierfinken machen oftmals aus der Mücke einen Elefanten.«
»Du bist wohl ein Freund dieser roten Parasiten?«, fragte der Mann, dem der Keeper jetzt wieder ein gefülltes Glas hinschob.
»Das hat nichts mit meiner Einstellung zu den Rothäuten zu tun«, versetzte Whitlock. »Ich meine nur, dass man dem, was per Gazette verbreitet wird, nicht immer glauben darf. Die Apachen sind besser als ihr Ruf.«
Draußen rollte ein Fuhrwerk mit einem Pferd im Gespann vorbei. Auf dem Wagenbock saß ein Bursche in typischer Weidereiterkleidung. Zwei Reiter begleiteten ihn. Sie zogen am Frontfenster vorbei und verschwanden aus dem Blickfeld der Männer im Saloon.
»Das waren Bar-H-Reiter«, sagte der Keeper. »Sie waren schon einmal hier.«
»Bar-H?«, kam es fragend von Whitlock.
»So nennt Jack Halloway die Ranch, die er am Pecos aufbauen will«, erklärte Joe, der Keeper.
Whitlock trank sein Bier aus, zahlte und verließ den Saloon. Er stapfte durch den knöcheltiefen Staub auf der Main Street. Das Fuhrwerk von der Bar-H hatte beim Store angehalten. Allan Welbys Gehilfe war gerade dabei, einen Sack mit Mehl auf Whitlocks Wagen zu laden. Die drei Cowboys standen auf dem Gehsteig. Die beiden Reitpferde hatten sie am Hitchrack angeleint. Das Tier vor dem Fuhrwerk peitschte mit dem Schweif.
Der Gehilfe Welbys machte kehrt und verschwand im Store. Die Cowboys schauten Whitlock entgegen. Ihre Blicke waren nicht freundlich. Whitlock nickte ihnen zu und ging in den Store. Die Weidereiter folgten ihm.
Whitlock bezahlte seine Rechnung, dann sagte er mit klarer, deutlicher Stimme: »Können Sie für mich Stacheldraht bestellen, Mr. Welby.«
»Wie viele Yards brauchen Sie?«
»Ungefähr achthundert.«
»Eine Menge Zeug.«
»Wozu brauchst du denn den Stacheldraht?«, fragte einer der Cowboys.
»Um meine Felder und Äcker vor den Rindern der Bar-H zu schützen.«
»Das wird Big Jack aber gar nicht gefallen«, dehnte der Cowboy.
»Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen«, erwiderte Whitlock.
*
Mit einem schweren Vorschlaghammer schlug Tyler Whitlock die Zaunpfähle in den harten Boden. Auf dem Wagen lagen einige Rollen Stacheldraht. Immer wenn er einen Pfahl in den Boden geschlagen hatte, spannte Whitlock den Draht und nagelte ihn fest. Er begrenzte sein Land nach Osten mit dem Drahtzaun.
Es war heiß. Der Mann schwitzte. Stechmücken setzten ihm zu. Das Pferd stand im Geschirr und scharrte ab und zu mit dem Huf. Die Vögel zwitscherten. Plötzlich aber glaubte Tyler Whitlock ein fernes Rumoren zu vernehmen, das sich in die Geräusche mischte, die ihn umgaben. Er drehte das Ohr nach Osten, senkte die Hände, die den schweren Hammer hielten, und lauschte. Er identifizierte das Geräusch als Hufschläge. Sie näherten sich. Und bald war das Getrappel deutlich zu vernehmen.
Tyler Whitlock ging zum Wagen, legte den Hammer darauf, griff nach der Winchester, die da lag und repetierte. Und dann blickte er in die Richtung, aus der sich die Hufschläge näherten. Schon wenig später trieben sechs Reiter ihre Pferde auf den Kamm des Hügels, der Whitlocks Sicht begrenzte. Sie zügelten und starrten zu ihm herunter. Schließlich aber ritten sie weiter und kamen die Hügelflanke herunter. Zwei Pferdelängen vor Tyler Whitlock hielten sie an. Die Schatten ihrer Hutkrempen fielen in ihre Gesichter. Die Pferde stampften und prusteten. Gebissketten klirrten. Einer der Reiter sagte: »Ich bin Ethan Russell und Vormann auf der Bar-H.«
»Sind Sie gekommen, um mir einen nachbarschaftlichen Freundschaftsbesuch abzustatten?«, fragte Tyler Whitlock. Er hatte sich auf Verdruss eingestellt. Mit beiden Händen hielt er das Gewehr schräg vor seiner Brust. In seinem Gesicht zuckte kein Muskel. Seine Augen blickten hart.
Russell legte beide Hände auf das Sattelhorn, streckte die Arme durch und verlagerte das Gewicht seines Oberkörpers darauf. »Sicher nicht, Stewart. Es gefällt uns nicht, dass du einen Zaun ziehst. Die Rinder der Bar-H werden dadurch vom Pecos abgeschnitten. Sie brauchen das Wasser aber.«
»Tut mir Leid«, versetzte Whitlock. »Aber ich werde Mais und Weizen anbauen, und die Rinder der Bar-H würden meine Felder verwüsten. Ihr müsst eben Brunnen und Bewässerungsanlagen anlegen. Es gibt da eine Reihe von Möglichkeiten. Man könnte sogar über jeweils einen Korridor an der Nord- und Südgrenze meines Landes reden. Allerdings müsste die Bar-H Nutzungsentgelt bezahlen. Aber das dürfte wohl nicht die große Rolle spielen.«
»Doch, das spielt eine Rolle, Stewart. Ich warne dich. Wenn wir wieder kommen und der Zaun ist nicht weg, reißen wir ihn nieder. Du beschneidest die freie Weide.«
»Das ist Siedlungsland. Das Gesetz steht auf meiner Seite. Wenn ihr Hand an diesen Zaun legt, werde ich Anzeige beim Sheriff in Roswell erstatten. Bei Verstößen gegen das Heimstättengesetz ist sogar der U.S. Marshal zuständig.«
Russell winkte verächtlich ab. »Vor dem Gesetz fürchtet sich Big Jack nicht. Er will in diesem Landstrich Rinder züchten. Und die brauchen Wasser. Du bist drauf und dran, zu verhindern, dass sie zum Wasser gelangen. Das nehmen wir nicht hin.«
»Ist das eine Drohung?«
»Zunächst nur Warnung. Reiß den Zaun wieder ab, Stewart. Sonst machen wir es.«
»Ihr könnt mich nicht einschüchtern.«
Der Vormann der Bar-H zog sein Pferd herum. Wortlos ritt er an. Seine Begleiter folgten ihm. Whitlock blickte ihnen hinterher, bis er sie nicht mehr sehen konnte, weil sie über den Hügel aus seinem Blickfeld verschwanden. Dann legte er das Gewehr auf den Wagen, griff nach dem Hammer und setzte seine Arbeit fort. Er war nicht bereit, klein beizugeben.
Er arbeitete bis zum Sonnenuntergang. Dann fuhr er zu seiner Farm. Das Wohnhaus war ziemlich fertig. Es gab einige Stapel Bretter und Balken. Vom Stall stand das Gerüst. Es musste noch mit Brettern verkleidet werden.
Tyler Whitlock war stolz auf das, was er bisher geschaffen hatte. Das Haus war flach, es gab drei Räume, in der Küche hatte er aus Feldsteinen einen Ofen gemauert. Mobiliar fehlte noch. Bänke, einen Tisch, ein paar Regale und ein Bett wollte er erst zimmern, wenn die Gebäude fertig waren. Irgendwann, wenn die Farm Gewinne abwarf, würde er sich richtige Möbel kaufen.
Whitlock dachte an Jane Russel. Er hatte sie vor den Indianern gerettet und sich in sie verliebt. Sie hatte seine Liebe erwidert. Dann war sie von den Apachen verschleppt worden und lebte zwei Jahre bei ihnen. Jetzt befand sie sich wieder in Tularosa. Und sie hatte sich auf das Drängen ihres Vaters mit einem Captain namens Donald Bailey verlobt.
Du liebst sie immer noch!, durchfuhr es Whitlock. Für wen sonst baust du diese Farm hier auf? Es war ihr Traum, am Pecos zu siedeln, eine Familie zu gründen, in Ruhe und Frieden zu leben.
Er verdrängte diese Gedanken in den hintersten Winkel seines Bewusstseins. Jane war für ihn verloren. Er gab sich keinen Illusionen hin. Er musste hier unter falschem Namen leben, weil er vom Gesetz gesucht wurde. Müde Resignation wollte ihn erfassen. Du jagst einem Traum hinterher, der niemals Realität werden wird, sinnierte er. Eines Tages wird deine wahre Identität bekannt, und dann musst du entweder fliehen und alles aufgeben, oder ins Gefängnis gehen.
Es waren keine erfreulichen Gedanken, die ihn beschäftigten. An ihrem Ende stand etwas Dunkles, Unheilvolles. Zugleich erwachte in ihm aber auch die Bereitschaft, für die Durchsetzung seiner Wünsche und Pläne notfalls zu kämpfen.
Whitlock begann, das Pferd auszuspannen, dann holte er seinen Sattel aus dem Haus und legte ihn dem Tier auf. Zehn Minuten später zog er nach Süden. Er ritt etwa eine Meile, dann stieß er auf die Farm von Calem Sounders. Die Sonne war im Untergehen begriffen. Glutrot stand sie über dem hügeligen Horizont. Wolkenbänke schoben sich davor und erglühten.
Sounders lebte hier mit seiner Frau und zwei Söhnen. Sie waren vor über einem Jahr hier angekommen. Sounders hatte ein Farmhaus, einen Stall, eine Scheune und zwei Schuppen erbaut. Außerdem gab es einen Pferch, in dem Schafe und Ziege weideten und einen Corral, in dem sich eine Milchkuh befand.
Sounders trat aus dem Haus. Er hatte den Ankömmling von Weitem erkannt und trug daher keine Waffe. Sounders war ein großer Mann, der über breite Schultern verfügte. Seine Haare waren kurz geschoren. Seine Hände erinnerten an die Pranken eines Grizzlys.
»Hallo, Nachbar«, empfing er Whitlock, der das Pferd angehalten hatte.
Whitlock hob die Rechte und erwiderte den Gruß, dann sagte er: »Ich hatte unerfreulichen Besuch. Jack Halloway schickte mir ein halbes Dutzend Leute. Sie wollen mir verbieten, einen Zaun zu ziehen, der mein Land von dem Weidegebiet abgrenzt, das die Bar-H für sich beansprucht. Waren Sie bei dir auch?«
Sounders schüttelte den Kopf. »Nein. Allerdings habe ich noch nicht angefangen, einen Zaun zu ziehen. Sicher wird Halloway auch mir seine Leute schicken, wenn ich damit beginne.«
»Der Vormann der Ranch heißt Ethan Russell. Er hat gedroht, den Zaun wieder einzureißen. Es wird Verdruss geben.«
»Wir Siedler sollten uns zusammenschließen«, meinte Sounders. »Außerdem haben wir Anspruch darauf, dass uns der Sheriff schützt. Wir haben das Recht auf unserer Seite.«
»Sich zusammenzuschließen ist nicht so einfach«, knurrte Whitlock. »Jeder von uns hat eine Menge Arbeit. Ich habe nicht die Zeit, um darauf zu warten, dass Halloway seine Sattelwölfe schickt. Keiner von uns hat diese Zeit.«
»Wir müssen den Sheriff einschalten«, sagte Sounders und unterstrich seine Worte mit einer abschließenden Geste seiner Rechten.
Whitlock nickte. »Ich reite morgen nach Roswell und erstatte Anzeige. Dir rate ich dasselbe zu tun, falls Halloway seine Leute auch zu dir schickt.«
»Mache ich. Der Sheriff muss Halloway zur Räson rufen.«
Whitlock tippte an die Krempe seines Hutes, zog das Pferd herum und ritt den Weg zurück, den er gekommen war. Er zog aber an seiner Farm vorbei und suchte Nat Berger auf, der nördlich von ihm siedelte. Die Abenddämmerung hüllte das Land ein. Die Sonne war versunken. Nur noch ein roter Streifen über dem westlichen Horizont erinnerte an den Sonnenuntergang.
Nat Berger war ein schmächtiger Bursche. Auch er war verheiratet, er und seine Frau hatten drei Kinder. Zwei Töchter und einen Sohn. Berger schaute grimmig drein, hörte schweigend zu, was Whitlock zu berichten hatte, dann sagte er: »Bei mir waren sie auch. Denn auch ich habe angefangen, einen Zaun zu ziehen. Wenn ich geahnt hätte, dass ein Viehzüchter das Regierungsland östlich des Pecos für sich in Anspruch nimmt, hätte ich niemals hier gesiedelt. Aber jetzt ist es zu spät. Ich habe viel zu viel Geld und Schweiß in dieses Stück Land investiert.«
»Ich reite morgen nach Roswell und erstatte Anzeige beim Sheriff. Wenn du willst, können wir gemeinsam reiten.«
»In Ordnung. Hole mich morgen früh ab. Der Sheriff muss unsere Interessen vertreten.«
*
Es war finster. Wolken zogen am Himmel dahin und verbargen das Mond- und Sternenlicht. Die Menschen auf der Ranch am Santa Cruz River schliefen. Es handelte sich um eine Pferderanch. Die Pferde ruhten in drei Corrals. Es waren etwa fünfzig Tiere. John Segal verkaufte seine Pferde hauptsächlich an die Armee.
Ein Rudel Reiter verhielt hundert Yards von der Ranch entfernt. Sie waren auf dem Weg nach Süden. Langsam ritten sie weiter. Ein Pferd wieherte. Auf der Ranch ging Licht an. Dann trat ein Mann, der eine Laterne in der rechten Hand hielt, auf den Vorbau. Lichtschein huschte auseinander, endete aber schon nach wenigen Yards. In der Linken hielt der Mann einen Revolver. Er hörte das Pochen der Hufe und gab einen Schuss in die Luft ab. Gleich darauf ertönte es aus einem anderen Gebäude: »Was ist los? Wer ballert mitten in der Nacht herum?«
»Es kommen Reiter!«, rief Segal laut. »Nehmt die Gewehre zur Hand und postiert euch an den Fenstern.«
Der Rancher verschwand im Haus. Die Tür ging zu. Es war wieder stockfinster.
Das Rudel hatte angehalten, nachdem der Schuss gefallen war.
»Sie haben uns bemerkt«, sagte einer der Kerle auf Spanisch.
»Absitzen«, sagte ein anderer. »Wir gehen zu Fuß weiter. Adelante!«
»Caramba, Paolo! Wahrscheinlich warten die Gringos nur darauf, dass wir auftauchen. Ich bin dafür, dass wir einen Bogen um die Ranch machen und zusehen, nach Mexiko zu kommen.«
In den Corrals hatten sich die Pferde erhoben. Verworrene Geräusche erfüllten die Nacht. Die drei Cowboys im Bunkhouse postierten sich mit ihren Gewehren an den Fenstern.
John Segal hatte im Haupthaus Stellung bezogen. Seine Hände hielten jetzt ein Gewehr. Eine Patrone befand sich in der Kammer.
»Maldito, Pepe! Machst du dich in die Hosen? Muss ich annehmen, dass du ein erbärmlicher Feigling bist?«
»Por Dios, nein. Aber...«
»Wir nehmen die Pferde mit. Damit machen wir ein Vermögen. José, Benito, schleicht euch zu den Corrals, öffnet die Gatter und treibt die Gäule heraus.«
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2023
- ISBN (ePUB)
- 9783738971965
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2023 (Februar)
- Schlagworte
- chiricahua ausgestoßen pete hackett western edition