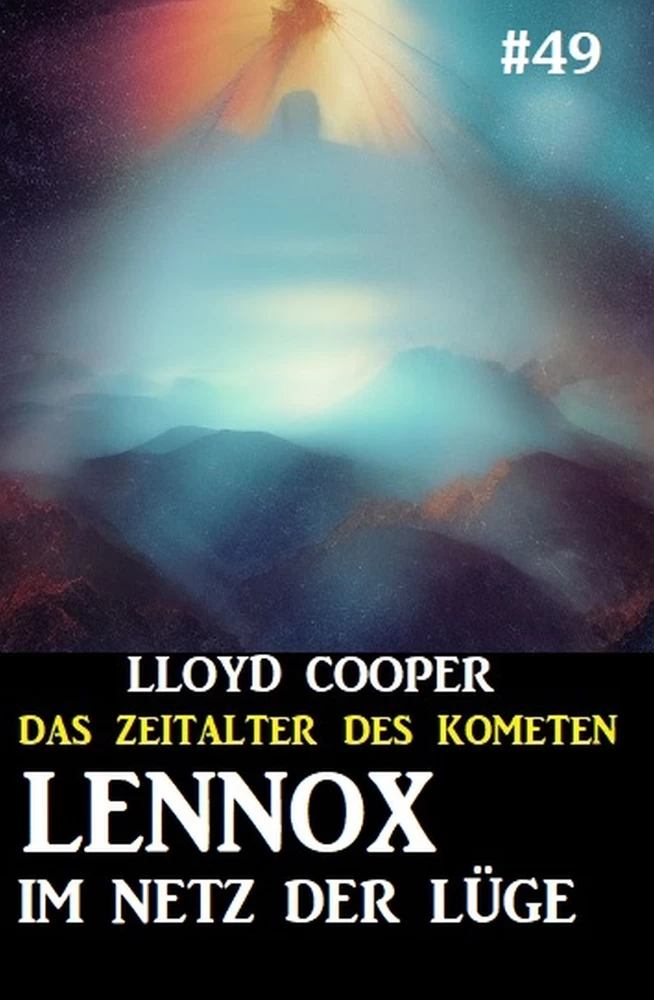Zusammenfassung
Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen.
In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf …
Jacob Blythe beherrscht die Expedition mit blanker Gewalt, so dass sich eine Meuterei durch Barbaren und Soldaten gleichermaßen anbahnt. Selbst in Gedanken verfolgt Blythe seine Rache an Tim Lennox und ist überzeugt davon, dass sich Lennox in der Nähe befindet. Sollte ihm endlich seine Rache gelingen?
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Lennox im Netz der Lüge: Das Zeitalter des Kometen #49
von Lloyd Cooper
Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen.
In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf …
Jacob Blythe beherrscht die Expedition mit blanker Gewalt, so dass sich eine Meuterei durch Barbaren und Soldaten gleichermaßen anbahnt. Selbst in Gedanken verfolgt Blythe seine Rache an Tim Lennox und ist überzeugt davon, dass sich Lennox in der Nähe befindet. Sollte ihm endlich seine Rache gelingen?
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
1
Helena Lewis wusste nur selten, wo sie war.
Manchmal, tief in der Nacht, wenn die Geräusche der Expedition verstummten und ihre eigenen Gedanken langsam zur Ruhe kamen, sah sie die Höhle vor sich, den Ort, an dem es geschehen war. Dann begriff Helena für kurze Momente, was sie verloren hatte, aber bevor sie ihre Angst und ihr Entsetzen hinausschreien konnte, kehrte das Vergessen stets zurück.
Und so zog sie mit der Expedition weiter durch das leere, seltsame Land. Sie überstand Kannibalenangriffe, Raubtiere und Giftpflanzen, ohne recht zu wissen, was um sie herum geschah. Alles glitt an ihr vorbei wie die Landschaft, wenn sie auf dem Dach eines Panzers saß.
Bis zu dieser Nacht, als Helena Lewis in ihrem Zelt die Augen öffnete und zum ersten Mal seit Monaten genau wusste, wo sie war – und was sie zu tun hatte.
Ich bin ein Gefäß , dachte Helena, das die Botschaft überbringt. Dies ist meine Aufgabe und der Sinn meiner Reise.
Die Klarheit ihrer Gedanken war erschreckend. Mit plötzlicher Schärfe nahm sie alles wahr, was um sie herum in der Dunkelheit geschah. Sie hörte die Brise, die über das Zelt hinwegstrich und sich in den Blättern der Bäume verfing. Wellen rollten mit leisem Rauschen ans Ufer; Kieselsteine schlugen klickend gegeneinander. Das Holz des heruntergebrannten Lagerfeuers knackte.
Helena setzte sich auf. Ihre Finger fanden den Griff des Skalpells, das sie einem Instinkt folgend am Abend bereitgelegt hatte. Die Klinge war spitz und so scharf, dass sie mühelos durch den groben Zeltstoff glitt. Kühle Nachtluft drang an Helenas Körper, als sie durch den Riss kletterte und geduckt stehen blieb.
In der Dunkelheit bestand die Umgebung aus nicht mehr als unförmigen schwarzen Gebilden, formlos wie die Tonmasse eines Bildhauers. Nur in den wenigen Momenten, wenn die Wolken den Mond freigaben und sein Licht das Ufer erhellte, nahmen sie Gestalt an und wurden zu Panzern, Bäumen und Zelten.
Helena sah zwischen den Gebilden hindurch. Wasser perlte von ihren nackten Füßen. Es hatte den ganzen Tag geregnet, und die Erde war weich und nass. Sie hörte leise Unterhaltungen in den Zelten und das Schnarchen schlafender Männer. Bei diesem Wetter, das einen Regenschauer nach dem anderen über den See trieb, schlief niemand freiwillig unter den Sternen. Deshalb hatte Helena diese Nacht für die Vollendung ihrer Aufgabe gewählt.
Sie löste sich aus den Schatten der Zelte und schlich an den beiden Panzern vorbei, die den Eingang des Lagers flankierten. Seit die Expedition vor einigen Monaten auf kriegerische Kannibalen gestoßen war, hatte Captain Crow doppelte Bewachung angeordnet und so patrouillierten auch jetzt zwei Männer am Ufer entlang. Helena hörte das Knirschen der Kiesel unter ihren Stiefeln. Sie schlug einen Bogen, der am Lagerfeuer vorbeiführte, um ihnen nicht zu begegnen. Das Skalpell lag warm in ihrer Hand.
Die geschwärzten Holzstämme des Feuers schienen ihr mit rotglühenden Augen nachzustarren, als Helena es hinter sich ließ und an den letzten Bäumen vorbei auf das Seeufer zuging.
„ Whadda …“
Die Stimme war rau und dunkel. Eine Hand schloss sich um ihren nackten Arm. Helena fuhr herum, holte mit der freien Hand aus und zog das Skalpell mit einer lässig wirkenden Bewegung an der dunklen Gestalt vorbei. Sie spürte einen Bart, der über ihren Handrücken strich, dann den Widerstand, als Muskeln, Sehnen und mit einem knirschenden Geräusch der Kehlkopf des Mannes von der Klinge durchtrennt wurden.
Die Finger lösten sich von ihrem Arm. Heißes Blut schoss Helena entgegen, spritzte über ihren Körper. Der Mann brach ohne einen Laut in die Knie. Im zurückkehrenden Mondlicht wirkten Bart und Gesicht grau. Seine Hände griffen nach dem Schnitt in seinem Hals, pressten sich darauf in einem letzten verzweifelten Versuch das Ende aufzuhalten. Helena sah den dreckigen Gips an einer Hand und dachte an das Gesicht des jungen Barbaren, der sich vor zehn Tagen beim Holzfällen den Daumen gebrochen hatte. Es war ein nettes Gesicht gewesen, voller Abenteuerlust und Neugier. Jetzt war es so verzerrt, dass sie es kaum noch erkennen konnte.
Helena wandte sich ab. Sie wusste, dass sein Leben nicht das einzige war, das in dieser Nacht ein Ende finden würde, aber im Gegensatz zu ihm hatte sie ihre Aufgabe fast vollendet. Stolz und Zufriedenheit erfüllten sie, wenn sie daran dachte.
Hinter ihr schlug der sterbende Körper ins Gras. Helena ließ ihn zurück, beschleunigte ihre Schritte, in der Furcht, jemand könne den Mord bemerkt haben. Sie spürte Sand und Steine unter ihren Füßen, dann die ersten Wellen, die ihre Knöchel umspülten. Der See lag vor ihr, eine schwarze Fläche, so endlos wie der Himmel, mit dem er sich am Horizont verband.
Helena betrat die Schwärze, ging Schritt für Schritt tiefer hinein. Das Wasser war kalt. Algen bedeckten die Steine, und mehr als einmal glitt sie darauf aus, bis endlich der Boden unter ihr verschwand und sie zu schwimmen begann.
Als die leuchtend grünen Kristallsplitter vor ihr auftauchten, fühlte Helena keine Angst, nur tiefe Befriedigung, am Ziel angekommen zu sein. Sie sah in die Augen der Rochen, die mit ihren breiten Flossen durch das Wasser zu schweben schienen und sie wie eine Eskorte umgaben. Einer von ihnen schwamm näher heran. Wellen schwappten über Helena hinweg. Sie schluckte Wasser und hustete.
Die Flosse des Rochens legte sich auf ihren Kopf, drückte sie nach unten. Wellen schlugen über ihr zusammen. Ihre Hände stießen gegen raue, kühle Haut und unnachgiebige Muskeln. Immer tiefer wurde sie heruntergezogen, hinein in die lichtlose Finsternis des Kratersees.
Helena fürchtete sich nicht. Die Rochen berührten sie jetzt von allen Seiten und aus irgendeinem Grund, den sie selbst nicht verstand, konnte sie trotz des Wassers atmen. Eine Art Luftblase schien sie zu umgeben. Ein Geruch nach Salz und Fisch lag auf ihrer Zunge.
Sie hatte die Augen geschlossen, aber als das grüne Leuchten begann, drang es taghell zu ihr durch. Helena spürte die Strahlen wie Finger in ihrem Gehirn. Sie berührten, untersuchten und verschoben, bis sie schließlich einen Bereich entdeckten, der seit vielen Monaten verschlossen war. Mühelos bohrten sich die Finger hinein – und Helena sah:
Er ist ein kleiner Junge, gerade mal neun Jahre alt. Seine Knöchel sind blutig, aber er schlägt weiter auf Frankie ein. Frankie wird nach diesem Nachmittag auf einem Auge blind sein. Es ist seine eigene Schuld, denkt der kleine Junge, den alle Jazz nennen. Frankie hätte ihn nicht herausfordern dürfen, nicht hier auf dem Schulhof, wo ihn jeder respektieren muss. Darum kämpft er Tag für Tag. Es geht um Respekt.
Er ist fünfzehn Jahre alt und schlecht in der Schule. Er will zur Armee, aber die wird ihn nur mit Abschluss nehmen. Jazz hat keine Angst davor zu versagen. Gestern Abend hat er die Frau seines Mathelehrers Mr. Bennett zusammengeschlagen. Er wird Jazz nicht durchfallen lassen. Schließlich hat er noch zwei Töchter.
Die Bilder wurden schneller. Fasziniert beobachtete Helena die Erinnerungen von Lieutenant Jazz Garrett, der als stellvertretender Expeditionsleiter auf die Reise gegangen und am Nordpol von dem gleichen Wesen getötet worden war, das sie zum Gefäß seiner Botschaft gemacht hatte.
Er ist zweiundzwanzig und unbesiegbar. Jeder Auftrag gelingt und seine Vorgesetzten schätzen seinen Mut und seine Härte. Doch dann taucht er auf, Timothy Lennox, der Mann, der ihm die Zähne ausschlägt. Jetzt respektiert niemand mehr Toothless Jazz, wie sie ihn hinter seinem Rücken nennen. Sie lachen über ihn. Jazz hasst Lennox mehr als jeden anderen Menschen in seinem Leben.
Er ist dreiundzwanzig und alles, was er anfasst, misslingt. Lennox entkommt ihm immer wieder und selbst Jed Stuart, der Jazz wegen eines getöteten Barbaren melden wollte und deshalb zur Teilnahme an der Expedition gezwungen wurde, überlebt alle Zwischenfälle. Jazz hasst auch ihn, weil er lange Wörter benutzt, die man nicht versteht und weil Stuart noch lebt, während er tot ist.
In den letzten Sekunden seines Lebens, als das Ungeheuer unter dem Nordpol ihn umbringt und seine Erinnerungen schluckt, denkt Jazz an die Menschen, die er hätte töten können und an die Leere in sich selbst, die verschwunden wäre, hätte man ihn doch nur respektiert.
Die Bilder verschwanden aus Helenas Geist, wurden aufgesogen von dem grünen Leuchten hinter ihren Augenlidern. Für einen Moment glaubte sie, ihre Aufgabe wäre erfüllt, doch dann tauchte etwas anderes in ihrem Geist auf.
Es war fremd, so fremd, dass sie seine Form nicht erkennen und seine Gedanken nicht verstehen konnte. Trotzdem erkannte sie es wieder als das Ding, das ihr Bewusstsein beherrscht und sie an diesen Ort geführt hatte. Das grüne Leuchten legte sich um die Botschaft, die es hinterlassen hatte und nahm sie auf. Helena spürte die Einsamkeit des Wesens unter dem Nordpol, ebenso wie die Verwandtschaft, die das Wesen im grünen Leuchten zu ihm empfand. Sie waren Brüder …
Das Leuchten verschwand so schnell, wie es gekommen war. Grüne Flecken tanzten vor Helenas Augen wie Funken eines ersterbenden Feuers. Die Rochen lösten sich und verließen sie. Helenas Geist war vollkommen ruhig. Sie hatte ihre Aufgabe erfüllt und die Botschaften überbracht. Der Sinn ihres Lebens war vollendet.
So kämpfte sie auch nicht, als die Luftblase zusammenfiel und ihr eiskaltes Wasser in Mund und Nase drang. Stumm und ergeben sank sie in die Schwärze hinein, dem Tod entgegen.
2
Tagebucheintrag, Dr. Jed Stuart, 8.Januar 2519
„ Stalin, das ist der Name, den ich dem Yakk gegeben habe, das seit einigen Tagen mit Jacob Blythe in einen Wettstreit getreten ist, wer mir die größten Unannehmlichkeiten bereiten kann. Da wir uns in Russland befinden und es sich bei diesem Yakk um die verschlagenste und niederträchtigste Kreatur handelt, dem ich bisher im Tierreich begegnet bin, erscheint mir der Name angemessen.
Aber ich greife vor.
Fast eine Woche ist es her, seit wir das Ziel unserer Reise erreicht haben. Auf den letzten vielleicht fünfhundert Kilometern hatten wir noch einmal sehr viel Zeit verloren, da die Wälder dichter wurden und die Panzer förmlich hindurchgezwängt werden mussten. Blythe, unser verhasster, geistesgestörter Tyrann, tobte ohne Unterlass, so dass selbst Lynne Crow, seine Geliebte und unsere Expeditionsleiterin, sich von ihm fernhielt. Ich mag sie nicht, aber verglichen mit Blythe ist Lynne eine Heilige.“
Jed setzte den Stift ab und lächelte. Er war sich sicher, dass Crow in ihrem Leben schon einige Vergleiche gehört hatte, aber das Wort Heilige dürfte wohl kaum darunter gewesen sein. Trotzdem hatte er es hauptsächlich ihr zu verdanken, dass er nach dem Zwischenfall vor einigen Monaten noch am Leben war. Der Gedanke brachte Erinnerungen zurück: Blythe, der ihm gegenüber auf dem Floß hockt, das Kinn voller Blut. Eine Hand ist unter seine gebrochene Nase gepresst, mit der anderen tastet er nach dem Driller. Jed spürt das Pochen in seiner eigenen Hand und sieht die aufgeplatzten Knöchel. Er fühlt Scham und Stolz, Scham, weil die Wut, die er längst besiegt glaubte, zurückgekehrt ist, Stolz, weil sie den Richtigen getroffen hat. Er hört Lynne auf Blythe einreden, ihm klar machen, dass sie jemanden brauchen, der die Barbaren versteht und neue Sprachen mit solcher Leichtigkeit erlernt. Er sieht die Mündung des Drillers. Eine Minute oder eine Ewigkeit verstreicht, dann senkt Blythe die Waffe und starrt ihn aus zuschwellenden Augen an. Jed zuckt unter dem Hass in seinem Blick zusammen, aber zum ersten Mal in seinem Leben sieht er nicht weg, sondern starrt zurück, bis sich Blythe abwendet.
Er zog die Kerze näher an sein Tagebuch heran. Das Licht der Flamme flackerte über Seiten und warf bizarre, tanzende Schatten auf die Zeltwand. Neben ihm seufzte Majela leise im Schlaf. Unter dem viel zu großen Fell waren nur ein paar Rastalocken und ein Stück ihres dunklen Halses zu sehen. Er hatte sie gerettet in dieser Nacht, hatte sich einem ganzen Kannibalenstamm entgegengestellt, um sie zu befreien. Das Erlebte hatte ihn grundlegend verändert, das war Jed längst klar geworden.
Ich habe immer noch Angst, dachte er, den Blick auf Majela gerichtet, mehr als je zuvor.
Monatelang war er jeden Morgen mit der Angst erwacht, den Abend nicht mehr zu erleben. Jetzt erwachte er jeden Morgen mit der Angst, sie könne den Abend nicht mehr erleben. Er wusste, dass er seinen Beschützerinstinkt übertrieb und sie einengte, aber die Furcht, Majela ein weiteres, endgültiges Mal zu verlieren, war allgegenwärtig. Er konnte einfach nicht aus seiner Haut.
Jed rief seine Gedanken zur Ordnung und setzte den Stift wieder an.
„ Aber ich wollte nicht über Lynne schreiben, sondern über Stalin. Ungefähr eine Woche, bevor wir den Kratersee erreichten, begegnete uns ein Viehhändler mit einer Herde von großen zottigen Tieren, die er als Yakks bezeichnete. Er bemerkte die Probleme, die wir mit den Panzern hatten, und bot uns geschäftstüchtig seine Herde an. Sie graste auf einer nahegelegenen Lichtung, und die Tiere wirkten gutmütig und sanft.
Auf die meisten traf diese Einschätzung auch zu.
Bevor ich fortfahre, muss ich eines klarstellen. Bis zu dieser Reise habe ich fast mein ganzes Leben in einem Bunker in Washington verbracht. Bücher waren meine Freunde und Lehrmeister. Sie brachten mir alles bei, was ich je zu benötigen glaubte. Dazu zählten Sprachen und Geschichte, das Wissen über Kulturen und Zivilisationen, ob vergangen oder gegenwärtig. Nur das Wissen über Tiere gehörte nicht dazu.
Das erklärt vielleicht meinen Irrtum.
Der Viehhändler überredete Lynne, ihm einen Großteil der Herde abzukaufen und jeder von uns durfte sich ein Tier aussuchen. Während Pieroo und andere Gebiss und Hufe der Tiere untersuchten und sogar die WCA-Soldaten gewisse Kenntnisse zeigten, war ich ratlos – und zu stolz, das zuzugeben. Ich sah mich um und entdeckte schließlich ein Tier, das am Rande der Lichtung stand, weit weg vom Rest der Herde. Es wirkte einsam, erschien mir wie ein verstoßener Außenseiter und ich fühlte so etwas wie Seelenverwandtschaft zu ihm (ich Trottel!). Also entschied ich mich für dieses Yakk, ein Entschluss, der von dem Viehhändler übrigens mit deutlichem Enthusiasmus begrüßt wurde. Allein das hätte mich misstrauisch machen müssen.
Zwei Tage ging alles gut. Das Yakk reagierte auf meine ungeschickten Kommandos und trabte gutmütig hinter den anderen Tieren her, die jedoch immer noch einen großen Abstand zu ihm hielten. Aus gutem Grund, wie sich am Morgen des dritten Tages herausstellte. Es war der Tag, an dem das Yakk seinen Namen erhielt und an dem es zum ersten Mal versuchte mich umzubringen.
Normalerweise wache ich noch vor Tagesanbruch auf und nutze die Ruhe, um in mein Tagebuch zu schreiben, doch an diesem Morgen verschlief ich. Majela weckte mich schließlich, als der Aufbruch nahte. Ich war noch nicht ganz wach, als ich dem Yakk das Zaumzeug anlegen wollte und es plötzlich den Kopf drehte. Seine Lippen waren hochgezogen, sein breites Maul aufgerissen. Ich wollte zurückspringen, doch seine Zähne schlossen sich um den Fellmantel, den ich übergezogen hatte. Es riss daran, schüttelte meinen Arm. Seine Kiefermuskeln wölbten sich unter dem Fell hervor. Etwas knirschte, und ich begriff, dass es das Zaumzeug war, das zwischen seinen Zähnen zermalmt wurde. Erst, als es mir gelang, den Mantel abzustreifen, ließ das Yakk los und spuckte seine Beute aus. Es grunzte, war sichtlich enttäuscht, dass es mir nicht den Arm abgerissen hatte. In seinen tückischen, wasserblauen Augen lag etwas Psychopathisches.
Bis zum Abend schnappte Stalin mehr als ein Dutzend Mal nach mir oder meinen Begleitern, schlug rund zwanzig Mal mit den Hinterbeinen aus, und versuchte uns mehrfach mit seinen viel zu langen Hörnern aufzuspießen. Danach beruhigte er sich ein wenig. Ich fragte die Männer, was mit dem Tier sei, aber sie wussten keine Antwort. Nur Tootooz, ein Fährtensucher aus den Wäldern Arkansas‘, sagte, er hätte von so etwas schon einmal gehört. Stalin, so behauptete er, sei ein heiliges Tier, das geschickt worden sei, um mich zu prüfen. Es sei eine große Ehre, auf diese Weise von den Göttern erwählt zu werden. Ich fragte ihn, ob er die Reittiere tauschen wolle, um diese Ehre selbst zu erfahren, aber er lehnte mit zahlreichen Ausreden ab. Es scheint so, als müssten das Yakk und ich noch eine Weile zusammenbleiben.
Mittlerweile beschränkt sich Stalin auf vier bis fünf Mordversuche am Tag. Sein neuester (und bisher leider auch erfolgreichster) Trick besteht darin, mich so lange in Sicherheit zu wiegen, bis ich im Sattel einnicke und er in aller Ruhe nach einem Ast suchen kann, der niedrig genug hängt, um mich von seinem Rücken zu fegen. Zweimal ist es ihm bereits gelungen, was peinlich genug ist. Schließlich bin ich ein Mensch mit einem hochentwickelten Gehirn, und er ist trotz aller Evolution und Mutation nicht mehr als eine langhaarige, übergroße Kuh. Und ich werde mich nicht noch einmal von einer Kuh austricksen lassen.“
Jed schloss das Buch und wickelte es sorgfältig in die wasserdichte Folie ein, bevor er es in einer Tasche verstaute. Die halb verheilte Platzwunde auf seiner Stirn juckte. Er widerstand dem Impuls sich zu kratzen und verschränkte die Arme hinter dem Kopf.
Draußen hörte er das sanfte Rauschen des Windes und das Glucksen der Wellen. Es war ein seltsames Gefühl, das Ziel der Reise erreicht zu haben und doch nichts zu finden. Der Kratersee sah aus wie jeder andere See. Jed wusste nicht genau, was er erwartet hatte, aber nach all den Entbehrungen, dem Leid und den Strapazen, hatte er geglaubt, etwas Wundervolles und Göttliches zu finden, so etwas wie den Heiligen Gral oder einen Jungbrunnen. Gefunden hatten sie jedoch nur Wasser, Wälder und einige intelligente, vierarmige Mutationen, die sich Rriba‘low nannten und friedlich als Fischer in kleinen Dörfern lebten. Unter normalen Umständen hätten ihr einzigartiges Äußeres und ihre Kultur Jed fasziniert, aber hier enttäuschten sie ihn beinahe, so als wären sie keine angemessene Belohnung für das, was hinter ihm lag.
Was wir hier entdeckt haben , dachte er, rechtfertigt keinen einzigen Toten. Wir …
„ Wachen! Hierher!“
Die Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Neben ihm setzte sich Majela mit einem Ruck auf und hatte ihren Driller bereits in der Hand, bevor sie die Augen öffnete.
„ Was ist passiert?“, fragte sie.
Jed öffnete den Reißverschluss des Zelteingangs. „Ich weiß es nicht“, sagte er, aber ein Teil von ihm ahnte, dass es auf diese sinnlosen Reise einen weiteren sinnlosen Tod gegeben hatte.
3
Schafe zählen.
Das war alles, was Tinnox mit geschlossenen Augen gemurmelt hatte, seine einzige Reaktion darauf, dass sich Marrela seit Stunden hin und her wälzte, ohne Schlaf zu finden. Jeden Trick hatte sie versucht, von Gebeten zu Morphee, dem Gott des Schlafes, über das Einreiben der Schläfen mit Asche, bis hin zu komplizierten Ritualmustern, die sie mit ihrer Schwertspitze in den weichen Waldboden gezogen hatte, um die Geister, die den Schlaf raubten, zu vertreiben.
Nichts hatte genützt. Und Tinnox, der Mann, der aus einer Zeit voller unglaublicher Wunder stammte und stählerne Vögel durch den Himmel steuern konnte, schien ebenfalls keine vernünftige Antwort auf ihr Problem zu haben.
Schafe zählen , dachte Marrela. Wenn ich wenigstens wüsste, was ein Schaf ist, dann könnte ich es vielleicht auch zählen.
Sie setzte sich auf und starrte in die Nacht. Neben ihr zog Tinnox die Decke über seine Schultern, ohne aufzuwachen. Es war kalt, und die Feuchtigkeit kroch unaufhaltsam durch die Felle und Schlafsäcke, mit denen sie sich zu schützen versuchten. Am Vorabend hatten sie eine Höhle gefunden, aber nicht benutzen können, weil der Raubtiergeruch darin frisch und stark war. Marrela hatte keine Ahnung, welches Wesen sich diesen Unterschlupf als Schlafstelle ausgesucht hatte, aber die Knochen am Eingang waren groß gewesen – größer als die eines Menschen.
Schließlich hatte sich die Gruppe für diesen Felsvorsprung entschieden, unter dem sie jetzt lagerten. Er gehörte zu den Ausläufern einer Bergkette, an deren Rand sie seit Tagen entlangzogen und ragte weit genug über den Boden hinaus, um ihnen allen und den Yakks Schutz zu gewähren. Nur ein Feuer konnten sie nicht entzünden. Das Holz war viel zu durchnässt. Und so verbrachten sie den Abend in gereizter Stimmung, aßen rohen Fisch und tranken kaltes Wasser. Tinnox machte einen Witz über etwas namens Sushi. Kaio lachte, sonst niemand.
Marrela sah zu ihm herüber. Er und Honeybutt teilten seit Kurzem den Schlafsack miteinander und lagen auch jetzt engumschlungen unter ihren Decken. Ein Stück entfernt lag Mr. Darker, das Gewehr wie immer griffbereit neben seinem Schlafsack. Er war der Anführer einer Rebellengruppe aus Waashton und so etwas wie Honeybutts Häuptling. Marrela hatte Eifersuchtsszenen zwischen ihm und Kaio befürchtet, aber die waren zum Glück ausgeblieben. Mr. Darker schien die Situation zu akzeptieren.
Marrela stand auf, warf sich ein Fell über und trat vor den Vorsprung. Am Horizont, wo das Wasser des Sees den Himmel berührte, zeichnete sich ein erster grauer Streifen ab. Es war eine gute Zeit zum Fischen, ruhig und einsam. Und da die Geister ihr den Schlaf nicht zurückgaben, konnte Marrela die frühe Stunde zumindest zur Vorbereitung des Frühstücks nutzen.
Das Yakk grunzte leise im Schlaf, als Marrela ihren Speer aus einer Schlaufe am Sattel zog. Es war nur ein einfacher Holzstab mit einem zugespitzten Ende, aber mehr benötigte sie für den Fischfang nicht – im Gegensatz zu Tinnox, Mr. Darker und Kaio, die ständig mit unterschiedlichen Angeln und Ködern experimentierten, jedoch nicht mehr fingen als Marrela mit ihrem Speer.
Der vom Regen noch aufgeweichte Boden war nass und kalt unter ihren Füßen, als sie auf das Ufer zuging. Der See schimmerte grau im ersten Licht des Tages; die Wellen rollten träge über den Sand.
Marrela machte gerade den ersten vorsichtigen Schritt in das unerwartet warme Wasser, als sie das Geräusch hörte. Es klang wie nasses Leder, das man über einen Stein schlägt, um es säubern, nur dumpfer und kräftiger.
Ich kenne dieses Geräusch , dachte Marrela mit einer bösen Vorahnung. Sie sah auf in den dunklen Himmel, wo Schatten wie Wolken entlang glitten. Ihre breiten Flossen holten weit aus, berührten sich mit einem dumpfen Klatschen an der Spitze und wurden machtvoll nach unten geführt, nur um erneut emporzusteigen.
„ Rochen.“ Marrela flüsterte das Wort, ohne es wirklich aussprechen zu wollen. Etwas an diesen Wesen mit ihren grünen Splittern in der Stirn und Augen, die so kalt wie das ewige Eis erschienen, war ihr zutiefst unheimlich.
Die Rochen, es waren mindestens fünf, flogen über Marrela hinweg. Im beginnenden Tageslicht waren sie beinahe unsichtbar. Sie folgte ihnen mit dem Blick, bis sie hinter den Bäumen verschwanden. Erst dann wagte Marrela sich aus dem Wasser.
Einen kurzen Moment zögerte sie, dann stieß sie den Speer in den Sand und lief zu einem der nahe stehenden Bäume. Vor zwei Tagen erst hatten sie in einem kleinen Dorf übernachtet, und Marrela hoffte, dass die Rochen nicht auf dem Weg dorthin zu einem Angriff waren. Niemand konnte ihnen etwas entgegensetzen, das hatte sie selbst erlebt.
Sie zog sich an einigen Ästen nach oben und kletterte weiter in den Baum hinein. Handgroße Käfer wichen ihr aus, etwas Rundes mit vielen Augen und noch mehr Beinen verschwand in einem Astloch. Marrela ignorierte es und bog kleinere Äste auseinander, bis sie über das Ufer hinwegblicken konnte.
Es war zu dunkel, um viel zu erkennen. Nur die Silhouetten der Bäume und die riesige Fläche des Sees hoben sich vor dem Himmel ab. Die Rochen waren verschwunden.
Marrela schickte ein stummes Gebet zu ihren Göttern. Die Fischer, die am Ufer lebten, waren einfache und freundliche Wesen, die es nicht verdient hatten, von solchen Ungeheuern bedroht zu werden. Sie hoffte, dass ihnen dieser graue Morgen kein Unglück bringen würde.
Eine Bewegung am Rande ihres Gesichtsfeldes ließ Marrela zusammenzucken. Überrascht drehte sie den Kopf und entdeckte eine Lichtsäule, die weit in den See hineinstieß. Eine zweite tauchte plötzlich daneben auf, strich zuerst über das Wasser und dann in den Wald hinein. Die Strahlen überkreuzten sich wie Schwerter, lösten sich voneinander und kreisten erneut über den See.
Marrela ließ sich für einen Moment von der Faszination dieses Schauspiels bannen. Sie hatte Lichtstrahlen noch nie in dieser Größe gesehen, kannte sie nur von den Stäben, die Tinnox manchmal bei sich trug und die er als Taschenlampen bezeichnete. Sicherlich konnte man Strahlen wie die, die jetzt über den See strichen, nicht in einer Tasche unterbringen. Also musste es eine andere Erklärung für dieses Geheimnis geben, und Marrela wusste genau, wer es ihr sagen konnte.
4
„ Wollen Sie Pommes dazu?“
„ Ja, große Pommes und extra Ketchup.“ Timothy Lennox starrte auf die Menükarte über dem Kopf des Verkäufers. „Und noch einen Neuner Chicken McNuggets, eine Apfeltasche und ein Eis … nein, zwei Eis. Eins mit Karamell- und eins mit Schokoladensauce … viel Schokoladensauce.“
„ Ist ja Ihr Magen.“ Der Verkäufer tippte alles in seine Kasse ein und drehte sich zur Küche um.
„ Zwei BigMac und einen Cheeseburger!“, rief er seinen Kollegen zu. Einer winkte knapp zurück. Im Hintergrund sang Tom Jones einen Song, dessen Titel Tim vergessen hatte.
“ Once upon a time I knew just what to do, but that was long before I met you.”
Tim verfolgte jede Bewegung des Verkäufers mit wachsendem Heißhunger. Der Geruch nach Frittenfett, gegrilltem Fleisch und Barbecuesauce brachte seinen Magen zum Knurren und ließ die Zeit bis zum ersten Bissen endlos erscheinen. Ungeduldig trommelten seine Finger auf der schmierigen Plastiktheke. Ein Teil seiner Gedanken spielte mit der Idee, über die Theke zu springen und sich die Taschen mit Cheeseburgern vollzustopfen, ein anderer beobachtete die randvolle Pommesschachtel, die aus der Hand des Verkäufers auf sein Tablett wanderte.
Tim griff danach, spürte die Wärme des Kartons in seiner Hand und die Salzkörner an seinen Fingerspitzen.
„ Tinnox?“
Er ignorierte die Stimme, konzentrierte sich voll und ganz auf die eine perfekt geformte Pommes in seiner Hand. Sie bewegte sich auf seinen Mund zu, hatte ihn fast erreicht. Er schloss die Augen und …
„ Tinnox!“
Tim fuhr hoch, erschrocken und desorientiert zugleich. Die helle angenehm anonyme Umgebung des Fast-Food-Restaurants wurde aus seinen Gedanken gerissen und durch einen dunklen Felsvorsprung und ein stinkendes, klammes Deerfell ersetzt.
„ Shit …“ Er rieb sich den Schlaf aus den Augen und sah Marrela an. Obwohl der Tag noch nicht richtig angebrochen war, wirkte seine Gefährtin wach und ein klein wenig besorgt.
„ Wassis los?“, fragte Tim. Seiner Zunge fiel es schwer, Worte zu bilden.
Marrela zeigte auf den See. „Da draußen sind Lichtstrahlen, aber sie sind zu groß für eine Tasche.“
„ Was?“ Der Satz klang so surreal, dass Tim für einen Moment glaubte noch zu träumen. Verwirrt ließ er sich von Marrela hochziehen, stolperte aus dem Schlafsack und blinzelte in den grauen Morgen. Hinter ihm raschelte es, als seine anderen Begleiter, durch das Gespräch geweckt, sich ebenfalls aufsetzten.
„ Gibt es ein Problem?“ Mr. Darkers Stimme klang gewohnt autoritär. Man hörte ihr nicht an, dass er geschlafen hatte.
Tim antwortete ihm nicht, starrte stattdessen hinaus auf den See und auf die Lichter, die darüberstrichen.
„ Du hast Recht“, sagte er langsam, als er Marrelas Assoziation verstand. „Sie sind viel zu groß für eine Tasche.“
Aus den Augenwinkeln bemerkte er, wie Kaio, der Cyborg, neben ihn trat. „Scheinwerfer. Jemand sucht den See ab.“
Tim dachte an die optischen Implantate, die sie schon oft vor Gefahren gewarnt hatten. „Kannst du mehr erkennen?“
Kaio schüttelte den Kopf. „Nein, es ist zu viel Nebel auf dem Wasser. Aber eine solche Technik passt zu den russischen Technos.“
„ Oder zum Weltrat.“
„ Das lässt sich nicht ausschließen.“
Tim folgte dem Licht der Suchscheinwerfer mit seinem Blick. Allein ihre Existenz bewies, dass die Expedition, die sich dahinter verbarg, wesentlich besser ausgerüstet war als seine eigene. Sich näher heranzuwagen, stellte ein schwer kalkulierbares Risiko dar.
Er spürte Marrelas Hand auf seinem Arm.
„ Wir sollten zu diesen Lichtern gehen“, sagte sie zu seiner Überraschung. Normalerweise appellierte sie in einem solchen Fall an seine Vernunft und riet von unüberlegten Abenteuern ab.
„ Warum?“, stellte Kaio die Frage, die auch ihm auf der Zunge lag.
Marrela hob die Schultern. „Wer solche Lichter hat, ist reich. Wenn es gute Menschen sind, werden sie ihren Reichtum mit uns teilen. Wenn es schlechte Menschen sind, können wir ihnen vielleicht etwas Reichtum wegnehmen.“
Tim grinste unwillkürlich und legte seinen Arm um ihre Schultern. „Ich mag die Art, wie du denkst. Was meinst du, Kaio?“
„ Ich finde, sie hat Recht. Wir sollten uns ansehen, wer dort ist und dann entscheiden, wie wir uns verhalten. Dann …“
„ Sind das Suchscheinwerfer?“, unterbrach ihn Mr. Darker, der jetzt zusammen mit Honeybutt unter dem Vorsprung hervorkam.
Tim drehte sich zu ihm um. „Ja, und wenn Sie und Miss Hardy ebenfalls einverstanden sind, werden wir herausfinden, wer dahintersteckt.“
Honeybutt nickte, während Darker erst einen Moment nachdachte, bevor er antwortete. „Das ist ein riskantes, aber notwendiges Unterfangen. Ich bin einverstanden.“
„ Gut.“ Marrela löste sich aus Tims Umarmung und ging zu dem großen, mutierten Fisch, den sie am Vorabend auf einen Stock aufgespießt hatte. Ein Fliegenschwarm schreckte auf, als sie mit der Hand darüber strich.
„ Aber zuerst sollten wir frühstücken“, fuhr sie fort und zog ihren Dolch hervor. „Wer möchte einen der beiden Köpfe?“
Tim wandte sich ab und dachte an warmes gelbes Neonlicht, Kaffee in Pappbechern mit Plastikdeckel und Tom Jones.
Once upon a time I knew just what to do, but that was long before I met you.
„ Okay”, sagte er dann resignierend. „Lass uns frühstücken …“
5
Sex mit Jacob war demütigend und brutal, aber auch leidenschaftlich, wild und ekstatisch. Mit einer einzigen Berührung konnte er Lynne beherrschen, mit einem einzigen Wort vernichten. Aber auch sie beherrschte ihn, gab ihm Hass, wenn er Liebe suchte, und Zärtlichkeit, wenn er nichts weiter wollte als Gewalt. Die Spannung zwischen ihnen erregte Lynne mehr als alles andere, was sie je gespürt hatte, doch manchmal, wenn sie im Kampf verschlungen dem Höhepunkt entgegenstrebten, ahnte sie, wie gefährlich Jacob wirklich war. Dann sah sie die Mordgier in seinen Augen, die er für Leidenschaft hielt.
Lynne wusste, dass Jacob wahnsinnig war. Es musste lange vor ihrer ersten Begegnung geschehen sein, vielleicht auf seiner Reise durch Europa. Vielleicht war es sogar der Komet, der nicht nur die Alte Welt, sondern auch seinen Verstand hinweggefegt hatte.
Sadismus, Paranoia, Größenwahn – das waren nur ein paar Spielarten des Wahnsinns, die Jacob offenbarte. Er folterte und tötete mit Genuss und litt unter unkontrollierten Anfällen der Raserei. In den letzten Monaten war er jedoch ruhiger geworden und berechenbarer, eine Veränderung, die Lynne auf ihren Einfluss zurückführte. Jacob hatte gelernt, die Kontrolle über sich zu behalten.
Deshalb war sie auch so besorgt, denn seit die Expedition den Kratersee erreicht hatte, kam er nachts nicht mehr in ihr Zelt. Stattdessen verbrachte er jeden wachen Moment mit der Suche nach einem Mann namens Timothy Lennox. Die Besessenheit, mit der Jacob Lennox hasste, war verstörend und Lynne war beinahe eifersüchtig darüber, dass ihr Geliebter seinem Feind soviel mehr Aufmerksamkeit gönnte als ihr. Aber an diesem Morgen stand ein anderes Problem im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit.
Sie hatte die gesamte Expedition antreten lassen, nachdem Sergeant Laramy ihr die Ermordung eines Barbaren gemeldet hatte, und dabei entdeckt, dass Helena Lewis verschwunden war. Das geschah zwar nicht zum ersten Mal, aber die zeitliche Nähe zu einem Mord ließ alle vermuten, dass es einen Zusammenhang gab. Vielleicht hatte Helena sogar gesehen, was sich abgespielt hatte und war aus Angst in den Wald geflohen. Lynne wusste, dass die seit einem schweren Trauma verwirrte Ärztin häufig nachts durch das Lager ging, als suche sie etwas lange Verlorenes. Also hatte sie die Scheinwerfer der Panzer ausgerichtet, Taschenlampen verteilen lassen und Suchtrupps zusammengestellt. Unter der Leitung einiger Soldaten gingen die Barbaren den Wald und das Seeufer ab.
Alle beteiligten sich an der Suche, nur Jacob patrouillierte ungeduldig zwischen den Zelten auf und ab. Der Mörder des Barbaren und das Schicksals Helena Lewis‘ schienen ihn nicht zu interessieren.
Lynne betrachtete seine hagere Gestalt in der einsetzenden Dämmerung. Er hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt und hielt den Kopf gesenkt, als arbeite er an der Lösung eines schwierigen, mathematischen Problems. Sie wusste, dass er wütend war.
„ Lynne?“ Er musste ihren Blick bemerkt haben, sprach jedoch, ohne sie anzusehen. „Gib mir Stuart und drei Barbaren, um die Suche fortzusetzen. Lennox ist in der Nähe, das kann ich spüren. Wir würden es beide bereuen, wenn er entkommt.“
Die Drohung hing zwischen ihnen. Lynne biss sich auf die Lippe und schüttelte den Kopf. „Ich kann dir im Moment niemanden geben, Jacob. Sobald wir Helena gefunden haben, werde ich dich mit allem unterstützen.“
„ Und wann werden wir Helena gefunden haben?“ Seine Stimme klang gepresst. Die Finger seiner linken Hand kneteten seine rechte.
„ Ich weiß es nicht.“
„ Dann solltest du es herausfinden.“ Jacob sah sie zum ersten Mal an diesem Morgen an. Sein Blick war kalt. „Bevor es zu spät ist“, fügte er nach einen Moment hinzu, bevor er sich abwandte und mit wehendem Mantel hinter einem Panzer verschwand.
Lynne strich sich müde mit der Hand über die Augen. Sie hatte ihn schon lange nicht mehr in einer solch schlechten Stimmung erlebt und ahnte, dass ein Wutanfall in greifbare Nähe gerückt war. Ein Teil von ihr fragte sich, ob sie Jacob eines Tages vielleicht töten müsse, ein anderer hoffte, dass er sie nicht zuerst erwischte.
„ Captain?“
Sie drehte sich um. Private Blayre salutierte lehrbuchgerecht und zeigte zum Seeufer, wo sie die dunklen Silhouetten einiger Barbaren erkennen konnte.
„ Wir haben Dr. Lewis gefunden, Captain.“
Der Tonfall, mit dem er das sagte, verriet Lynne bereits alles, was sie wissen musste. Trotzdem nickte sie und begleitete Blayre zum Ufer.
6
Sie lag mit dem Gesicht nach oben im flachen Wasser. Ihre Haut war weiß, ihre Augen geschlossen. Wellen schwappten über sie hinweg und spielten mit ihren dunklen Haaren. Ihre Fingerspitzen waren runzelig wie nach einem zu langen Bad.
„ Is ertrunken“, sagte Fraapoth. Er war ein Farmer aus Kansas, der in der Stammeshierarchie einen der oberen Plätze einnahm. Jed schätzte seine ruhige, besonnene Art.
„ Ja“, antwortete er und schob die Hände tiefer in die Hosentaschen. „Das … äh … ist sie wohl.“
Er versuchte Helena nicht anzusehen. Im Washingtoner Bunker hatten sie sich nur oberflächlich gekannt, waren einander in den Korridoren oder in einem der Esssäle begegnet, ohne mehr als ein paar Floskeln auszutauschen. Nach dem Zwischenfall am Nordpol hatte er auch keine Gelegenheit gehabt, sie näher kennen zu lernen, aber trotzdem berührte ihr Tod ihn anders als die Leichen, die er in den letzten Monaten gesehen hatte. Vielleicht lag es daran, dass mit ihr ein weiterer Teil seiner alten, sicheren (und einsamen, fügte er nach kurzem Zögern hinzu) Welt verschwunden war.
„ Macht mal Platz“, sagte Blayre hinter ihm. „Lasst den Captain durch.“
Jed trat zur Seite und bemerkte erst in diesem Moment, dass fast alle Expeditionsteilnehmer, ob Soldaten oder Stammesangehörige sich um die Leiche versammelt hatten. Es erschien ihm falsch, Helena so anzustarren, also wandte er sich ab, während Crow neben ihr in die Hocke ging und sie nach Verletzungen abtastete.
„ Ich hole eine Decke“, sagte er, als Blayre ihn fragend ansah. „Es dauert nur eine Minute, falls Crow mich braucht.“
„ Captain Crow“, korrigierte Blayre.
Jed ignorierte ihn und schob sich an den umherstehenden Männern vorbei, die leise miteinander sprachen. Nach der langen, mörderischen Reise gab es niemanden unter ihnen, der mit dem Anblick von Leichen nicht vertraut war, aber Helenas Tod war auch für sie etwas Besonderes, vorausgesetzt die ersten Vermutungen, die man zaghaft über einen möglichen Selbstmord geäußert hatte, stellten sich als richtig heraus.
Dass der junge Joee ermordet worden war und sein Geist nach dem Glauben vieler rastlos über der Lichtung schwebte, fiel kaum noch ins Gewicht. Jetzt ging es um den Geist eines Selbstmörders.
Wenn sie sich wirklich umgebracht hat , dachte Jed, als er den Zelteingang öffnete und im Halbdunkel nach einer der alten Decken tastete, mit denen sie den Boden isolierten. Vielleicht wurde sie ebenso ermordet wie Joee.
Er hoffte beinahe – auch wenn hoffen ein vielleicht unangebrachtes Wort war – , dass man zweifelsfreie Spuren ihrer Ermordung finden würde. Nur dann ließen sich die komplizierten Rituale, Reinigungen und Austreibungen vermeiden, die ein Selbstmord mit sich brachte, ganz zu schweigen von der sofortigen Räumung des Lagers. Mit Geistern, daran erinnerten ihn die Abergläubischen unter den Kriegern immer wieder, war nicht zu spaßen.
Jed ertastete die Decke, nach der er gesucht hatte, und zog sie hervor. Sie war dreckig und roch nach Yakk, aber das würde Helena wohl nicht mehr stören. So gut es ging, schlug er sie aus, bevor er den Zelteingang schloss und aufstand.
Pieroo war nur ein Schatten am Rande seines Gesichtsfeldes, aber es konnte keinen Zweifel daran geben, dass es sich bei der großen, kräftigen Gestalt, die zwischen zwei Zelten verschwand, um ihn handelte. Eine zweite Gestalt tauchte als Silhouette an einer Zeltwand auf, dann eine dritte, die schmaler und kleiner als die beiden anderen war. Jed hätte geschworen, dass es Majela war.
Ein merkwürdig kribbelndes Gefühl breitete sich in seinem Magen aus. Seit einigen Wochen hatte er bereits den Eindruck, dass um ihn herum Dinge im Verborgenen geschahen. Männer, die kurze Blicke und Sätze untereinander austauschten und verstummten, wenn sie WCA-Offiziere sahen; Vorräte, die verschwanden und wieder auftauchten, als wolle jemand die Aufmerksamkeit der Wachen testen; kleine Gruppen, die sich scheinbar zufällig zusammenfanden und wieder zerstreuten. Und immer wieder war es Majela, die er unter ihnen sah und die ihn mit Scherzen abwimmelte, wenn er Fragen stellte.
Zögernd machte er ein paar Schritte in Richtung der Zelte. Die Schatten waren nicht mehr zu sehen, aber das Lager war so klein, dass er sie leicht wiederfinden würde – vorausgesetzt, das wollte er überhaupt.