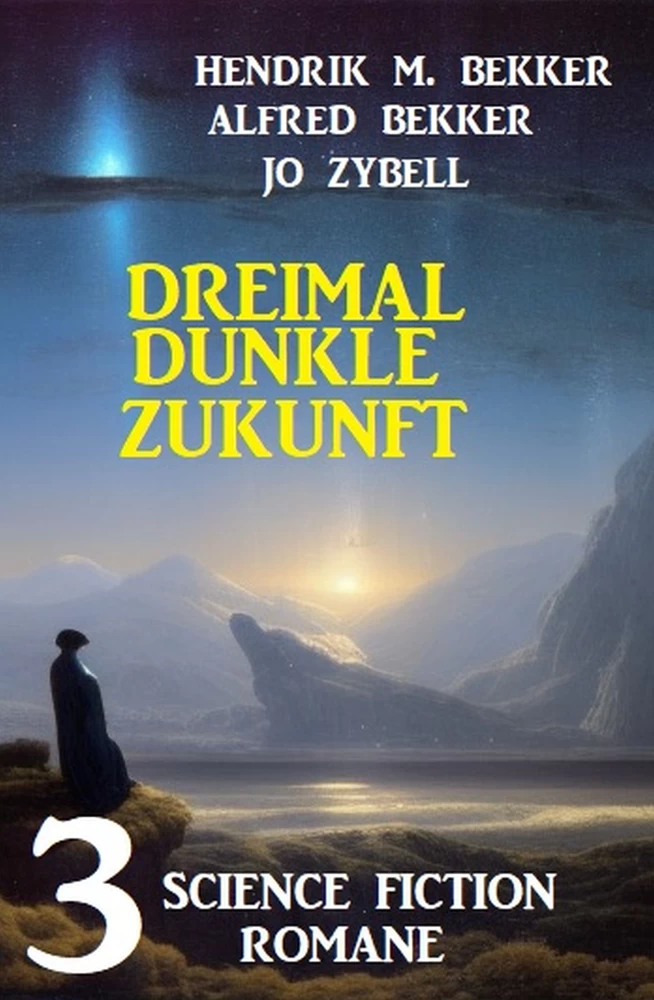Zusammenfassung
von Hendrik M. Bekker, Alfred Bekker, Jo Zybell
Dieses Buch enthält folgende Geschichten:
Jo Zybell: Lennox und der Kampf um die Domstadt
Hendrik M. Bekker: Die neue Dämmerung der Eisriesen
Alfred Bekker: Herrschaft der Alten
Es ist das Ende der Welt.
Schräger Satz, oder?
Wenn man ihn das erste Mal denkt, fühlt es sich frevelhaft an. Der Teil in einem, der völlig auf das Überleben ausgerichtet ist, knallt dem rationalen Teil einen vor den Latz und ruft NEIN.
Wenn man ihn dann das erste Mal sagt, muss das ähnlich sein. Bisher hab ich's nur gedacht und sogar mal jemanden sagen hören. Aber, ehrlich? Ich glaube es inzwischen.
Nur, etwas ist nicht so richtig so, wie man sich das vorstellt. Der Emmerich-Katastrophen-Film ist abgelaufen, einmal walzten die Naturgewalten über die Erde und dann ... Ja, dann waren wir noch da.
Wenn es so was gibt wie einen Weltuntergang, dachte ich immer, es ist wie Armageddon in der Bibel. Nicht dass ich das gelesen habe, wer hat es schon? Aber da steht doch, meine ich, dass am Ende, wenn Gericht gehalten wurde, die Tür zum Paradies zugemacht wird und die Schöpfung vorbei ist. Sack zu, Affe tot, irgendwie so.
Aber wir sind noch da!
Ich starre auf die gefrorene Piste vor mir. Das hier war mal Teil des Hafenbeckens von Emden. Das ist oben in Deutschland, in Ostfriesland. Okay, für das "oben" wäre mein Erdkundelehrer nun sauer. Halt im Norden.
Aber der Reihe nach, das, was hier vor mir ist, ist alles, was noch ist.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Dreimal dunkle Zukunft: 3 Science Fiction Romane
Published by Alfred Bekker, 2022.
Copyright-Seite
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
Dreimal dunkle Zukunft: 3 Science Fiction Romane
Dreimal dunkle Zukunft: 3 Science Fiction Romane
––––––––

von Hendrik M. Bekker, Alfred Bekker, Jo Zybell
Dieses Buch enthält folgende Geschichten:
Jo Zybell: Lennox und der Kampf um die Domstadt
Hendrik M. Bekker: Die neue Dämmerung der Eisriesen
Alfred Bekker: Herrschaft der Alten
––––––––

Es ist das Ende der Welt.
Schräger Satz, oder?
Wenn man ihn das erste Mal denkt, fühlt es sich frevelhaft an. Der Teil in einem, der völlig auf das Überleben ausgerichtet ist, knallt dem rationalen Teil einen vor den Latz und ruft NEIN.
Wenn man ihn dann das erste Mal sagt, muss das ähnlich sein. Bisher hab ich‘s nur gedacht und sogar mal jemanden sagen hören. Aber, ehrlich? Ich glaube es inzwischen.
Nur, etwas ist nicht so richtig so, wie man sich das vorstellt. Der Emmerich-Katastrophen-Film ist abgelaufen, einmal walzten die Naturgewalten über die Erde und dann ... Ja, dann waren wir noch da.
Wenn es so was gibt wie einen Weltuntergang, dachte ich immer, es ist wie Armageddon in der Bibel. Nicht dass ich das gelesen habe, wer hat es schon? Aber da steht doch, meine ich, dass am Ende, wenn Gericht gehalten wurde, die Tür zum Paradies zugemacht wird und die Schöpfung vorbei ist. Sack zu, Affe tot, irgendwie so.
Aber wir sind noch da!
Ich starre auf die gefrorene Piste vor mir. Das hier war mal Teil des Hafenbeckens von Emden. Das ist oben in Deutschland, in Ostfriesland. Okay, für das „oben“ wäre mein Erdkundelehrer nun sauer. Halt im Norden.
Aber der Reihe nach, das, was hier vor mir ist, ist alles, was noch ist.
Lennox und der Kampf um die Domstadt

|

|


Das Zeitalter des Kometen #25
von Jo Zybell
Der Umfang dieses Buchs entspricht 126 Taschenbuchseiten.
Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen.
In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf ...
Zwischen den Coelleni und den Dysdoorern entbrennt ein Krieg, der von einem Unbekannten angeheizt wird. Dieser Fremde ist in der Lage, die alten Flugzeuge zu fliegen und Sprengstoffe herzustellen. Das könnte ein Hinweis auf eine unterirdische Kolonie von Überlebenden sein. Eine solche Kolonie soll Fanlur mit seinem Lupa Wulf suchen, vermutet wird eine solche in den alten Bunkeranlagen in der Nähe von Coellen. Fanlur macht sich auf den gefährlichen Weg.
––––––––

Dieser Band wird mit dem Titel Lennox und das Schlangen-Ei fortgesetzt.
Copyright

|

|


Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2020 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Twitter
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1

|

|


Chraaz, am 7. Tag des 2. Mondes im 508. Winter nach Alxanatan
Das Ende kam in der Nacht zum dritten Tag, dem höchsten der Schindung. Zwölf ministricis trugen das Baumkreuz mit der mater. Regen klatschte auf ihre nackten Mädchenkörper, auf die Sterbende, auf alle. Die mater sang, aber es klang wie das Kreischen von Schlittenkufen.
Sechzig ministratos eskortierten den Zug. Die Burschen drohten mit Spießen in die Dunkelheit.
Maris schritt direkt vor dem Fußende des Baumkreuzes, denn im nächsten Winter würde es ihr gehören. Wie die Schwestern an ihrer Seite schulterte auch sie ihr Schwert und hielt ihren Pelz dicht unter dem Kinn zusammen. Wie eine Frau standen sie still, als der Boden bebte und Gebrüll sich erhob.
Maris lauschte in die Regennacht. Und die Schwestern lauschten auch – Naryma, Schinee, Maschee, Rimaya, alle. Nur die mater, die lauschte nicht, die krächzte, röchelte, versuchte zu singen und zu sterben. Der Regen vermischte sich mit ihrem Blut.
Ein paar Atemzüge lang hörte Maris die schweren Tropfen auf Blattwerk und Dachschindeln klatschen, hörte die mater krächzen, hörte das Gebrüll anschwellen. Sonst nichts.
Es war nicht das Gebrüll von Tieren. Auch nicht das der Reiter aus dem Osten, wenn die Gier sie mindestens einmal im Jahr aus dem Bergwald gegen Chraaz und Mariaschnee trieb.
Überhaupt hörte es sich nicht an wie Gebrüll einer Kreatur.
Und es schwoll immer weiter an.
»Alxanatan ...«, flüsterte Schinee rechts von Maris. »Er kommt dennoch ...« Sie hatte ihr Schwert von der Schulter gehoben und reckte es dem Nachthimmel entgegen, als könnte sie auf diese Weise das Gericht des Höchsten Sohnes aufhalten.
Von allen Seiten flüsterte es: »Wir haben nicht genug geopfert, wir haben nicht genug gekniet, wir haben nicht genug Ostreiter getötet ...« Und so weiter: Nicht genug geschlagen, nicht genug gehungert, nicht genug, nicht genug.
»Still!«, zischte Maris. Augenblicklich verstummte das Geflüster. »Närrinnen! Alxanatan kommt kein zweites Mal, solange eine mater sich opfert!«
»Weiß man‘s?«, flüsterte Rimaya hinter ihr. Maris fuhr herum und schlug mit dem Handrücken zu. Die Jüngere duckte sich, drückte die Linke gegen die Wange, wagte aber nicht das Schwert gegen die neue mater zu erheben.
Das Gebrüll war jetzt sehr nah – so nah, als würden ihre Körper jeden Moment davon verschlungen werden. Jetzt mischten sich das Splittern von Holz und die Schreckensschreie von Menschen in den entsetzlichen Lärm.
Auf einmal: ein Lichtstrahl, und fast zeitgleich ein Feuerball.
Eine Sonnenvision? Die theosmater selbst? Oder doch ein neuer Alxanatan? Die ministratos klemmten die Spieße unter die Achseln und wichen zurück, bis Maris mit ihrem Schwert nach den Spießschäften schlagen konnte und die kahl geschorenen Burschen zusammenzuckten. »O Niawaana!«, rief einer von ihnen mit brüchiger Stimme, und sofort stimmten andere ein: »O Niawaana! Niawaana, Niawaana ...«
»Still!«, schrie Maris. Schwächlinge allesamt, Schwächlinge und Dummköpfe! »Still beim Höchsten!«
Im erlöschenden Feuerball erkannte sie die Umrisse der Klostertürme. Ein Ruinenflügel von Mariaschnee stand in Flammen. Alle sahen es, bevor die Dunkelheit Kloster und Dorf wieder einhüllte. Auch die ministricis sahen es, und sie sanken in die Knie, ließen das Baumkreuz von ihren nackten Schultern gleiten, seufzten oder stießen spitze Schreie aus.
Das Baumkreuz rutschte schräg ins Laub, krachte ins Unterholz, schlug im schlammigen Waldboden auf. Die mater gab ihre Gesangsversuche auf. »Nix Niawaana!«, stöhnte sie laut. »Wir haben Recht gehabt! Es ist der Höchste Sohn, er kommt zurück! Adventus, adventus!«
Wieder ein Feuerball; Flammen schossen in den Nachthimmel. Einen Atemzug lang spiegelten sie sich in der roten Feuchtigkeit des geschundenen Körpers der mater, in den bloßgelegten Muskelsträngen und Sehnen.
Die Flammen loderten an der Stelle, wo das Tor zu Mariaschnee sein musste. Maris Herz stolperte, schien nicht Blut sondern Eiswasser in ihre Adern zu pumpen. Und dann sah sie es – ein Ungeheuer, ein Höllenbiest, lucifa leibhaftig: Schwarz, pelzig, gewaltig, hoch wie ein Haus, lang und breit wie die Heilige Gruft. Den Bruchteil eines Atemzuges nur sah sie es, dann erlosch das Gleißen, und sie hörte das Ungeheuer nur noch brüllen und näher kommen.
»Weg mit euch!«, schrie sie. »Rettet euch!«
Schatten spritzten auseinander, huschten an Maris vorbei, stolperten ins Unterholz. Maris kniete neben dem Querholz des Baumkreuzes in den Morast, so dicht neben dem Kopf der sterbenden mater, dass deren letzte Wärme über ihr Knie strich. Mit ausgestreckten Armen hielt sie das Schwert vor der Brust. »Es ist nicht der Sohn«, flüsterte sie. »Nicht Alxanatan und schon gar nicht Niawaana. Es ist ...«
Sie verstummte, denn die Flammen aus den alten Gemäuern von Mariaschnee warfen das Spiegelbild der Hölle in den Nachthimmel. Seit Anbeginn der Zeit ragten jene Türme in den Gotteshimmel, seit Alxanatan trotzten sie und die Frauen hinter ihren Mauern der Dunkelheit und dem Bösen. Und jetzt ...
»Es ... es ist ...« Die sterbende mater versuchte den Satz zu beenden. »Es ist ... lucifa ... nicht wahr ...« Ihre letzten Worte, danach bäumte sich ihr wunder Körper dreimal auf – jedes Mal schwächer – und dreimal noch riss sie den lippenlosen Mund auf, um nach Luft zu schnappen. Mit dem letzten Atemzug gurgelte ein Strom mit Schaum vermischten Blutes aus ihrem Rachen. Danach erschlaffte sie und blieb für immer still.
Im Lichtschein des Feuers zeichneten sich die Umrisse des Monstrums ab. Welch metallenes, unmenschliches Gebrüll es ausstieß! Es walzte eine Hütte vor dem brennenden Tor nieder, pflügte durch das Feuer in den Klosterhof hinein.
Das war der Augenblick, in dem Maris zum ersten Mal ahnte, dass das Ende nahe war. Mehr als zwei Monde sollten noch vergehen, bis die dunkle Ahnung sich zur unausweichlichen Gewissheit verdichten würde.
2

|

|


Irgendwo südlich von London an der Themse, Ende März 2520
Das Biest zappelte, schlug um sich, warf sich hin und her.
Das Wasser färbte sich schlammig braun, dann rot, schäumte und spritzte. Die Männer brüllten, am lautesten der Druud, obwohl er doch in sicherer Entfernung im seichten Uferwasser stand. Der Lupa neben ihm stemmte seine Vorderläufe ins Wasser und Schlamm und bellte sich die Kehle heiser.
Die Jagdbeute war ein sehr junger Kwötschi, den die Lords im nahen Schilf mit Pfeilen gespickt hatten: Fanlur erkannte es am kleinen Kopf und an der hellgrünen Unterseite.
Ausgewachsene Kwötschis hatten meist einen weißen Bauch.
Selbst nachdem der Grandlord dem Riesenfrosch seinen Spieß in die Flanke gerammt und ihn daran auf den Rücken gedreht hatte, gab das Tier noch nicht auf. Einem Biglord namens Djeymes stieß es den Hinterlauf gegen die Brust, sodass der Arme samt seiner zum Schlag erhobenen Axt im aufgewühlten rotbraunen Wasser verschwand. Ein zweiter Biglord – er bearbeitete den Schädel des Biestes mit einem Kurzschwert – ließ plötzlich die Waffe fallen und griff sich mit beiden Händen an die Kehle: Die Zunge des Kwötschis hatte sich um seinen Hals gewickelt und würgte ihn. Es war Wichaad, der älteste Sohn des Grandlords.
Zwanzig Meter entfernt trieben vier Boote auf dem Fluss.
Sie bildeten einen Halbkreis um die Jäger. Insgesamt acht Bogenschützen standen darin, hatten Pfeile eingelegt und die Sehnen gespannt. Sie zielten auf die Wasseroberfläche, schossen aber nicht. Eine übliche Vorsichtsmaßnahme: Manchmal versuchten Kwötschis einem gefangenen Artgenossen zur Hilfe zu kommen.
Zwei weitere Lords sprangen mit erhobenen Schwertern in die Themse. Einer hieb die Kwötschizunge durch, und Bigload Wichaad taumelte rücklings ins Uferwasser. Die Kinder und Frauen in der Böschung klatschten in die Hände und stampften mit den Füßen auf, um die Jäger anzufeuern. Der Druud brüllte, Wulf bellte, Grandlord Paacival fluchte, und Biglord Djeymes tauchte wieder aus den Fluten auf. Er heulte vor Wut.
Fanlur langte nach einem Ast und schob die Glut unter dem Swaan zusammen; in größter Ruhe tat er das. Was sollte auch er sich in die Jagdszene einmischen? Die Lords waren zähe Burschen, zäher sogar als diese Bestien von Mammutkröten.
Der Albino stand auf, nahm das Tongefäß vom Stein am Rand der Glut und fasste den Spieß. Während er den schon braun gebratenen Schwanenvogel drehte, übergoss er ihn mit dem Sud aus Wasser, Steinsalz, Waldkräutern und Honig.
Zischend verdampfte Flüssigkeit in der Glut. Ein Stück Hals und der Kopf des Swaans lösten sich aus der Schlinge, mit der sie am Körper festgebunden waren, und baumelten in die Glut hinunter. Fanlur stellte den Krug ab. Mit dem Brateisen hielt er den Kopf fest, mit einem Schwert schnitt er ihn ab. Er fiel in die Glut.
Der Applaus am Ufer schwoll an, Druud Alizan und Paacival brüllten nicht mehr, sondern lachten jetzt. Fanlur sah, wie sie den Kwötschi aus dem Wasser zerrten. Dessen Rachen öffnete und schloss sich nach letzten vergeblichen Atemzügen schnappend, seine Vorderläufe zuckten noch ein wenig, doch er hatte schon aufgegeben. Na also. Im Schneidersitz ließ Fanlur sich wieder am Rande der Glut nieder.
Die Luft war mild und feucht. Fanlur trug einen langen Mantel aus dunkelbraunem Wakudaleder, dessen Kragen und Säume mit anthrazitfarbenem Taratzenfell besetzt waren; ein Geschenk seines Vaters. Ebenfalls neu und ein Geschenk von Sir Leonard waren die pelzbesetzten schwarzen Stiefel. Sein langes, fast weißes Haar hatte Fanlur sich mit einem schwarzen Tuch aus der Stirn gebunden.
Seit er wieder ein freier Mann und in Britana war, fühlte er sich manchmal auch innerlich wie neu; manchmal.
Fanlur gehörte zu den Männern, denen es schwer fiel, sich von vertrauten Waffen, Werkzeugen oder Kleidern zu trennen.
Doch die Monate am Kratersee, die Kämpfe auf dem Rückzug nach Westen und vor allem die mörderischen letzten Wochen in der Sklaverei hatten seine Ausrüstung und seine Kleidung verschlissen; und beinahe auch ihn selbst.
Er beugte sich nach vorn, streckte den Arm nach dem Spieß aus, wendete den Swaanenbraten um eine viertel Drehung. Der Bratenduft trieb ihm das Wasser auf den Gaumen. Am Themseufer standen Paacival und seine Leute um den erbeuteten Kwötschi herum und palaverten. Wahrscheinlich stritten sie, ob sie ihn schon hier oder erst im Lager schlachten und essen sollten. Im Lager gab es erheblich mehr hungrige Mäuler; ein Argument für die erste Variante.
Fanlur verzog das Gesicht. Krötenfleisch – widerlich!
Ja, länger als ein Jahr war es her, dass er London verlassen hatte, um Timothy Lennox‘ Hilferuf zu folgen und mit Dave Mulroney und den beiden Fischmenschen Lotraque und Lorem in den fernen Osten an den Kratersee zu reisen, an den Einschlagort des Kometen. Er rechnete nach: vierzehn Monate waren es genau; vierzehn harte Monate.
Die Lords schienen sich geeinigt zu haben. An Seilen schleiften sie den Kwötschi zu einer der knorrigen Weiden am Rande des Schilfs. Der Lupa sprang zwischen ihren Beinen herum, kläffte und schnappte nach den Schwimmfüßen des Riesenfrosches. Von den Verletzungen, die er sich als rettender Bote nach Salisbury zugezogen hatte, war nichts mehr zu bemerken.
Biglord Djeymes warf ein Seil über einen Ast, daran zogen sie das Tier hoch. Also doch: Schlachtung an Ort und Stelle.
Fanlur pfiff durch die Zähne. Wulf warf sich herum, stellte die Ohren auf, hörte auf zu kläffen und lauschte. Ein zweiter Pfiff, und in großen Sprüngen setzte der Lupa durch das Ufergras. Am Feuer neben seinem Herrn ließ er sich nieder.
»Nichts für dich, dieses ekelhafte Krötenfleisch.« Mit der Linken kraulte Fanlur seinen vierbeinigen Gefährten im Nacken, mit der Rechten deutete er auf den Braten. »Hab noch ein Weilchen Geduld, mein Freund, dann teile ich den Swaan mit dir.«
Der Lupa raunzte, als verstünde er, und es klang so tief und rau wie das Blöken eines jungen Wakudastieres. Fanlurs Blick fiel auf Wulfs Ohr. Ein Mediziner der Community Salisbury hatte die Tätowierung wieder entfernt, die Botschaft, die ihm und Mulroney das Leben gerettet und die Freiheit beschert hatte. »Mein kluger, mutiger Freund.« Er klopfte dem Lupa gegen die Flanken. Ohne ihn hätten Dave Mulroney und er noch immer auf der verdammten Meera-Insel festgesessen.
»Überlass das stinkende Fleisch diesen struppigen Barbaren.«
Er blickte hinüber zu der Weide, wo sich eine Menschentraube um das kopfüber aufgehängte Tier drängte.
Fanlur mochte die Lords, vor allem den Clan des Biglords Paacival. Seit die Communities und die Barbaren ein Bündnis geschlossen hatten und zusammen arbeiteten, bewegten sie sich wie selbstverständlich am Themseufer, in den Ruinen Londons, sogar in der Gegend der Houses of Parliament und auf den vielen Baustellen, die es dort seit einigen Wochen gab. Er schätzte ihren Mut, ihren derben Humor und ihre Kampfkraft.
Nur ihre Essgewohnheiten und ihre religiösen Sitten – sie pflegten Orguudoo Menschen zu opfern – stießen ihn ab.
Er hörte den greisen Druud schreien und sah die Leute zurückweichen. Eine Schwertklinge blitzte kurz über den Köpfen auf, dann folgte das hässliche Geräusch zerreißenden Fleisches, und gleich darauf klatschte etwas Schweres auf den Grasboden. Wulf sprang auf und bellte. Fanlur rümpfte die Nase und drückte seinen weißen Gefährten zurück auf den Boden.
Acht Wochen war es nun her, dass sie zurückgekehrt waren.
Lennox und Marrela hatte er kaum gesehen seitdem. Irgendwo auf dem Festland waren sie mit einer EWAT-Crew der Community London unterwegs, auf der Suche nach Verbündeten. Alles stand im Zeichen des bevorstehenden Krieges gegen die Yandamaaren.
Auch der Amerikaner, Mr. Darker, war nicht mehr in London. Vor einigen Tagen war er mit neuen Forschungsergebnissen rund um das Immunserum nach Prag aufgebrochen. Von dort sollte es weiter nach Moskau gehen.
Darker war die treibende Kraft hinter den Bemühungen, die auf lange Sicht sterilisierende Wirkung des Serums zu tilgen.
Vermutlich, weil es aus seinem Blut gewonnen wurde. Wer trug schon gern die Schuld daran, dass die Bunkerleute zwar wieder ungefilterte Luft atmen konnten, dafür aber mit der nächsten Generation aussterben würden?
Der Weltrat in Washington, der das Serum seit über dreißig Jahren nutzte, stand bereits dicht davor. Denen zu helfen war allerdings nicht Mr. Darkers Bestreben, hatte er doch über lange Jahre mit seiner Rebellengruppe, den »Running Men«, gegen die amerikanische Regierung gekämpft.
Und Dave? Der Astrophysiker aus der Vergangenheit hielt sich die meiste Zeit in der Community London auf – die Queen beanspruchte ihn, und das nicht nur als Berater für zahlreiche Bauprojekte.
Er selbst, Fanlur, streifte meistens zwischen Salisbury und London durch die Wälder oder am Ufer der Themse entlang.
Wohin gehörte er nun? Nach Salisbury? Schon möglich.
Nach London? Seit wann das? Oder in die Wildnis? Schon eher. Oder doch nach Coellen, wo er den größten Teil seiner vierundfünfzig Jahre verbracht hatte? »Du bist ruhelos«, hatte sein Vater gesagt, und Recht hatte er.
»Eine woom«, krächzte es plötzlich vom Schlachtplatz her.
»Eine woom, eine woom!« Fanlur fragte sich, was jetzt wieder los war. Woom bedeutete im Dialekt der Lords Frau – doch mindestens ein Dutzend Frauen hielt sich am Schlachtbaum auf. Paacival drehte sich um und winkte. »Hea zu uns, Fanlua, hea zu uns!«
Fanlur lächelte und stand auf. Weil sie aus irgendeinem Grund kein R aussprechen konnten, nannten sie ihn Fanlua.
Neben seinem Lupa schritt er zum Schlachtplatz.
Es gab nicht viel Grund zum Lächeln in letzter Zeit für den Albino. Wenn er über die ungeheuerlichen Dinge grübelte, die vom Kratersee aus auf die Menschheit zukamen, schnürte es ihm das Herz zusammen. Nun, wenigstens hatte er sich mit Timothy Lennox versöhnt, was Marrela anbelangte. Die hübsche Barbarin hatte sich für den Piloten aus der Vergangenheit entschieden, und Fanlur hatte es endlich akzeptiert.
Akzeptieren müssen. Auch wenn es ihm schwer gefallen war.
Die Lords öffneten eine Gasse, um ihn zu Alizan und ihrem Grandlord durchzulassen. Einige grinsten ihn an, Grandlord Paacival feixte gar, als hätte sein Druud ihm gerade einen schmutzigen Witz erzählt. Hatte er aber nicht. Vielmehr stand Druud Alizan leicht vornüber gebeugt und die Hände auf die Knie gestützt und beäugte das aus dem geöffneten Kwötschileib herausquellende Gedärm.
»Er sieht eine woom«, feixte der massige Paacival. »Eine woom für dich, Fanlua.«
Fanlur begriff: Aus dem Kwötschigedärm weissagte Alizan die Zukunft. Auch eines dieser unappetitlichen Rituale der Lords. »Ich? Eine Frau?« Der hochgewachsene Albino rang sich ein Grinsen ab. »Blödsinn!« Kurz dachte er an Marrela, und ein leiser Schmerz loderte in seiner Brust auf, aber dann stellte er sich wieder der Realität.
»Doch, Fanlua, doch!«, krächzte der Greis. »Lassen Ganzmond veagehen. Noch voa de next wiast du de woom deines Lebens begegne! Yea!«
3

|

|


Dysdoor, März 2520
Hundertzwanzig Schritte trennten die bunte Schar noch von der Zeltkuppel, und dennoch wagte schon jetzt keiner mehr zu reden. Nicht einmal Getuschel hörte Haynz hinter sich. Und das war gut so. Dem Zelt hatte man sich nicht anders als in größter Andacht und Ehrfurcht zu nähern. »Jawoll!«, raunzte er vor sich hin, womit er sich befremdete Blicke seines Adjutanten und der beiden Jungfrauenträger einhandelte. Der Hauptmann von Dysdoor ignorierte sie.
Haynz war klein und ziemlich dick; dazu kahlköpfig, wie alle Dysdoorer Männer im waffenfähigen Alter. Ihm unfreundlich gesonnene Lästermäuler – solche gab es vorwiegend im nahen Coellen – bezeichneten Haynz gern als wandelndes Fässchen.
Zur Feier des Tages hatten seine Frauen ihm die grünen Hosen und den grünen Umhang gewaschen. Jedes Stück Haut an ihm, das nicht grün verhüllt war, hatte er sich mit fettiger roter Farbe eingeschmiert. Auch seine achtundneunzig Krieger, die den Festzug an diesem Morgen begleiteten, trugen frisch gewaschenes Tuch – gelb. Auf seine Anweisung hin hatten sie die schwarze Farbe der Kriegszeit angelegt. Die etwa dreihundertsiebzig Frauen hinter ihm waren bis über die Nasen in rote, blaue und grüne Tücher gehüllt.
Die Kinder hatten die Dysdoorer an diesem Vormittag übrigens in ihren Pfahlhütten am Fluss eingesperrt. Ein Befehl des Hauptmanns, und die meisten stimmten ihm zu, denn Kinder mussten nicht alles sehen und hören, was es in letzter Zeit in den Ruinen Dysdoors zu sehen und zu hören gab.
Etwa achtzig Schritte vor der silbernen Kuppel blieb Haynz stehen und hob seine fleischige Rechte. Der Festzug hielt an.
Haynz drehte sich um. »Kniet nieder und betet IHN an«, flüsterte er, während er die Arme ausstreckte und beide Zeigefinger abspreizte, sodass sie hinunter auf den zerbröselnden und von frischem Huflattich und Löwenzahn übersäten Asphalt deuteten.
Diejenigen, die verstanden, sahen sich zunächst verlegen an.
In Dysdoor pflegte man eigentlich nicht niederzuknien, geschweige denn zu beten. Doch seit SEINER Ankunft hatte sich allerhand verändert.
»Hurtig!«, zischte Haynz. »Wird‘s denn bald? Knien und anbeten!« Die ersten Krieger und Weiber in seiner Nähe gehorchten, und bald ging ein Rauschen und Rascheln durch die Menge: Alle knieten nieder und begannen vor sich hin zu murmeln.
Alle außer dem Hauptmann, seinem Adjutanten, den Jungfrauenträgern und den Jungfrauen selbst natürlich; die konnten ja nicht knien, weil sie getragen werden mussten.
Haynz warf einen Blick auf die kniende und murmelnde Menge, grunzte zufrieden und wandte sich wieder dem Silberzelt zu. Mit einer Kopfbewegung bedeutete er den drei Männern, ihm zu folgen. »ER wartet.«
Der Hauptmann setzte sich in Bewegung und schaukelte durch Brennnesselfelder und Unkrautgestrüpp, vorbei an blühenden Ginsterbüschen und Gruppen kleiner Birken auf die Lichtung hinaus, wo SEIN Kuppelzelt stand.
Den Alten musste diese Stelle einst ein wichtiger Platz gewesen sein. Viele mit Geröll und Unkrautteppichen bedeckte Straßen führten von hier aus an den Großen Fluss, die von Efeu und wildem Wein eingesponnen Ruinenfassaden standen weit auseinander und waren hoch und breit, und auf dem Platz zwischen Ginsterbüschen, Birkengruppen und Nesseln standen viele moos- und windenbedeckte Eisenpfähle jeden Umfangs und jeder Höhe.
Haynz drehte sich nach seinen Begleitern um. »Schneller!«, winkte er. Die Jungfrauen – Töchter seines Bruders Gleemenz, siebzehn und neunzehn Jahre alt – waren blass, machten große Augen und ehrfürchtige Gesichter. Sie zogen das weiße Tuch um ihre Schultern zusammen. Ihr Haar war abgeschoren.
Fünfzehn Schritte von der Kuppel entfernt überquerte Haynz einen gerodeten, gejäteten und ausgebesserten Straßenstreifen. Er führte aus einem breiten Gebäude, über dessen glas- und türlosem Tor die einst roten Zeichen DB verblassten, und von dort aus über den Platz, und fast schnurgerade durch die Ruinen des Alten Dysdoor und bis zum Pfahldorfviertel hinaus am großen Fluss. Harte Arbeit war das gewesen; lange vor dem Neujahrsfest schon hatten sie damit begonnen.
Bald nach SEINER Ankunft hatte ER Haynz‘ Gastgeschenk in die Tiefen der DB-Ruine bringen lassen und dem Hauptmann auch gleich die Pläne offenbart, nach denen er den Straßenstreifen instand gesetzt wissen wollte.
Sie ließen den seltsam unbewachsenen und relativ glatten und geraden Straßenzug hinter sich. Wenige Schritte vor dem Kuppelzelt blieb Haynz stehen. Er winkte die beiden Jungfrauenträger an sich vorbei. Sein Adjutant zog es vor, eine Art Sicherheitsabstand einzuhalten. Er verharrte am Rande der gerodeten Straße.
Das gelb gewandete Duo schleppte die beiden Jungfrauen an Haynz vorbei. Die Träger schnauften geräuschvoll, und die Frauen stanken nach Knoblauch. Nun, obschon sie zierlich und entsprechend leicht waren, mussten die beiden Männer sie immerhin schon seit dem Aufbruch im Palasthof des Hauptmanns tragen; gut zwanzig Speerwürfe weit, das ging natürlich in die Knochen.
Sie setzten die Frauen auf einem feuchten Teppich ab, der vor der Silberkuppel ausgebreitet war. Das wünschte ER so.
Auch dass sie barfuß kamen, kurz zuvor kahl geschoren, in sehr heißem Wasser gebadet und mit Knoblauchöl eingerieben worden waren und nichts als gekochte und besonders heiß gebügelte Leinentücher an ihren Leibern trugen, entsprach ganz und gar SEINEN Anweisungen.
Die von ihrer Last befreiten Träger huschten wieder an Haynz vorbei und blieben hinter ihm stehen. Als der Hauptmann in die Knie ging, ließen auch sie und der Adjutant sich zum Gebet nieder.
Es summte seltsam aus dem Inneren des Zeltes. Eine ovale Öffnung bildete sich, dahinter glitzerte ein metallen schimmernder Vorhang in bläulichem Licht. Die Jungfrauen drängten sich aneinander, eine ergriff die Hand der anderen.
Der Vorhang bewegte sich, eine Hand und ein Arm erschienen, beide in goldglänzenden Stoff gehüllt. Die Hand winkte die Jungfrauen zu sich, der Vorhang wurde ein wenig zur Seite geschoben, und für einen Augenblick konnte Haynz SEINEN kräftigen, goldglänzenden Leib sehen.
Die Jungfrauen ließen ihre Leintücher auf den feuchten Teppich gleiten. Nackt huschten sie hinter den Vorhang.
»Bestens«, sagte SEINE Stimme. Dann drehte sich SEINE Hand so, dass die Handfläche nach unten zeigte. Eine knappe Bewegung der Finger gab Haynz zu verstehen, dass er sich zu entfernen habe.
Der Hauptmann wandte sich zu seinen drei Begleitern um.
Er ahmte die Bewegung mit den Fingern nach. Sie gefiel ihm, und sein Adjutant und die Jungfrauenträger verstanden sie auch sofort: Sie hasteten zurück zur knienden Menge. Haynz selbst schritt in die entgegengesetzte Richtung am Kuppelzelt vorbei und setzte sich achtzig Schritte weiter neben das Tor zur DB-Ruine. Danach geschah das Übliche. Zuerst hörte Haynz Stimmen aus dem Kuppelzelt, danach kicherten die Jungfrauen, schließlich quiekte und stöhnte erst die eine und nach ihr die andere. Etwa nach der Zeit, die man zum Häuten einer Wisaau braucht, schob sich die seltsam geformte Tür wieder auf, und die Jungfrauen tänzelten aus der Kuppel. Sie bückten sich nach ihren Tüchern, wickelten sich ein und hüpften kichernd zu ihren Leuten am Rande des großen Platzes.
Kurz darauf jedoch geschah etwas Unübliches, etwas, das heute zum ersten Mal geschehen würde. ER hatte Haynz darauf vorbereitet, und das war der Grund, warum Haynz saß, wo er saß und wartete.
Denn jetzt bildete sich in der dem Platz abgewandten Kuppelseite eine Luke. ER trat ins Freie und kam geradewegs auf den Hauptmann zu. Haynz erhob sich ächzend. Er sah nicht viel von SEINEM goldglänzenden Leib – ein schweres dunkelblaues Tuch bedeckte IHN bis zu den Knien; selbst SEINEN kugelrunden Kopf verhüllte es fast vollständig.
»Unser Anblick ist für sie nur schwer zu ertragen«, hatte ER gleich nach SEINER Ankunft gesagt.
ER ging an Haynz vorbei und schien ihn nicht einmal zu bemerken.
»Könnt Ihr den guten Haynz nicht mitnehmen? Bitte.« Der Hauptmann legte die Handflächen zusammen, wie die Coelleni es taten, wenn sie zu ihren Göttern beteten.
ER befand sich bereits drei Schritte im Inneren der DB-Ruine. Dennoch blieb ER stehen, allerdings ohne sich umzuwenden. »Das würde er möglicherweise nicht überleben«, sagte SEINE dunkle Stimme in jenem feierlichen Tonfall, der Haynz von Anfang an bis in die Haarspitzen hatte erschauern lassen.
»O, ich bin stark, HERR, ja, der Hauptmann bin ich!«
Haynz wagte sich einen Schritt weit in das Halbdunkel der Halle hinein. »Und ich möchte es doch so gerne lernen, HERR, ja, das möchte ich.«
»Na gut«, sagte ER. »Verschaffe er uns morgen zwei Frauen, die in der Liebe bewanderter sind als die kichernden Küken; eine morgens und eine abends. Und mit der Zweiten bringe man uns ein frisches Fass Coelsch. Dann werden wir über sein Ansinnen nachdenken.«
Das Herz des fetten Hauptmanns machte einen Sprung, und ER schritt in die alte Halle hinein.
So schnell seine kurzen Füße ihn trugen, rannte Haynz zu seinen Leuten zurück, zu seinem Volk von Dysdoor, wie er zu sagen pflegte. Sie knieten noch immer, starrten ihm aber neugierig entgegen statt zu beten. »In die Ruinen, los, los!«
Wieder irritierte Blicke; keiner außer dem Hauptmann wusste ja, was bevorstand. »Hört ihr nicht, was der gute Haynz sagt? Weg mit euch! In die Ruinen! Gleich geht‘s los! Hurtig!«
Schon erhob sich aus der DB-Ruine ein gewaltiges Röhren und Dröhnen. Viele Dysdoorer bekamen es derart mit der Angst, dass sie aufsprangen und statt in die nächstbeste Ruine Richtung Pfahldorf rannten. Ein paar auf der gerodeten und instandgesetzten Straße.
»Seid ihr denn besoffen?«, brüllte Haynz. »Runter von der Straße, sag ich! Rein in die Ruinen!«
Einige gehorchten, andere waren viel zu panisch. Der Lärm aus der Halle erreichte einen schier unerträglichen Pegel.
Haynz selbst und Arwyn, sein Adjutant, sprangen in eines der riesigen und nur noch teilweise verglasten Fenster. Dort wucherten Winden und Brennnesseln zwischen umgestürzten und bemoosten Nachbildungen menschlicher Körper. Haynz und Arwyn warfen sich auf die Bäuche und starrten hinüber zum Hallentor.
Seltsames grelles Licht erfüllte plötzlich das Innere der großen DB-Ruine, Rauch quoll heraus, und das Dröhnen und Röhren näherte sich rasch. Haynz und Arwyn pressten ihre Hände auf die Ohren.
Dann schoss ein eiserner Feuervogel aus der Halle, rauschte entlang der neuen Straße über den Platz und raste zwischen den alten Ruinen Richtung Fluss davon.
Haynz sprang aus dem großen Fenster, rannte zur gerodeten Straße, spähte dem Feuervogel hinterher. Es war der schönste aus seiner stattlichen Sammlung, ein Saab 40 Viggen. Und gleich würde er ihn zum ersten Mal fliegen sehen! Nur noch Umrisse hinter einer Feuerkugel konnte er erkennen, sein Gedröhne und überirdisches Gefauche erfüllte die Ruinen von Dysdoor.
Aus allen Löchern und Schlupfwinkeln kamen die Krieger und Weiber herbei geeilt. Sprachlos starrten sie die gerodete Straße hinunter. Das Dröhnen entfernte sich. »Boali!«, stöhnte ein Krieger namens Krautz. »Wohin geht ER?«
»ER geht nirgendwo hin, Taratzenkopf! Er fliegt wo hin!«
Das Dröhnen und Röhren näherte sich wieder, und auf einmal tauchte der Feuervogel über den Ruinendächern auf und brauste über den Platz. Alle warfen sich auf den Boden und schrien. Nur Haynz nicht – sehnsüchtig reckte er den Hals und sah den Feuervogel Richtung Mittag davonfliegen.
4

|

|


Chraaz, am 8. Tag des 2. Mondes des 508. Winters nach Alxanatan
Lange blieb es stumm, bis es im ersten Morgengrauen sein Brummen, Rasseln und Brüllen erneut erhob. Die Furcht schnürte Maris die Kehle zu. Doch das Ungeheuer entfernte sich rasch. Bald verlor sich sein Getöse Richtung Sonnenuntergang.
Doch noch nicht das Ende? Sollten sie noch einmal davon gekommen sein? Maris verbot sich die Hoffnung.
Der Regen nahm zu, wurde zur wahren Flut, als hätte sich der Höchste Sohn selbst des brennenden Klosters erbarmt und die Schleusen seines Himmels geöffnet. Das Feuer erlosch allmählich.
Maris kniete im Winkel zwischen Querholz und Kopfstamm. Der Regen drang längst durch ihren Mantel bis auf ihre Haut. Ihre Knie waren im morastigen Waldboden versunken. Ihr langes Haar klebte wie feuchtes Stroh an ihrem Kopf, in ihrem Pelz, auf ihren bleichen Wangen. Mit klammen Fingern hielt sie den Griff ihrer gegen das Querholz gestemmten Klinge umklammert. Hellwach spähte sie in den Regenschleier. Sie konnte das Ungetüm nirgends mehr sehen.
»Gerettet ...« Endlich konnte sie es fassen. »Dank dir, Höchster – wir sind gerettet!«
Im Buschwerk schlichen ein paar Gestalten zwischen den Hütten herum. Drei besonders Mutige pirschten sich an das Kloster heran. Über dem Gemäuer dort schwebten Rauchschwaden. Der Regen drückte sie auf Zinnen und Dächer herab.
»Dank dir, Höchster!« Maris senkte den Blick. Regen klatschte auf Fetzen geronnenen Blutes in den Augenhöhlen und zwischen den Zähnen der mater. Sie war tot, lange schon.
Hinter sich hörte Maris Atemzüge und Zähneklappern. Sie drehte sich um. Die sehnige Gestalt einer sehr jungen Schwester hockte hinter ihr am Ende des Längsstammes, blond und nass wie Maris selbst. Sie stützte ihre Stirn gegen den Knauf ihres in den Morast gebohrten Schwertes.
Maris musste lächeln. »Hast du mit mir gewacht, kleine Naryma?« Scheu lächelte die andere zurück. Sie nickte hinter ihrem Schwertknauf. Maris sah, dass die andere am ganzen Körper zitterte. Ihre Zähne schlugen gegeneinander. Gerade sechzehn Winter zählte Naryma; zum letzten Geburtsfest erst hatten die Schwestern sie in den innersten Zirkel des Ordens aufgenommen.
»Lass uns gehen und sehen, was es war, das uns heimsuchte.« Maris stand auf. »Lass uns gehen und dem Höchsten danken!« Ihre Glieder waren steif. Das Schwert über die Schulter gehievt, stelzte sie durchs Unterholz.
Naryma huschte an ihre Seite. »Es ist vorbei«, flüsterte sie.
»Was immer es gewesen ist, der Höchste Sohn hat es vertrieben.« Mit der Faust schlug sich das Mädchen gegen Stirn, Schultern und Brust und stieß gleichzeitig ihre Klinge nach oben ins regenschwere Geäst der Buchen.
Auf dem Prozessionspfad stapften sie dem nahen Waldrand entgegen. Unterholz und Bäume lichteten sich, die Umrisse erster Hütten schälten sich aus Halbdunkel und Regenschleiern.
Aus Erdlöchern voller Wasser und Schlamm krochen kahlköpfige ministratos. Einzelne Schwestern und ministricis kletterten von Bäumen und befreiten einander aus Gebüschen.
Als Maris und Naryma aus dem Wald traten, folgten ihnen bereits an die dreißig durchnässte und schlammverschmierte Männer und Frauen.
Maris blieb stehen und drehte sich nach ihnen um. »Was habt ihr hier zu schaffen?«, herrschte sie den Obersten der Kahlköpfe an. »Los, zum Kreuz. Bringt die mater zur Heiligen Gruft!« Und mit Blick auf die älteste der nackten ministricis sagte sie: »Überwacht sie. Bereitet alles für die Bestattung vor. Danach kommt zum Haus des Sohnes, auf dass wir dem Höchsten gemeinsam danken.«
Die Nackten und die Glatzen liefen in den Wald zurück. Nur vier Schwestern blieben bei Maris und Naryma. »Auf dass wir dem Höchsten gemeinsam danken«, echote eine von ihnen.
»Ja, om, ja, amen!«
5

|

|


Vorbei an Hütten, Äckern und Pfützen groß wie Teiche setzten sie ihren Weg zum Kloster fort. Hinter Rauchschwaden und Regenschleiern verwandelten sich gewaltige Schatten in Türme und Gemäuer. Wieder schlossen sich ihnen Frauen und Kinder und Glatzen an. Aus allen Richtungen spuckten Regen und Dunkelheit sie aus. Sie tuschelten miteinander: »Was war das? Woher kam es? Wohin ging es? Wer hat es gesehen?«
»Ein Drache«, sagte eine alte Schwester. »Es war ein Drache, ich schwör‘s.«
»Konntest du ihn von Nahem sehen?«, fragte Maris.
Die Alte blieb stumm, doch eine ministrice schlug sich an Stirn und Brust und rief: »Nix Drachen! Es waren die wilden Reiter aus dem Osten! Sie haben sich einen Wagen aus Eisen gebaut!«
»Einen Wagen, der Feuer husten kann?«, höhnte die alte Schwester.
»Wie sollten diese Hohlköpfe einen Wagen zustande bringen?«, widersprach auch einer der Glatzen, und andere behaupteten, sie hätten lucifa auf einem Höllenwurm reiten sehen. »Ja, lucifa höchstselbst!«, bestätigte Rimaya, und einige Glatzen brummten zustimmend: »Om, om, om!«
So ging das hin und her, bis alle vor einem verwüsteten Anwesen stehen blieben. Viel konnten sie nicht erkennen, dazu war es noch zu dunkel, aber jeder sah den niedergewalzten Zaun, die aufgewühlte Erde und die zersplittert in die Dämmerung ragenden Balken und Bretter zweier Holzhaufen, die vor Kurzem noch Menschen Dach und Zuflucht geboten hatten.
Das Palaver verstummte für ein paar Atemzüge; bis eine Frauenstimme zu flüstern begann. »Wer richtet solche Zerstörung an?« Wieder war es Rimayas Stimme. »Wer außer lucifa, frage ich euch?«
Aufs Neue wollte sich ängstliches Getuschel erheben.
Eine rasche Handbewegung Maris‘ brachte die Menge zum Schweigen. Die neue mater bückte sich, fuhr mit der Hand in die aufgewühlte Erde, versuchte zu verstehen. Zwei Furchen führten über den zermalmten Zaun in das verwüstete Anwesen; so tief und so breit, dass man den Leib selbst des fettesten ministras darin hätte versenken können. Zwei Speerlängen etwa lagen zwischen den Furchen.
»Der Höllenwagen hat alles umgepflügt«, sagte Naryma mit erstickter Stimme. »Den Zaun, den Acker, die Hütten ...« Auf der anderen Seite der Ruinen führten die Furchen wieder aus dem Grundstück hinaus und verloren sich Richtung Kloster im Morgengrauen.
Lichter von Öllampen näherten sich vom zerstörten Klostertor her. Drei Schwestern hatten sich aus ihren Verstecken gewagt. Maris, Naryma und Rimaya gingen ihnen entgegen. Greisinnen waren es, zu alt und gebrechlich, um noch an der jährlichen Schindungsprozession teilnehmen zu können.
»Sie haben jeden getötet, der sich ihnen in den Weg stellte«, sagte die zahnlose Karliam. »Jeden auch, den sie in seinem Unterschlupf aufstöberten. Sie haben die Vorratskeller geplündert.«
Karliam war die jüngste der drei Greisinnen. Riesig und feucht lagen ihre Augen in den Höhlen eines zerknitterten und grauen Gesichts.
»Pökelfleisch, Obst, Eingemachtes, getrockneten Fisch. Alles.« Sie schluckte und senkte den Blick. Leise, fast flüsternd fügte sie hinzu: »Und sie haben die Träne des Höchsten mitgenommen.«
Heißer Schrecken zuckte durch Maris‘ Glieder. »Das ist nicht wahr ...« Karliam starrte auf ihre knochigen grauen Füße.
Mit keiner Geste reagierte sie. Doch die anderen beiden nickten.
»Habt ihr sie gesehen?«, wollte Maris wissen. Ihre Stimme klang auf einmal sehr heiser.
Diesmal nickten alle drei. »Hoch gewachsene Leute«, sagte Karliam, ohne den Blick zu heben. »Drei oder vier, vielleicht auch mehr. Ihre Beine und ihre Rümpfe waren in dunklen Stoff aus einem Stück gehüllt. Einer trug einen gelben Anzug und einer einen Helm wie eine Kugel. Sie hatten Stäbe, damit versprühten sie Feuer, wie auch ihr Teufelswagen Feuer versprühen konnte.«
»Lucifa!« Rimaya stöhnte auf. »Lucifa und seine Dämonen! Sag ich‘s nicht? Wer sonst sollte die Träne Gottes ...«
»Still!«, zischte Maris. Sie rammte ihr Schwert zwischen ihre schmutzigen Füße, stützte sich auf den Knauf und sah die Greisinnen auffordernd an.
»Nichts weiter«, krächzte Karliam. »Sie schafften die Beute und sich selbst in ihren Teufelswagen und fuhren weg.« Die Alte drehte sich um und deutete über die Klostermauern hinweg Richtung Sonnenuntergang. Dahinter schälten sich die ersten Schneegipfel aus der Dämmerung. »Dorthin.«
Aus schmalen Augen blickte Maris durch Rauch- und Regenschleier zum Eisgebirge hin. Lange verharrte sie so, und ihre sonst so vollen Lippen waren blutleer wie ein Strich.
»Messe und Befragung im Haus des Sohnes«, sagte sie endlich.
»Gleich nach der Bestattung der mater. Wir müssen das Los werfen.«
6

|

|


London, Februar 2520
Am frühen Nachmittag erreichte er die erste Brückenruine im Süden der ehemaligen Metropole. Von den Lords hatte er sich gleich nach dem Essen verabschiedet. Da entfachten sie gerade ein Feuer, um den geschlachteten und bereits vom Bratspieß gepfählten Kwötschi über der Glut zu braten. Fanlur überließ ihnen, was er und Wulf von seinem Swaanenbraten übrig gelassen hatten.
Der Albino suchte einen Pfad, der zu der zerstörten Brücke hinauf führte. Er wollte einen Blick auf die Überreste Londons werfen, bevor er sich auf den Weg nach Westminster machte.
London hieß bei den Lords übrigens Landän.
Fanlur drang ein Stück in den Wald ein. Über die gut erhaltene Ruine einer Klinik gelangte er auf eine zugewucherte Straße, und von ihr aus zur Brückenruine.
Wulf lief ihm voran. Jedes Mal, wenn der Lupa eine Stelle fand, an welcher die uralte Fahrbahndecke zusammengebrochen war, stieß er ein heiseres Bellen aus, um seinen menschlichen Gefährten zu warnen.
Ungefähr fünfundsechzig Meter weit führte die Brücke auf die Themse hinaus, dann brach sie ab. Von feuchten Schlingpflanzen und Moos eingesponnene Pfeiler und Masten ragten hier und da wie die Reste eines Saurierskeletts aus dem Strom und verrieten den ehemaligen Verlauf der Brücke. Am anderen Ufer konnte Fanlur nur die frühlingsgrüne Wand des Waldes sehen.
Wenige Schritte vor der Bruchstelle ließ er sich auf den Boden nieder. Der Lupa setzte sich neben ihn. Richtung London war das Geländer auf halber Länge zusammengebrochen und der Albino konnte den Strom bis zur nächsten Biegung einblicken. Eine halbe Meile weiter lichtete sich der Wald schon, da und dort waren Ruinen zu erkennen, in der Ferne auch die der Tower Bridge. Kurz vor dem Knick und mitten auf dem Fluss schwamm ein dunkler Punkt. Ein Boot?
Gedankenverloren blickte Fanlur auf den Strom und über die Ruinen. So saß er oft – auf irgendeinem Baum, einem Turm, einer Uferböschung – und grübelte. Manchmal dachte er dann an jenen anderen Strom, den Großen Fluss, an dem er so viele Jahre seines Lebens verbracht hatte.
Der Punkt auf dem Wasser wurde zum Fleck. Tatsächlich, ein Boot. Es fuhr stromabwärts und würde die Brücke passieren, wenn es nicht zuvor wendete.
Eine merkwürdige Beklommenheit hatte sich auf Fanlurs Brust gelegt, seit Druud Alizan ihm eine Frau aus den Innereien des Kwötschis geweissagt hatte. Und das, nachdem er endlich akzeptiert hatte, dass er Marrela nicht für sich gewinnen konnte. Und nachdem er sich endlich mit Timothy Lennox versöhnt hatte.
»Blödsinn!«, schimpfte er mit sich selbst. »Hör endlich auf damit!« Der Lupa spitzte die Ohren. Aus schmalen Augen fixierte Fanlur das näher gleitende Boot. Er glaubte einen Mann darin zu erkennen. Und eine zweite Person – eine Frau vielleicht, oder ein Kind?
Fanlur seufzte. Nein, lange hielt er es nicht mehr aus in dieser Gegend der Welt. Das gezähmte Leben in den Communities ödete ihn an. Und die Lords? Nun ja, keine Leute, mit denen er unter einem Dach leben wollte. Er legte dem Lupa die Linke auf den Rücken und streichelte ihn. »Hast du auch manchmal Sehnsucht nach Honnes und Juppis und dem Dom? Vielleicht sollten wir einfach unsere Sachen packen und ...«
Er runzelte die Stirn. Tatsächlich: Eine Frau lag auf den Schenkeln des Mannes. Sie hatte keine Haare. Eine Frau aus der Community also? Und der Mann, er trug eine Brille ...
Fanlur drückte Wulf tief in das Gestrüpp, das auf der Brücke wucherte. Er selbst legte sich auf den Bauch. Keine Frage: Dave und Victoria! Ohne Hast stach Dave Mulroney das Paddel mal nach links, mal nach rechts ins Wasser. Er trug nur ein Hemd, Fanlur konnte seine nackten Knie sehen.
Das Boot glitt auf die Brücke zu. Schon hörte der Albino ihre Stimmen – sie turtelten und lachten leise –, und, bei Wudan: Die Queen trug nur eine blaue Decke; darunter war sie nackt!
Dave legte das Paddel hinter sich und beugte sich über die Queen. Dann verschwand das Boot unter der Brücke.
Fanlur drehte sich um. Bald tauchte der Kahn unter der anderen Brückenseite wieder auf. Dave machte Anstalten, zu Victoria unter die Decke zu kriechen. Die Queen lachte ihr dunkles Lachen, und das Boot begann mächtig zu schaukeln.
Nach und nach wurde es wieder zu einem Fleck auf dem Strom und bald zu einem Punkt.
Fanlur stand auf und spuckte aus. »Warum macht sie das?«
Wulf spitzte die Ohren und raunzte. »Sie liebt einen Mann, der sie nicht liebt, und tröstet sich mit einem anderen, den sie selbst nicht liebt.«
Während er hinunter ans Ufer kletterte, fragte er sich, ob auch er zu solchem Verhalten fähig wäre. Er wusste keine Antwort.
7

|

|


Coellen, etwa zur gleichen Zeit
Ein kleines Treppenhaus, dunkel, mit windschiefen Holzwänden. Die beiden Männer stiegen die letzten Stufen hinab und verharrten vor einer niedrigen Tür aus groben Holzbohlen.
Tones lauschte einen Augenblick ins Haus und zur Haustür hin, bevor er die Kellertür aufschloss. Manchmal kamen Bekannte herein, ohne zu klopfen. Musste aber keiner sehen, dass er mit Juppis in den Keller stieg, ging niemanden etwas an.
Keine Schritte auf der Gasse, also die Tür geöffnet und die schmale Stiege hinunter. Er hielt die Öllampe vor sich über die ausgetretenen Stufen. Der alte Juppis schloss die Tür hinter ihnen und folgte dem rotblonden Oberst der Stadtwache in seinen Keller hinunter. In einem Sack trug er ein sperriges Gefäß mit sich.
Unten angekommen, durchquerten sie einen relativ trockenen und großen Raum. Der Lichtschein fiel auf Regale voller Gläser mit eingemachten Früchten und auf Fässer mit Kraut und gesalzenem Fleisch. Was man in Coellen nach einem guten Sommer eben so in seinem Keller zu lagern pflegte.
Tones blieb vor einem schmalen Regal mit leeren Gläsern stehen und reichte Juppis die Lampe. Danach packte er das Regal und klappte es von der Wand weg. Dort war es mit zwei Scharnieren an der linken Seite im Holz befestigt. Die Gläser bewegten sich nicht, klirrten nicht einmal. Das zerfurchte Gesicht des alten Juppis legte sich in hundert weitere Falten – er grinste. »Festgeleimt«, sagte Tones.
Er schloss die niedrige Tür auf, die hinter dem Regal sichtbar geworden war. Sie bückten sich hinein und stiegen über sieben Steinstufen in einen uralten Gewölbekeller hinunter. Es roch nach Moder und nach Hopfen, und es war sehr kühl. Der Lampenschein fiel auf Röhren, riesige Flaschen und blank gescheuerte Kessel, so groß, dass man zwei Männer darin hätte ersäufen können. In einer Ecke standen halb gefüllte Säcke, bedeckt mit Spreu und Pflanzenfasern.
Wieder mussten sie sich bücken und gelangten so in einen zweiten, noch kälteren, noch tiefer gelegenen Keller. Tones hob die Lampe – die Umrisse dreier Fässer schälten sich aus dem Halbdunkeln. Sie ruhten auf Holzböcken; jedes fasste zweihundert Liter. »Alle drei voll?«, staunte Juppis.
»Nur eines.« Tones ging zu dem einzigen Fass, aus dem ein Zapfhahn ragte. Er stellte die Lampe darauf. »Und das hier ist halb voll.«
Juppis öffnete seinen Sack und holte eine Fünf-Liter-Milchkanne heraus. Er zog den Deckel ab und reichte sie dem Jüngeren. Tones stellte sie unter den Zapfhahn und drehte ihn auf. Duftendes Coelsch strömte schäumend in die Kanne.
Schweigend lauschten die Männer dem Rauschen des Bierstrahls. Der Duft des begehrten Flüssiggoldes hüllte sie ein. Hin und wieder drehte Tones den Hahn zu, wartete, bis der Schaum sich absenkte, drehte dann den Hahn wieder ein wenig auf.
Seit die Coelleni mit Unterstützung von Tinnox, Marrela und Fanlurs Rebellen das grausame Joch der Priesterschaft und der drei Klonmutanten abgeschüttelt hatten, war Coelsch in Coellen verboten. Klingt wie ein Witz, war aber so. Streng verboten sogar. Und doch war das gut so. Denn seitdem die Coelschmeister ihr altes, ehrbares Handwerk in den Untergrund verlegen mussten, konnten sie dreimal so viel für ein Maß verlangen wie vor der Revolution.
Der alte Juppis zahlte sogar das Vierfache. Immerhin war er stellvertretender Kanzler und brach ein Gesetz, das er selbst mit unterschrieben hatte. So was kostete halt.
»Wie viel?«, wollte Tones wissen.
»Voll«, sagte Juppis.
Plötzlich stutzten beide. Ein ungewöhnliches Geräusch näherte sich. Von draußen drang es durch Mauern und Decken nach hier unten. Da lärmte etwas über den Dächern! Es pfiff erst, heulte dann und dröhnte schließlich wie der unvergessene Herbstorkan, der zwölf Winter zuvor die Stadt und die Ufer des Großen Flusses verwüstet hatte. Die Männer sahen sich an, und jeder wusste, dass dem anderen die gleiche Erinnerung durch den Kopf schoss. Die Erinnerung an Tinnox und seinen Feuervogel!
Tones drehte den Hahn ab und stellte die Kanne auf den Boden. Sie rannten aus dem Gewölbe, hasteten durch den ersten Keller, stolperten die Treppe hinauf, stürzten auf die Straße.
Eine Menge Leute standen dort schon, legten die Köpfe in den Nacken und stierten in den Himmel. Einige gestikulierten, fast jeder rief irgendetwas. »Es ist wie damals!«, schrie ein junger Mann. »Wie damals, als Tinnox kam!«
Und wie zur Bestätigung röhrte auf einmal ein Feuervogel über die Dächer Richtung Dom, so schnell, dass man ihn kaum einen Atemzug lang zu sehen bekam, aber Tones befand dennoch, dass er Tinnox‘ Feuervogel verdammt ähnlich sah.
Er schloss sich der Menge an, die zum Domplatz rannte. Der Feuervogel flog eine Schleife um den Doppelturm und über die Stallungen und kehrte dann zu den Gassen, Hütten und Häusern zurück. Für Augenblicke konnte Tones seine Unterseite sehen, als der Vogel über ihn hinweg fauchte. Er sah verrostet aus, und an manchen Stellen waren Metallplatten eingefügt, die nicht verrostet oder von hellerer Farbe als die anderen Rumpfteile waren.
Auf einmal öffnete sich eine Klappe an der Unterseite, Geröll fiel aus dem Bauch des Feuervogels. Kurz darauf prasselten unzählige Steine auf eines der Dächer.
»Habt ihr das gesehen?«, brüllte ein kleinwüchsiger Mann namens Münges. »Er zerstört mein Dach! Orguudoo soll ihn holen!« Ein paar Steine schlugen zwischen den rennenden Menschen auf.
Während ein Aufschrei durch die Menge ging, die meisten sich zu Boden warfen und ihre Arme über den Köpfen verschränkten, bückte sich Münges nach einem der Steine, hob ihn auf und schleuderte ihn gen Himmel. Doch der Feuervogel flog viel zu hoch und verschwand auch im nächsten Augenblick wieder hinter den Dächern.
Die Leute erhoben sich, rannten los und setzten ihren Weg zum Domplatz fort. Dort blieb die Menge stehen und äugte in den Himmel. Das Dröhnen näherte sich wieder, Tones sah den Feuervogel über dem Großen Fluss nach Sonnenuntergang abdrehen. Er zog einen kerzengeraden Nebelschweif hinter sich her, und etwas an seiner Rückseite glühte. »Er kommt zurück!«, schrie Juppis.
Tatsächlich zog der Feuervogel nur eine weite Kurve und nahm anschließend wieder Kurs auf Fluss und Stadt. Als er den Dom erneut ansteuerte, flog er so tief, dass man meinte, er würde jeden Augenblick die Dächer streifen. Und schon wieder ging eine Klappe an seiner Unterseite auf – diesmal fiel ein ziemlich großer Felsbrocken heraus, stürzte auf das Dach eines Hauses und durchschlug es glatt.
Ein Aufschrei ging durch die Menge, die Leute rannten auseinander, viele stolperten, und schon wieder war das röhrende Ungeheuer aus Eisen über ihnen.
Diesmal sah Tones nicht, wie sich die Klappe öffnete, er hatte genug damit zu tun, seinen Weg und die Treppen und seine Beine im Auge zu behalten. Doch auf einmal klatschte es hinter ihm, als hätte jemand mit Wasser gefüllte Wisaaublasen vom Dom geworfen. Flüssigkeit spritzte ihm in den Nacken.
Er warf sich zu Boden, drehte sich um. Der Feuervogel röhrte über die Stallungen hinweg, raste erneut über den Fluss und entfernte sich diesmal Richtung Mitternacht.
Richtung Dysdoor, schoss es Tones durch den Kopf, Er rümpfte die Nase. Es stank fürchterlich. Auf dem Domplatz erhoben sich Männer, Frauen und Kinder; auch der alte Juppis war unter ihnen. Sie sahen an sich herab. Einige fingen an zu fluchen.
Es stank nach Gülle und verfaultem Fisch!
Tones konnte es nicht glauben, nur riechen konnte er es. Er rappelte sich auf. Während er zurück zum Dom stolperte, hielt er sich die Nase zu. Pfützen brauner Brühe breiteten sich auf der Domplatte aus. Eine Frau wrang ihr Kleid aus. Zwischen den Pfützen lagen vergammelte Fische, und Dreckklumpen jener Art, wie man sie normalerweise zusammen mit der braunen Brühe auf Äcker oder in bestimmte Gruben leert.
8

|

|


London, etwa zur gleichen Zeit
Früher war alles still gewesen, wenn man durch die Ruinen Westminsters ging. Vor vier Jahren zum Beispiel, als er zum ersten Mal nach so langer Zeit wieder nach London gekommen war – hatte er da etwas anderes gehört als das Heulen des Windes in den Ruinen und das Gezwitscher der Vögel in Birken und Gebüsch? Nein. Aber jetzt hörte man von allen Seiten Hammerschläge, Bohrmaschinen, Motorsägen, Rufe und das Quietschen von Stahlseilwinden. Schluss mit der Stille.
Westminster wollten die Communities als ersten Stadtteil wieder aufbauen. Und bei den Houses of Parliament hatten sie angefangen. Ein Gerüst aus Kunstglas rankte sich statt Efeu um Big Ben. Gerüste überall, und Menschen – Technos ohne Schutzanzüge und Lords –, und überall Maschinen. Kräne, Sägen, Kompressoren für Presslufthämmer, kleine Gabelstapler. Zwei EWATs hatten die Londoner zu Kombiraupen umgebaut. Sie konnten für Erdarbeiten und zu Transportzwecken benutzt werden.
Fanlur betrachtete die Baustellen, die er durch die Lücken in der Hallenmauer sehen konnte. Er staunte, wie schnell sich alles verändern konnte und wie schnell man sich daran gewöhnte! Der Lupa schnüffelte an einem Stromgenerator herum. Mit angelegten Ohren wich er zurück, als wenige Schritte entfernt ein Lord eine Kreissäge einschaltete.
An Stapeln zugeschnittenen Holzes und Kunstglasträgern vorbei schlenderte Fanlur durch die Westminsterhall, als der T-Rechner in der Brusttasche seiner Lederweste vibrierte. Hier, wo auch das Hauptschott in die unterirdische Bunkerstadt lag, waren die kleineren Anbauten schon fertiggestellt; sogar ihre Dächer waren gedeckt und ihre Fenster verglast. In der Haupthalle schickten die Technos sich eben an, die teilweise zerstörten Wände und den gewaltigen Dachstuhl neu hochzuziehen.
Fanlur kramte den T-Rechner aus der Tasche – das Symbol der Zentral-Helix von Salisbury war auf dem kleinen Display: eine stilisierte Grafik von Stonehenge. Sein Vater versuchte ihn zu erreichen. Seit sie ein ISS-Funkrelais in die Mini-Computer einbauten, war dies auch bei der allgegenwärtigen CF-Strahlung möglich.
Fanlur setzte sich auf einen Bretterstapel und aktivierte den Hauptempfänger. Auf dem Display erschien das harte und ernste Gesicht eines Mannes, ein hellhäutiges Gesicht voller Furchen. Der Schädel war kahl. Sir Leonard Gabriel, Prime der Community Salisbury und Fanlurs Vater. »Ich hab Neuigkeiten für dich, mein Sohn.«
»Guten Tag, Vater. Lass hören.«
»Seit Wochen durchforsten wir die Datenbanken der Zentral-Helix in London nach Hinweisen auf festländische Bunkeranlagen. Jetzt haben wir welche gefunden. Es kann als sicher gelten, dass es irgendwo am Rhein zwischen Koblenz und Köln einen alten Bunker der deutschen Regierung gibt. Eine riesige Anlage, Tunnelsysteme von fast fünfzehn Meilen Länge und Platz für mehrere tausend Menschen.«
»Hinweise auf Überlebende?«
»Nicht viele, aber die Zentral-Helix hat eine Wahrscheinlichkeit von dreiundachtzig Prozent dafür errechnet, dass in diesem Bunker eine Kolonie überlebt hat. Eine Kolonie, die sich technisch und zivilisatorisch weiter entwickelt haben könnte.«
»Interessant. Und jetzt?« Fanlur war sicher, dass sein Vater ganz konkrete Absichten mit seinen Informationen verband.
»Nun, wenn das zutrifft, ist diese Bunkerkolonie als Bastion gegen die Yandamaaren unentbehrlich. Die Menschen dort brauchen Informationen, und vor allem brauchen sie das Serum. Sollten sie den Einschlag Alexander-Jonathans und die finsteren Jahre danach wirklich in ihrem Tunnelsystem überlebt haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass ihre Immunabwehr genauso desolat ist, wie unsere es war, bevor ihr uns das Weltrat-Serum gebracht habt. Um die Expansionspläne der Außerirdischen zu stoppen, brauchen wir gesunde und widerstandsfähige Menschen.«
Der Krieg ... manchmal vergaß Fanlur ihn einfach.
Nirgendwo Schlachtenlärm, nirgendwo feindliche Panzer oder Schiffe, nirgendwo Flüchtlinge. Und dennoch hatte der Krieg längst begonnen. Auch wenn der Feind sich noch nicht zeigte.
Nein, er konnte nicht kneifen, er durfte die Communities in dieser wichtigen Aufrüstungsphase nicht im Stich lassen.
»Wir sollten jemanden über den Kanal schicken und nach dem Bunker suchen lassen«, fuhr Sir Leonard fort. »Ich habe dich vorgeschlagen, weil du dich in der Gegend bestens auskennst; ich hoffe, damit ist dir geholfen. Sie werden dich wahrscheinlich noch heute fragen.«
Fanlur war so perplex, dass er vergaß sich zu verabschieden. Mit allem hatte er gerechnet, aber nicht mit einem legitimen Grund, von der Insel flüchten zu können. Er starrte auf das leere Display seines T-Rechners. Der Lupa stieß ihm die Schnauze gegen den Schenkel. Fanlur packte ihn an der Kehle. »Wir werden Coellen wiedersehen, alter Freund.«
9

|

|


Sie fragten ihn noch am gleichen Abend. Die Prime lud Fanlur zu einer Sitzung des Octaviats. Ein einziger Punkt stand auf der Tagesordnung: Fraglicher Bunker auf dem ehemaligen Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, irgendwo am Rand der Eifel wahrscheinlich.
Lady Warrington erklärte in etwa das Gleiche, was Fanlur schon von seinem Vater wusste, und kam danach sofort zur Sache: »Wir möchten Sie mit einem Beutel Serum und der Formel aufs Festland schicken, Fanlur von Salisbury, damit Sie den Bunker suchen und Kontakt mit den Einwohnern aufnehmen. Sind Sie bereit, diesen Auftrag anzunehmen?«
Er dachte an Coellen und an Honnes und Juppis, die alten Kampfgefährten, und er sagte: »Ja«. Und fügte hinzu: »Ich denke, wir sollten uns zu zweit auf den Weg machen. Dave ist sicher bereit, mich zu begleiten.«
»Professor Mulroney kann im Moment keinen Auftrag außerhalb Londons übernehmen«, entgegnete die Queen so rasch, als wäre sie auf diesen Wunsch vorbereitet gewesen. »Er wird hier gebraucht.« Das verhangene Lächeln in ihren Augen verriet Fanlur mehr als ihre glatten Worte. Sie hob bedauernd die Schultern. Bei Wudan, wie unschuldig sie blicken konnte!
Kann keinen Auftrag übernehmen ... Sie redete über die Verbündeten schon wie über Untergebene.
»So weit uns bekannt ist, verfügen Sie über sehr gute Beziehungen in Coellen.« Wieder dieses nebelhafte Lächeln.
Was steckte bloß hinter der Fassade dieser Frau? »Sicher wird man Ihnen dort helfen, den Bunker zu finden.«
»Sicher doch«, sagte Fanlur. Mehr nicht. Zum ersten Mal empfand er Verachtung für sie.
Als er nachts auf seinem Lager im SEF ( Septisch Externes Foyer) lag, fragte er sich allerdings, ob seiner Verachtung möglicherweise uneingestandener Neid zugrunde lag. Und während er in einen unruhigen Schlaf hinüberdämmerte, sah er den greisen Druud in seinem weißen Gewand und mit dem langen weißen Haar sich über die Innereien des Mammutfrosches beugen. Lassen Ganzmond veagehen. Noch voa de next wiast du de woom deines Lebens begegne ...
Am nächsten Morgen ging Fanlur zu dem alten Hangar, in dem er die Twilight Of The Gods untergestellt hatte, das Luftkissenboot, das er Professor Dr. Jacob Blythe einst abgenommen hatte. Er kletterte an Bord und machte eine Bestandsaufnahme aller Schäden, die ihm auffielen. Danach begann er mit den Reparaturarbeiten.
10

|

|


Chraaz, am 8. Tag des 2. Mondes des 508. Winters nach Alxanatan
Sämtliche Bewohner Mariaschnees drängten sich vor den Stufen zum Altarraum: zweiundsiebzig ministricis, knapp über hundert ministratos, dreiundvierzig greise Männer und Frauen, die zu alt waren für den Dienst an den Schwestern, und neunundsechzig Knaben und Mädchen unter zwölf Jahren. Sie hielten sich an den Händen, wiegten ihre Körper zum Trommelschlag, sangen die Verse der Vorsängerin nach.
Die ministratos trugen gelbe und rote Festgewänder, und ihr Oberster und seine beiden Stellvertreter hatten ihre Gottbilder mitgebracht. Nach jeder Wiederholung eines Gesangverses, während die Vorsängerin schon den nächsten Vers anstimmte, stemmten sie die Statuen über ihre Köpfe und riefen: »Om!«
Bis auf die Seitenaltäre und einige Statuen war das Haus des Sohnes leer. Niemand unter den Anwesenden war schon auf der Welt gewesen, als einer ihrer Vorfahren den Splitter der letzten Bank des Gestühls ins Herdfeuer geworfen hatte.
Die meisten der vierundzwanzig Schwestern standen breitbeinig und im Halbkreis um den Heiligen Tisch herum.
Die Klingen stützten sie zwischen ihre nackten Füße, und ihre gefalteten Hände ruhten auf den Knäufen. Die Trommlerin stand links des Altars neben der lebensgroßen Statue einer Frau, die ein nacktes Kind auf dem Arm hielt; die Vorsängerin an seiner rechten Seite neben einem ebenfalls lebensgroßen Glatzen-Gottbild, der Statue eines schlitzäugigen dicken Mannes, der auf gekreuzten Beinen hockte.
Maris hatte ihr Schwert auf den Heiligen Tisch gelegt, wandte ihm den Rücken zu und streckte die Arme zum Hochkreuz im Chorraum hinauf. Und vor dem Altar wartete Naryma mit dem schwarzen Schädel der letzten Äbtissin in den Händen. Die jeweils jüngste Schwester hatte das Los zu werfen.
»Gloriamitaba ...« Die Vorsängerin hob ihre Stimme. » ... bodisatwa sicutera svabhawikakay principio etnunc etsemper etinsaecula saeculorum etheruca! Heruca, heruca, amen et om et amen ...«
Während sie das Amen aushielt und ihre Stimme sich dabei in überirdische Höhen schraubte, schritt Naryma zum Heiligen Tisch, verschloss die untere Öffnung des schwarzen Schädels mit der flachen Hand, schüttelte ihn und hielt ihn mit ausgestrecktem Arm über ihren Kopf. Kaum verstummte das Amen, warfen sich die vor den Stufen Versammelten auf die Knie, und Naryma knallte den Schädel auf den Heiligen Tisch.
Danach hob sie ihn ein wenig an, sodass die Knöchelchen heraus- und auseinanderfallen konnten.
Vollkommene Stille trat ein. Maris ließ die Arme sinken, wandte sich um, betrachtete die vierundzwanzig Knöchelchen.
Es waren Handknochen der letzten Äbtissin, ein Ende rot bemalt, das andere schwarz. Aufmerksam studierte Maris, wie sie lagen; vor allem, wie viele rote Enden zum Hochkreuz zeigten.
Viele Atemzüge lang blieb die neue mater in den Anblick des Loses versunken. Endlich hob sie ihr Schwert und schlug gegen den Heiligen Tisch. »Es war ein Höllenwagen lucifas und ein Vorbote Alxanatans zugleich!«, rief sie. »Das Reich des Höchsten Sohnes ist in Gefahr! Er selbst sendet uns aus, den bösen Boten zu vernichten. Entweder wir töten die Räuber der Heiligen Träne, oder Alxanatan wird das Gericht des Höchsten erneut über uns hereinbrechen lassen. Gehen wir also. Amen.«
11

|

|


Coellen, im 2. Mond des 508. Winters nach Alxanatan
Von Sonnenuntergang bis kurz nach Mitternacht traten die Zeugen im Haus des Kanzlers vor dem Kanzler und dem Bürgerrat auf. Vier Männer und dreiunddreißig Frauen. Alle berichteten sie von dem ungeheuerlichen Ereignis, und jeder tat es auf seine Weise; die Frauen sehr wortreich. Die Erscheinung des Feuervogels erregte die Coelleni außerordentlich, und erregte weibliche Coelleni sind schwer wieder zum Schweigen zu bringen, wenn sie sich einmal heiß geredet haben.
So unterschiedlich die Zeugenaussagen bei oberflächlichem Hinhören klangen, der Kern, in dem sie übereinstimmten, ließ sich in zwei Sätzen zusammenfassen: Ein Feuervogel hatte die Stadt dreimal überflogen und mit Geröll, einem Felsbrocken und schließlich Gülle mit verfaultem Fisch bombardiert. Und: Der Feuervogel erinnerte entfernt an das Gerät, mit dem Dave Mulroney anderthalb Winter zuvor auf dem Großen Fluss, und sehr stark an jenes, mit dem Tinnox vier Winter zuvor auf der Brücke gelandet war, die man in Coellen den »Schwebenden Pfad« nannte.
Nun hatte jeder und jede berichtet, was er oder sie zu berichten hatte – manch eine noch ein wenig mehr –, und es war still geworden im Bürgersaal. Im Kamin prasselte das Feuer, manchmal hörte man Stiefelsohlen scharren und manchmal ein Rascheln, wenn einer der anwesenden Männer sich das Kinn unter dem Bart oder die Kopfhaut schabte.
Etwa fünfunddreißig Augenpaare richteten sich auf die drei Männer, die neben dem Kamin saßen: auf den Kanzler, seinen Stellvertreter und auf Honnes, den Britanier. Niemand in Coellen genoss mehr Ansehen als diese drei.
»Was sind das für Zeiten?«, sagte der greise Kanzler mehr zu sich selbst als zum Bürgerrat. »Bald zweiundachtzig Winter habe ich erlebt und achtundsiebzig davon einen Feuervogel nicht einmal vom Hörensagen gekannt!«
Jannes Attenau thronte in einem kunstvoll geschnitzten Lehnstuhl. Er war von hoher dünner Gestalt und in einen dunkelblauen Mantel gehüllt, den er fest um sich gezogen hatte, denn er fror meistens ein wenig. Altersflecken statt Haar bedeckten seinen schmalen Schädel. Der Patriarch hatte über Jahrzehnte den innerstädtischen Widerstand gegen die Tyrannei der Priesterschaft und der »Scheußlichen Drei« geleitet, während Honnes und Juppis den sogenannten »Streitern« angehörten, die das Terrorregime unter der Führung Fanlurs von außen bekämpft hatten.
»Und nun taucht in nur vier Wintern schon der dritte Feuervogel am Himmel über Coellen auf!« Jannes Attenau schüttelte den Kopf. »Was wollen die Götter uns damit sagen? Was steht uns bevor?«
»Lassen wir doch die Götter aus dem Spiel, verehrter Jannes«, sagte Juppis, Vorsitzender des Bürgerrates und Stellvertreter des Kanzlers. »Es war einer der Eisenvögel, die wir mit Dave Mulroney auf der großen Lichtung am anderen Flussufer unter dem Schnee gefunden haben. Flughafen nannte der Mann aus der Vergangenheit diesen Ort, wenn ich mich recht entsinne.« Seine grauen Augen glitzerten hellwach.
»Jeder weiß, dass Haynz von Dysdoor sich acht dieser Maschinen unter den Nagel gerissen hat. Sehen wir sie nicht jedes Mal, wenn wir auf dem Fluss an Dysdoor vorbeirudern?«
Juppis war weit über siebzig Jahre alt, verstand aber noch immer seine Waffen zu führen. Er trug graue Hosenkleider, eine braune Wildlederjacke und darüber eine rote Wolldecke.
Sein struppiger Bart bedeckte die obere Hälfte seiner Brust, und sein weißes Haar hing ihm zu einem dicken Zopf geflochten tief in den Rücken. Wie viele der Anwesenden und wie auch Honnes hatte der Alte sein Leben in den Uferwäldern des Großen Flusses verbracht und von dort gegen die Tyrannen gekämpft.
»An der Unterseite der Eisenvögel sah man rostige und geflickte Stellen«, fuhr er fort. »Das haben die meisten Zeugen berichtet. Es war eines von Haynz‘ Spielzeugen, glaubt mir. Ihm allein haben wir den Angriff zu verdanken. Die Frage ist nur, wie er das Ding zum Fliegen gebracht hat.«
Wieder herrschte Schweigen. Alle Augen hingen nun an dem dritten Mann neben dem Kamin, an Honnes dem Britanier. Die Coelleni hatten ihm erst das Amt eines Kriegsrates, dann das eines Botschafters und schließlich einen Stuhl im Rat angeboten. Honnes hatte alles abgelehnt.
Doch Jannes Attenau und Juppis wollten nicht auf seinen scharfen Verstand und seine Erfahrung verzichten. Darum überredeten sie Honnes immer wieder, an den Bürgerrats-Sitzungen teilzunehmen, wenn wichtige Entscheidungen anstanden. Selten ergriff er dann von sich aus das Wort, und auch heute brach er sein Schweigen erst, als der Kanzler ihm auffordernd zunickte.
»Juppis hat Recht«, sagte Honnes der Britanier. »Es war Haynz. Die Dysdoorer haben das Bündnis gebrochen.«
Der kahlköpfige Mann hatte ein Gesicht, das wie zerknautschtes Leder aussah. Ein zernarbtes Gesicht außerdem, die Lippen auffallend wulstig. Er trug einen Anzug aus braunen Lederschuppen und darüber einen braunen Wollmantel. Sein Schwert stemmte er zwischen den Knien auf den Boden.
Niemand außer Honnes durfte es wagen, in der Ratsversammlung eine Waffe zu tragen.
Wie alle Versammelten war auch er in Coellen geboren und keineswegs in Britana; fast siebzig Winter war das her. Doch Honnes hatte die ferne Insel gesehen und auf ihr mehr, als das Herz eines Mannes zu fassen vermochte: Mächtige Freunde Fanlurs, die in unbegreiflichen Städten unter der Erde lebten; die unbegreiflichen Waffen und Wagen, über die sie geboten; eine junge Frau ohne ein einziges Haar auf dem Kopf, die sie als Königin über sich duldeten; blutgierige Krüppel aus dem kalten Norden, die auf Dampfschiffen über die Küsten herfielen, weder Kind noch Weib schonten und dennoch vergeblich versucht hatten, Honnes‘ Leib und Seele zu zerbrechen.
In seltenen Stunden erzählte er von diesen Erlebnissen, und weil er all das und mehr gesehen und erlebt hatte, nannten sie ihn in Coellen den »Britanier«.
»Räubern sie nicht seit vier Monden wieder in unseren Jagdgründen und Gewässern?«, fuhr Honnes fort. »Und plünderten ihre Kinder und Frauen nicht im Herbst einen unserer Obsthaine? Hat Haynz unsere Schadensersatzforderungen etwa beglichen? Oder hat er sich je für den Diebstahl entschuldigt? Nein, hat er nicht. Das Bündnis mit den Dysdoorern ist das Leder nicht mehr wert, auf dem es geschrieben steht.«
»Was glaubst du, was der Hauptmann vorhat?«, fragte Münges, der dem Rat angehörte.
»Gib einem Narren einen Stein, und er schmeißt ein Fenster ein«, sagte Honnes. »Gib ihm Feuer, und er zündet ein Haus an. Gib ihm einen Eisenvogel, und er wird Tod und Zerstörung über eine ganze Stadt bringen.«
Die Ratsmitglieder tauschten betretene Blicke aus. Einige tuschelten, andere räusperten sich, viele scharrten unruhig mit den Füßen. »Du hast längst nachgedacht, Honnes«, sagte der Kanzler endlich. »Verrate uns, was du tun würdest.«
»Du wolltest wissen, was uns bevorsteht, Jannes«, sagte Honnes. »Ich habe eben gesagt, was uns bevorsteht, und ich sage weiter: Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Lasst uns schon morgen eine Abordnung zu Haynz schicken, um zu protestieren und auf das Bündnis zu pochen. Lasst uns aber gleichzeitig die besten Kundschafter nach Dysdoor schicken, während wir unsere Essen anfeuern und unsere Schmiede bis zum Ende des Mondes Tag und Nacht am Amboss stehen und Schwerter und Pfeilspitzen fertigen.«
12

|

|


Chraaz, am 8. Tag des 2. Mondes des 508. Winters nach Alxanatan
Kurz vor Sonnenuntergang führten die für die Stallung zuständigen ministratos sechsundzwanzig Frekkeuscher auf den Klosterhof, gesattelt und vollgepackt mit Proviant und Waffen. Alle Bewohner des Klosters und der Hütten vor seinen Mauern hatten sich im Hof versammelt. Es hatte aufgehört zu regnen.
Zwölf Schwestern hatte die neue mater für die gefährliche Mission berufen, unter ihnen auch ihre Lieblingsschwester, die junge Naryma. Maris selbst würde die Zwölf in den Kampf führen. Wie auch der Höchste Sohn selbst einst seine zwölf apostoli in den Kampf geführt hatte. Jede der Schwestern nahm einen ministratos als persönlichen Diener mit sich.
Maris befestigte das leichte Kreuz aus dem rechten Seitenschiff hinter ihrem Sattel. Sie hatten die Haut der mater daran aufgespannt. Danach schritt sie die Reihe der zwölf Schwestern ab.
Lederharnische bedeckten deren Oberkörper, gehörnte Schildplatten ihre Schultern und Rücken. Jede trug ein Langschwert in der Rückenscheide und ein Kurzschwert am Hüftgurt. Die Beine hatten sie sich mit Lederriemen umwickelt, und wie alle Schwestern des Ordens Mariaschnee – und wie schon die Alten – trugen sie kein Schuhwerk. Wen der Höchste aussandte, hatte barfuß zu gehen.
»In die Sättel!«, rief Maris. Die Schwestern und ihre ministratos kletterten auf die Frekkeuscher. Maris stellte sich neben ihr Fluginsekt. »Bringt die Standarte herbei!«, wandte sie sich an die Versammelten.
Zwei Schwestern trugen eine an einer Holzstange befestigte Tafel aus Flechtwerk herbei. Ein paar Schilder und Bruchteile waren an der Tafel befestigt. Schwarze Zeichen, die alljährlich zum Geburtsfest erneuert wurden, prangten auf den Schildern.
Die Schwestern reichten die Standarte der blonden Naryma hinauf. Die pflanzte die Tafel vor sich im Sattel auf, sodass jeder die Zeichen sehen konnte.
Nun trat die Vorsängerin vor Narymas Frekkeuscher. Nur wenige Schwestern des Ordens vermochten zu lesen oder gar alte Zeichen zu entziffern. Wer Vorsängerin werden wollte, musste diese Kunst erlernen, um die Texte der alten Schriften singen zu können. Die Vorsängerin hob an, die Heiligen Worte der Alten zu intonieren.
»Karmelitenkloster«, sang sie, und die Menge wiederholte andächtig: »Karmelitenkloster.«
Die Vorsängerin fixierte die Tafel mit den Zeichen. »Maria-Schnee!«, sang sie, und »Maria-Schnee!«, antwortete die Menge.
Was ein Kloster war, wusste jede und jeder, aber die meisten anderen Worte auf den Schildern verstand niemand; nicht einmal die Vorsängerin. Das war auch nicht nötig – heilige Worte mussten nicht verstanden werden, heilige Worte mussten wirkten. Und so sang die Vorsängerin jedes der Worte von der Heiligen Standarte, und die Menge wiederholte sie: Graz, Grabenstraße. Buddhistisches Zentrum She Drup Ling Graz. Gemeinnütziger Verein und Zur Förderung. Die Buchstaben der letzten beiden Heiligen Worte auf der Tafel waren teilweise zerstört und nur schwer zu entziffern, eigentlich überhaupt nicht. Doch viele Generationen von Vorsängerinnen hatten sie einander überliefert, sodass die Vorsängerin an jenem Abschiedsabend sie mehr oder weniger fehlerfrei singen konnte. Die Worte lauteten: Buddhistischer Werte.
Als die Sonne sank, ritt Maris an der Spitze von zwölf Schwestern und dreizehn ministratos aus dem Klosterhof. Ein Hautfetzen, der gestern noch ein Bein der mater umhüllt hatte, löste sich vom Kreuz hinter Maris Sattel und flatterte im Abendwind.
Die Frekkeuscher schwirrten mit den Flügeln, erhoben sich und sprangen über die Buchenwipfel hinweg Richtung Sonnenuntergang. Alle Bewohner von Mariaschnee sahen ihnen hinterher.
Bald schrumpfte die kleine Armee zu einem dunklen Fleck vor dem Abendrot zusammen, und der Fleck verschwamm schließlich mit den dämmergrauen Hängen des Eisgebirges und mit der Nacht.
13

|

|


Dysdoor, Anfang April 2520
Die Uferwälder des Großen Flusses glitten rechts und links vorbei. Es nieselte noch ein wenig, und die Luft außerhalb der Kommandobrücke war entsprechend feucht. Allerdings auch erstaunlich mild, viel milder als auf der britischen Insel.
Hin und wieder sah Fanlur Fischer und Jäger von Anlegestellen in den Wald flüchten, manchmal auch halbnackte Menschen unter den Vordächern ihrer Hütten oder an den Eingängen ihrer Zelte, die sich zu Boden warfen oder Zuflucht im Unterholz suchten, sobald sie das Luftkissenboot sahen. Nur wenige – meist Kinder – standen still, um das für sie fremdartige Gefährt genau zu beobachten. Einzelne wagten sich sogar bis ins Uferwasser, damit sie ja nichts versäumten.
Die seltenen und durchweg winzigen Siedlungen standen ufernah auf Rodungen, die jene postapokalyptischen Barbaren dem Urwald und den Ruinen abgetrotzt hatten.
Hin und wieder entdeckte der Albino Fabrikruinen – schwarzen Saurierskeletten gleich ragten sie aus dem Flusswald –, und zwei oder drei Mal glitten gekenterte und kieloben aus dem Wasser ragende Rostkähne vorbei, an deren Rümpfen sich Treibgut aus fünf Jahrhunderten gesammelt hatte.
Länger als vier Wochen hatten die Vorbereitungen der Reise in Anspruch genommen: Studium der alten Karten und Datenbanken, Auswahl und Beschaffung von Material und Proviant, und vor allem die Generalüberholung der Twilight Of The Gods. Seit Fanlur Blythes Boot übernommen hatte, seit drei Jahren also, hatte es über zehntausend Seemeilen zurückgelegt, ohne je gewartet worden zu sein.
Der Abschied von London war Fanlur schwer gefallen, und das hatte ihn überrascht. Mindestens so schwer wie der Abschied von Coellen dreieinhalb Jahre zuvor. Nicht einfach, seine Wurzeln an zwei so weit voneinander entfernten Orten zu wissen und zu spüren.
Wo gehöre ich eigentlich hin?
Es hatte geregnet, und eine Delegation der Communities war am Themseufer erschienen. Lady Josephine, die Prime von London, Valery Heath, Octavian für Außenbeziehungen, und natürlich Sir Leonard Gabriel, der Prime von Salisbury und Fanlurs Vater.
Auch Dave Mulroney war gekommen, um ihn zum Abschied zu umarmen. Das rechnete der Albino seinem Kampfgefährten hoch an. Der Astrophysiker gab Fanlur einen Koffer aus Kunstleder. »Ein medizinischer Notfallkoffer«, sagte er. »Mit schönem Gruß von Queen Victoria II.«
Die Heath ließ eine Kiste mit nagelneuen Bauwerkzeugen und zwei Ruderboote aus Leichtmetall an Bord schaffen – ein Geschenk der Community an die Kölner.
Josephine Warrington überreichte Fanlur das Serum persönlich – »nur wenn die Deutschen sich seiner würdig erweisen!«, musste sie zum hundertsten Mal betonen. Und sein Vater küsste ihn – das war schon seit Jahren nicht mehr vorgekommen – und umarmte ihn so heftig, als wolle er ihn gar nicht mehr loslassen.
Während der Abschiedszeremonie tauchte sogar noch Grandlord Paacival mit zwei Biglords am Ufer der Themse auf und überreichte Fanlur zwei gebratene und gepökelte Swaane als Wegzehrung.
Zehn Tage war das nun her, und immer wenn Fanlur daran zurückdachte, wurde ihm ganz wehmütig. Wie einen, der nie wieder zurückkehren sollte, hatten sie ihn verabschiedet. Ja, so empfand er es. Er ahnte ja nicht, wie nahe er damit der Wahrheit kam. Und vielleicht war es gut so, dass er es nicht ahnte ...
Fanlur blickte auf die Armaturen: Das Radar zeigte mehrere kleine Objekte in knapp zwei Meilen Entfernung an, die Infrarot-Ortung meldete zunehmende Konzentration von Wärmequellen am rechten Ufer in etwa der gleichen Entfernung. Schiffe flussaufwärts und eine größere Siedlung näherten sich. Die Ruinen Düsseldorfs; oder Dysdoor, wie ihre Bewohner sie heute nannten.
Knapp zwei Stunden noch bis nach Coellen.
Die Wasserstoffmotoren summten unter ihm im Rumpf.
Fanlur spürte es mehr, als dass er es hörte, denn vom Heck her dröhnten die beiden Luftpropeller. Die Twilight Of The Gods bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 46 Kilometer pro Stunde nach Süden. Bald konnte Fanlur die Flöße – es waren drei – und die Umrisse der großen Ufersiedlung mit bloßem Auge erkennen.
Er wandte sich um und blickte über die Sessellehne des Kommandantensitzes hinweg zur rückwärtigen Fensterfront hinaus: Auf dem Oberdeck lag Wulf und beschäftigte sich mit dem zweiten der beiden Swaane. Fanlur hatte es nicht über sich gebracht, das Gastgeschenk selbst zu verspeisen. Sicher – er hatte unter Barbaren und mit ihren Ernährungsgewohnheiten gelebt, aber die Art und Weise, wie die britanischen Lords schlachteten, brieten und aßen, war ihm doch eine Spur zu barbarisch. Wer wusste denn, ob sie das Fleisch nicht in einem Kessel eingesalzen hatten, in den vielleicht nur einen Tag zuvor Blut aus einer menschlichen Halsschlagader geflossen war?
Während die Pfahlbauten und Steinhäuser am Ufer und die Flöße auf dem Rhein größer und größer wurden, dachte der Albino an jenen Tag zurück, an dem er das Luftkissenboot zum ersten Mal betreten hatte. Es war der Tag, an dem er Marrela vor dem wahnsinnigen Jacob Blythe rettete, dem Professor aus der Vergangenheit.
Damals, in Plymouth, waren sie in Blythes Helikopter von der Twilight Of The Gods an die Südküste des ehemaligen Schweden geflohen; zu den Dreizehn Inseln, der Heimat Marrelas. Drei Jahre war das her, doch so farbig, so intensiv glühten die Bilder jener Zeit in seiner Erinnerung, dass es schmerzte: die Frauen aus Marrelas Volk, die blutrünstigen Nordmänner, der Kampf gegen den Izeekepir, die Eroberung der Twilight Of The Gods schließlich, danach die Reise über den Atlantik.
Und dann die Nacht auf Island. Jene eine Nacht, in der sein Leben an den Wendepunkt gelangte; die Nacht im Gemeinschaftsiglu der Isländer, die Nacht, in der er Marrela besaß, zum ersten und zum letzten Mal besessen hatte.
Wulfs Gebell riss Fanlur in die Gegenwart zurück. Deutlich konnte er jetzt die Menschen auf den Flößen erkennen.
Vorwiegend gelb gewandete Gestalten mit rußgeschwärzten Gesichtern. Nein, halt – eines war rot.
Dysdoorer also. Führten sie schon wieder Krieg? Fanlur atmete tief durch, verscheuchte die Wehmut. Der kleine rundliche Mann in Grün mit rot geschminktem Gesicht auf dem ersten Floß, das konnte nur einer sein: Haynz, der Hauptmann von Dysdoor. Wahrhaftig – in dieser Gegend der Welt gab es angenehmere Männer als Haynz. Und dennoch wurde es Fanlur warm ums Herz, als er den kleine Dicken erkannte.
Haynz ließ keine Seele an Dysdoor vorbeifahren, ohne sie zu schröpfen – oder sie zu grüßen, falls sie in der Überzahl und besser bewaffnet war als seine Bande. Trotzdem erstaunte Fanlur die Dreistigkeit, mit der die Dysdoorer ihre Flöße so dicht an die Twilight Of The Gods heransteuerten.
Ausgeschlossen, dass Haynz je zuvor so ein Fahrzeug gesehen hatte. Warum flößte es ihm keine Angst oder wenigstens Respekt ein?
Zwei-, höchstens dreihundert Meter waren die Flöße noch entfernt, die Siedlung nur unwesentlich weiter. In Ufernähe standen viele Hütten auf Pfählen, dahinter fast ausschließlich lange Flachbauten aus Holz. Nur wenige Steingebäude waren zu erkennen. Wie vertraut war Fanlur die Landungsstelle vor dem langgezogenen Gebäudekomplex! Wie vertraut ihr Zentrum, das aus einem klobigen zweistöckigen Steinhaus bestand. Und wie vertraut sogar der knapp dreißig Meter hohe Turm auf dem Haus mit der grünschwarzen Flagge auf seiner Spitze. »Palast« hieß dieser Komplex nach der Dysdoorer Sprachregelung.
Mit dem Flugzeug auf dem vielleicht acht Meter hohen Holzgerüst direkt vor dem zentralen Steingebäude begann das weniger Vertraute: Nicht mehr der stahlblaue Eisenvogel thronte dort, mit dem Tinnox und Marrela einst in Coellen gelandet waren, sondern eine uralte Spitfire, angerostet und hundertfach geflickt. Nun gut, von der Spitfire und ihrer Geschichte hatte Dave Mulroney ihm ausführlich erzählt; doch die sechs anderen Jets auf sechs weiteren Gerüsten rund um die Hauptmanns-Residenz waren Fanlur neu. Wo um alles in der Welt hatte das Fässchen diese Maschinen her?
Zwei der Flöße gingen jetzt auf Konfrontationskurs, und Fanlur blieb gar nichts anderes übrig, als Hubgebläse und Turbinen abzuschalten, wollte er sie nicht rammen. Seine Finger flogen über die Instrumentenkonsole. Das Geheul der Turbinen ebbte ab und verstummte, das Schiff senkte sich auf die Wasseroberfläche, die Wasserstoffmotoren summten im Leerlauf.
Die Leute des Hauptmanns manövrierten das erste Floß backbord an die Twilight Of The Gods heran. Ein Feldstecher baumelte um Haynz‘ Hals. Fanlur begriff: Durch das Gerät hatte der Hauptmann ihn erkannt. Daher also die Furchtlosigkeit, mit der er sich dem fremdartigen Schiff genähert hatte!
Der Lupa stand schon an der Dachreling und bellte zu den Dysdoorern hinunter. Fanlur verließ die Kommandobrücke.
Ein Pfiff durch die Zähne, und Wulf kehrte knurrend zu den Resten seines Mittagessens zurück.
»Hauptmann Haynz grüßt dich, Fanlur von Coellen!«, rief der Dicke. »Oder muss ich jetzt sagen: Fanlur von Britana? Kommst ja doch zurück! Schönes Bootchen haste da, bei Wudan, ein schönes Bootchen, sag ich!«
»Sei gegrüßt Hauptmann Haynz! Ja, ich kehre zurück.« Es war wie ein Déjà-vu-Erlebnis, und schlagartig fiel Fanlur ein, wie er mehr als drei Jahre zuvor in seinem kleinen Dampfer an Dysdoor vorbei getuckert und Haynz mit einigen Streitern auf den Fluss hinausgerudert war, um ihn zu verabschieden. Man weiß nie, ob man zurückkommt, hatte Fanlur damals gesagt.
Honnes war zurückgekehrt, und nun kehrte er selbst zurück.
Alle anderen, die damals mit ihm aufgebrochen waren, um den Kristall nach London zu bringen, waren im Kanonenfeuer der verfluchten Nordmänner gestorben.
»Schönes Bootchen«, wiederholte Haynz. »Kann sogar fliegen, hab‘s genau gesehen, ho, ho!« Er strich mit der Rechten über die Bordwand. »Kann es auch schießen?«
»Es fliegt nicht, es schwebt nur auf einem Luftpolster.«
»Und schießen?« In den schmalen Augen des Hauptmanns funkelte es. Fanlur schüttelte den Kopf. »Was willste dafür, Fanlur von Britana und Coellen? Sag dem guten Haynz einen Preis.«
»Das Schiff ist unverkäuflich«, entgegnete Fanlur knapp. »Und jetzt muss ich weiter.« Er drehte sich um und machte Anstalten, die Kommandobrücke zu betreten.
»Warte, geehrter Fanlur, nicht so hurtig!«, rief Haynz. »Hat er meine schöne Sammlung von Feuervögeln gesehen? Neun habe ich jetzt, neun Feuervögel, sag ich! Und alle gehören dem guten Hauptmann Haynz von Dysdoor! Jetzt du!«
Fanlur drehte sich um, beugte sich wieder über die Reling.
Er hatte nur sieben Flugzeuge gezählt. »Nicht schlecht«, sagte er. »Schade, dass man sie nicht mehr zum Fliegen bringen kann, was?«
»Oh, oh, geehrter Fanlur! Er weiß ja nicht, was Er da redet, überhaupt nicht weiß Er das!«
Fanlur musste schmunzeln. Der kleine Hauptmann sprach ihn in der dritten Person an; eine neue Nuance in der ohnehin geschraubten Ausdrucksweise des wunderlichen Fässchens.
»Ich schenke dir eins«, krähte Haynz. »Ich schenke Ihm einen Feuervogel, der fliegen kann, jawoll!« Der Hauptmann stemmte seine Fäustchen in die fetten Hüften. »Und Er schenkt mir dafür sein Bootchen!« Triumphierend blinzelte er zu Fanlur hinauf.
Der schüttelte den Kopf. »Ich brauche ein Wasserfahrzeug, keinen Flieger.« Fanlur winkte und griff nach der Klinke der Tür zur Kommandobrücke.
»Zwei!«, rief Haynz. »Zwei fliegende Feuervögel gegen ein klitzekleines Bootchen, das nur ein bisschen schweben kann!«
Der Lupa erhob sich von den Resten seines Swaans, schüttelte sein weißes Fell, lief zur Dachreling und knurrte hinunter zu den Dysdoorern. Fanlur grinste und stieß die Tür auf.
»Was ist, Fanlur von Coellen und Britana. Zwei Eisenvögel! Was ist? So einen Tausch wird Er niemals ...«
Eine Explosion im Uferwald riss Haynz die Worte von den Lippen. Fanlur war mit einem Satz zurück an der Reling, blickte hinüber zum Dysdoorer Ufer. Eine dunkle Rauchwolke stieg aus dem Wald hinter der Pfahlsiedlung und den wenigen Steinhäusern der Dysdoorer. »Was war das?«
»Was das war?« Haynz zuckte mit den Schultern und rieb sich gleichzeitig die Hände, als wären sie schmutzig. »Weiß ich‘s? Ein Gewitter wohl. Natürlich, doch, ein kleines Gewitterchen war das!«
Wieder ertönte eine Detonation am Rande der Ufersiedlung.
Menschen schrien, und eine zweite Rauchsäule stieg zwischen den Baumwipfeln auf. »Noch ein Gewitter, ts, ts ...« Haynz lächelte gequält. Mit einem Wink bedeutete er seinen Kriegern, das Floß Richtung Ufer zu steuern. »Hauptmann Haynz wünscht gute Fahrt!«
Aus schmalen Augen spähte Fanlur über die Dächer der Ufersiedlung. Schon wieder eine Explosion! Sprengstoff in unmittelbarer Nähe der Dysdoorer Behausungen? Und Haynz faselte etwas von Gewittern? Hier war was faul im Staate Doyzland!
Fanlur stürzte an die Instrumentenkonsole, warf Turbinen, Gebläse und Motor an und riss seine Laserpistole vom Wandhaken.
14

|

|


Darauf waren sie nicht vorbereitet gewesen.
Auf Dysdoorer in Kriegsbemalung, ja. Auf Dysdoorer, die sich prügeln wollten, auch. Sogar auf einen mysteriösen Verbündeten der Hohlköpfe um den Oberhohlkopf Haynz.
Aber nicht auf prall gefüllte Fischblasen mit glühenden und zischenden Schwänzchen, auf Fischblasen, die es plötzlich zerriss und die dann Blitz und Donner erzeugten! Dazu unbegreifliche Kräfte, die einem Schwert und Axt aus den Fäusten schlugen, die einen von den Füßen rissen und drei oder vier Schritte weiter ins Unterholz schleuderten.
Nein, darauf waren Juppis und Honnes und ihre Streiter nicht vorbereitet gewesen.
»Rückzug!«, brüllte Honnes. Drei seiner Streiter lagen am Waldrand vor der Dysdoorer Siedlung und rührten sich nicht mehr. Die unbegreifliche Kraft hatte sie gegen Bäume geschmettert oder in die Spieße ihrer Gefährten. »Rückzug!«
Keinen weiteren Streiter wollte Honnes dem Ungeheuerlichen aussetzen. Doch schon wieder flog eine gefüllte Fischblase, diesmal in eine Gruppe von Armbrustschützen. Ein Lichtblitz, ein Donnerschlag, und dann wirbelte ein junger Coelleni durch die Luft, schlug im Wurzelwerk einer Eiche auf und blieb reglos liegen. Dort, wo die Fischblase wie Blitz und Donner eingeschlagen war, brannte das Gestrüpp.
In panischer Flucht rannte die kleine Streitmacht aus Coellen in den Wald. Die schweren Äxte, mit denen sie die Gerüste hatten fällen wollen, auf denen Haynz‘ Feuervögel standen, ließen sie einfach fallen.
Plötzlich entdeckte Honnes Dysdoorer mit schwarzen Gesichtern im Geäst der Waldbäume. Sie schleuderten seiner Truppe mit Blitz und Donner gefüllte Fischblasen entgegen.
Wieder erzitterten Erde und Luft von gewaltigem Krachen, Blitze zuckten, Flammen loderten, Rauch stieg auf. »Zum Fluss!«, brüllte Honnes.
Der alte Juppis übernahm die Führung des Rückzugs, stürmte an der Spitze seiner Streiter dem Ufer entgegen. Er lief auf die Pfahlhütten am äußersten Rand der Siedlung zu. Mit was auch immer die Dysdoorer da um sich warfen – es zwischen ihre eigenen vier Wände zu schleudern würden sie nicht wagen.
Honnes begriff den Plan seines alten Kampfgenossen sofort.
Er blieb stehen und winkte die zumeist viel jüngeren Streiter an sich vorbei. Einige schleppten Verwundete mit sich. »Zu den Hütten am Ufer!«, schrie er. »Hinter Juppis her! Erobert ein Haus, bildet dort einen Verteidigungsring!«
Wie es allerdings danach weitergehen sollte, wusste er nicht. Aber eins nach dem anderen. Vielleicht konnte man Geiseln nehmen, vielleicht die Dysdoorer zu Verhandlungen bewegen.
Schon wieder flog eine der verdammten Fischblasen aus den Bäumen des Waldrands. In hohem Bogen trudelte sie durch die Luft und prallte knapp zwanzig Schritte hinter den letzten beiden Coelleni in einen Kohlacker. Honnes erkannte das Ratsmitglied Münges und Tones, den Oberst der Stadtwache.
»Zu Boden!«, brüllte er, während er sich fallen ließ. Kaum bohrte er die Stirn in den feuchten Dreck, da ertönte auch schon der nächste Donnerschlag, und ein Lichtblitz blendete seine Augen trotz geschlossener Lider. Fast gleichzeitig erhob sich das Triumphgeheul der Dysdoorer aus den Baumkronen und von der Pfahlbausiedlung her.
Bei allen Göttern – welch schreckliche Waffe hatte Orguudoo diesen Wakudahirnen aus seiner finsteren Tiefe heraus in die Hände gegeben? Der Donner, die Feuerblitze, die stoßartige Kraft – all das erinnerte Honnes an die Kanonen der verfluchten Nordmänner. Seine besten Streiter hatten sie einst in den Tod gerissen, und jetzt ...
Er sprang auf. Wut, Schrecken und Schmerz trieben ihm die Tränen in die Augen. Wie durch einen Schleier hindurch sah er Tones und Münges auf sich zu wanken. Der Kleinere stützte den verwundeten Stadtwachenoberst.
Sie leben, Wudan sei Dank!
Honnes stolperte den beiden entgegen, packte Tones am Arm, fasste ihn unter der Achsel. Der kräftige Mann blutete aus einer Kopfwunde, sein Lederpanzer war über der Hüfte aufgerissen. »Zur Pfahlsiedlung«, krächzte Honnes.
Zu seinem Entsetzen musste er sehen, dass eine Schar von etwa zwanzig Dysdoorern Juppis und seiner Truppe den Weg zu den Hütten und ans Ufer versperrte. Sie drohten mit Speeren und schwangen Äxte über ihren schwarz angemalten Kahlschädeln. Ihren untersetzten, stämmigen Anführer erkannte Honnes sofort: Gleemenz, der schieläugige Bruder des Dysdoorer Hauptmanns!
Honnes und Münges blieben stehen, hielten den torkelnden Tones fest, so gut sie konnten. Das Triumphgeheul hinten im Wald verstummte, und Honnes ahnte, was das bedeutete.
Münges wollte es genau wissen und blickte über die Schulter zurück.
»Runter! Sie schleudern gleich das nächste Feuer!«
Schon lagen sie wieder im Dreck. Doch statt Donner und Blitz erfüllte auf einmal ein anderes Geräusch die Luft: ein Rauschen wie von starkem Sturm. Honnes hielt den Atem an und starrte zur Pfahlsiedlung.