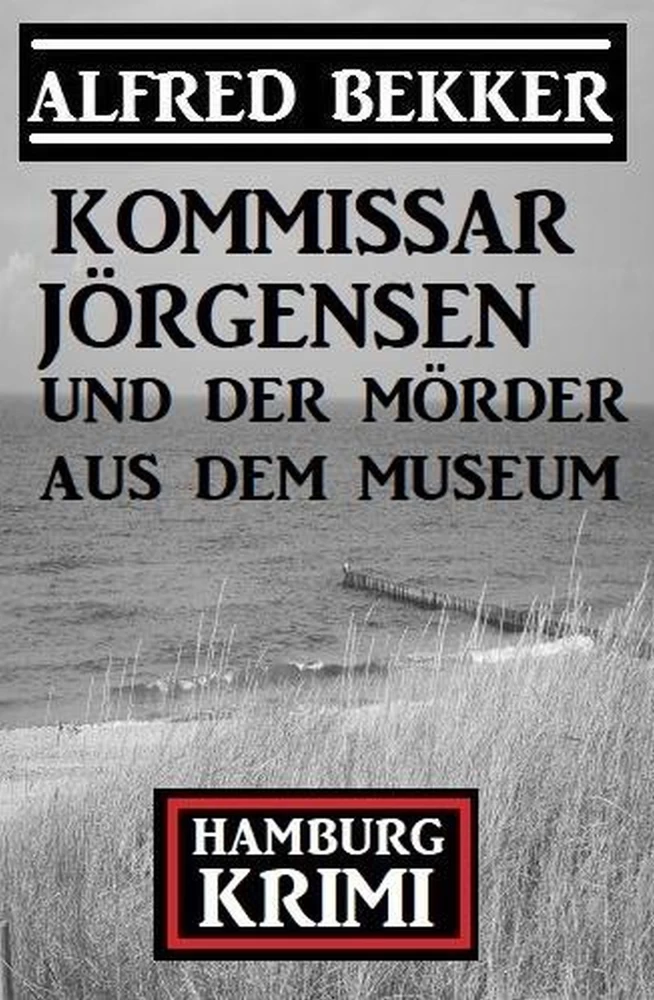Zusammenfassung
Kommissar Jörgensen und der Mörder aus dem Museum
Kurz vor dem Auslaufen eines Frachters gelingt es den Ermittlern nach einem Tipp, eine große Ladung an Waffen und Munition, die sich dort in Kisten und Containern befinden, zu beschlagnahmen. Gehofft hatten sie auch den Kapitän dort zu verhaften, um an die Hintermänner der Waffenlieferung zu kommen. Doch der und seine Mannschaft sind nicht an Bord.
Die Kriminalkommissare Jörgensen und Müller tappen im Dunkeln, als Personen, die sie für Verdächtige halten, ermordet werden. Aber dann erhalten sie einen entscheidenden Hinweis ...
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton Reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
 |  |

Copyright

Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
 |  |

Kommissar Jörgensen und der Mörder aus dem Museum

von Alfred Bekker
 |  |

1

Das Zoologische Museum in Hamburg ist einzigartig. Es beherbergt eine Vielzahl von Exponaten und ist eine echte Augenweide. Die Atmosphäre ist sehr angenehm. Die Sammlungen sind sehr umfangreich und interessant. Das Museum ist sehr gut besucht und es gibt immer wieder neue Dinge zu sehen.
Ich stand vor dem großen Gebäude und sah mich um. Die Straße war voller Menschen, die in alle Richtungen unterwegs waren. Vor mir ragte das zoologische Museum in die Höhe, ein riesiges, imposantes Gebäude mit vielen Fenstern. Ich ging näher heran und betrat es.
Im Innern des Museums war es ruhig und still. Die Wände waren mit bunten Tapeten bedeckt und an den Decken hingen Kronleuchter. In den Vitrinen lagen Knochen und Fossilien ausgestellt. Es gab auch Aquarien mit exotischen Fischen und Terrarien mit seltenen Tieren. In einem der Räume sah ich ein riesiges Skelett eines Blauwals, das mich beeindruckte.
Ich wanderte durch das Museum und bewunderte die vielfältige Sammlung an Tieren. Es war faszinierend zu sehen, wie viele verschiedene Arten von Lebewesen es auf der Erde gibt.
Dann stieß ich auf die präparierten Nashörner.
Die sahen mich an, als wollten sie gleich losstampfen und mich über den Haufen rennen.
Tote Nashörner, konserviert für die Ewigkeit.
Das alles ist jetzt viele Jahre her.
Ich war noch Schüler.
Und ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass ich genau diesen Nashörnern mal beruflich begegnen würde - als Verdächtige in einer Mordermittlung.
Mein Name ist Uwe Jörgensen. Ich bin Kriminalhauptkommissar und Teil einer in Hamburg angesiedelten Sonderabteilung, die den etwas umständlichen Namen ‘Kriminalpolizeiliche Ermittlungsgruppe des Bundes’ trägt und sich vor allem mit organisierter Kriminalität, Terrorismus und Serientätern befasst.
Die schweren Fälle eben.
Fälle, die zusätzliche Ressourcen und Fähigkeiten verlangen.
Zusammen mit meinem Kollegen Roy Müller tue ich mein Bestes, um Verbrechen aufzuklären und kriminelle Netzwerke zu zerschlagen. »Man kann nicht immer gewinnen«, pflegt Kriminaldirektor Bock oft zu sagen. Er ist der Chef unserer Sonderabteilung. Und leider hat er mit diesem Statement Recht.
*

»Zugriff!«, kam der Einsatzbefehl über das Headset.
Ich lief in geduckter Haltung aus meiner Deckung an der Ecke des Lagerhauses heraus und rannte über die Pier. Roy folgte mir. Wir trugen Kevlar-Westen und Einsatzjacken, die uns als Polizisten kenntlich machten.
Gut zwanzig Meter ohne Deckung waren es bis zum Liegeplatz der PANAMA STAR, eines Frachters, der unter irgendeiner Billigflagge fuhr. Ich sprang von der Kaimauer aus an Deck und lief mit der Dienstwaffe in der Faust in Richtung der Brücke.
Hinter einem der Aufbauten tauchte ein Mann in dunkler Lederjacke und Wollmütze auf. Er riss die Maschinenpistole vom Typ Uzi hoch, die er an einem Riemen über der Schulter trug. Er feuerte augenblicklich. Blutrot zuckte das Mündungsfeuer aus dem kurzen Lauf der Uzi hervor wie eine flammende Drachenzunge.
Ich feuerte ebenfalls, aber meine Kugel ging ins Nichts. Gleichzeitig spürte ich mindestens ein halbes Dutzend Einschläge auf meinem Oberkörper. Die Kugeln wurden zwar durch die Schutzweste aufgefangen und glücklicherweise war die Munition einer Uzi relativ kleinkalibrig – aber trotzdem kam jeder dieser Treffer einem mittleren Faustschlag gleich. Ich taumelte zurück.
Doch gleichzeitig wurde auch der Uzi-Schütze nach hinten gerissen. Seine Lederjacke hatte plötzlich ein großes Loch. Darunter kam graues Kevlar hervor, so wie wir es auch trugen. Unser Kollege Tobias Kronburg, der zusammen mit einem Dutzend weiterer Kriminalkommissare auf das Schiff zugestürmt war, hatte seine Waffe bereits in dem Moment abgefeuert, in dem der Kerl auf mich zu feuern begann.
Nur benutzte Tobias einen Revolver vom Kaliber 357 Magnum und obwohl der Uzi-Schütze ebenfalls durch eine kugelsichere Weste geschützt war, traf ihn dieser Schuss mit der Wucht eines Dampfhammers. Benommen rutschte er an der Wand der Schiffsaufbauten zu Boden, während ich nach Luft schnappte. Offenbar hatte ich außer den Treffern, die in meiner Weste gelandet waren, nichts abbekommen.
Roy überholte mich.
»Waffe weg, Polizei!«, rief er.
Der Uzi-Schütze umklammerte immer noch den Griff seiner Waffe, allerdings war er im Moment wohl nicht einmal in der Lage, um genügend Luft für einen klaren Gedanken zu holen.
Der Uzi-Schütze zögerte. Dann ließ er die Waffe los. Roy nahm sie ihm weg und legte ihm Handschellen an.
Unsere Kollegen Tobias Kronburg, Ludger Mathies und Mara Lauterbach waren inzwischen an Bord gekommen und schwärmten in verschiedene Richtungen aus.
»Alles in Ordnung, Uwe?«, fragte Roy.
»Außer ein paar blaue Flecken und zerfetzter Klamotten wird wohl nichts bleiben!«, meinte ich.
Ich setzte mich wieder in Bewegung. Inzwischen kümmerten sich zwei andere Kollegen um den festgenommenen Gefangenen. Mara Lauterbach und Ludger Mathies drangen zur Brücke des Frachters vor. Aber dort war zurzeit niemand.
Roy und ich folgten unterdessen Tobias Kronburg zur Einstiegsluke in den Hauptladeraum. Tobias riss sie auf. Eine Treppe führte hinunter. Roy ging als Erster. Ich folgte.
Zur gleichen Zeit drangen Kollegen von über drei weitere Luken ins Innere des Frachters vor. Gleichzeitig näherte sich ein Boot der Hafenpolizei, und ein Helikopter drehte seine Runden über der PANAMA STAR.
Wer sich jetzt an Bord des Schiffes befand, würde uns unweigerlich ins Netz laufen. Wir drängten uns zwischen Stapeln von Munitionskisten hindurch. Die Aufdrucke ließen keinen Zweifel am Inhalt. Ein Informant hatte uns über eine umfangreiche illegale Waffenlieferung informiert, die gerade im Begriff war, den Hamburger Hafen in Richtung irgendeines Spannungsgebietes zu verlassen. Deswegen waren wir hier. Neben hochmodernen Sturmgewehren und der dazugehörigen Munition sollten sich auch Luftabwehrraketen, moderne Panzerabwehrgeschosse und panzerbrechende Uran-Munition an Bord befinden. Zumindest war davon in der uns zugespielten Lieferliste dieses illegalen Deals die Rede. Ob sie den Tatsachen entsprach, würde sich zeigen, sobald wir die Kisten und Container an Bord geöffnet und überprüft hatten. Falls die Lieferung tatsächlich überwiegend aus Munition bestand, war das ein sehr bedenkliches Zeichen. Es bedeutete nämlich, dass die jeweiligen Abnehmer die dazugehörigen Waffen offenbar schon besaßen.
Aber mit dem illegalen Waffenhandel war es wie mit dem Rauschgift und anderen Zweigen des organisierten Verbrechens: Wir würden es wohl nie ganz schaffen, solche Aktivitäten vollkommen zu unterbinden. Aber gerade darum durfte man in dem täglichen Bemühen, sie wenigstens einzudämmen, nicht nachlassen.
Schüsse krachten plötzlich.
Irgendwo zwischen all den Kisten und Frachtstücken steckte ein Schütze, der mit einer automatischen Waffe mit rascher Schussfolge herumballerte. Querschläger irrten durch den Frachtraum. Hier und da blitzten Funken auf, wenn sie gegen Stahlträger kamen und dann auf eine unberechenbare Bahn geschickt wurden. Hier und da splitterte das Holz der Kisten durch diese Projektile auf.
Geduckt lief ich vorwärts. Meine Einsatzjacke und das Hemd, das ich darunter trug, hingen mir in Fetzen herab und ich spürte jetzt auch bei jedem Atemzug die Folgen der Projektileinschläge ins Kevlar. Es fühlte sich an, als hätte jemand wie ein Wahnsinniger auf meinem Brustkorb mit den Fäusten herumgetrommelt. Aber es hätte schlimmer kommen können. Der Uzi-Schütze war offenbar von unserem Zugriff letztlich doch so überrascht gewesen, dass er seine Waffe einfach draufgehalten und nicht etwa auf den Kopf gezielt hatte.
Wieder flogen jetzt Schüsse durch die Luft, von denen niemand sagen konnte, woher sie eigentlich kamen. Der Schütze feuerte einfach gegen die Stahlteile an der Decke des Frachtraum und sorgte dadurch für maximale Gefährdung seiner Verfolger.
Wie viele Personen sich noch an Bord aufhielten, war uns ohnehin nicht bekannt. Der Informant hatte nur von bewaffneter Bewachung gesprochen.
Zwischen zwei großen Frachtkisten fand ich ihn dann. Er hatte gerade die gesamte Ladung seiner Automatik leergeschossen und war jetzt im Begriff, ein neues Magazin in den Griff der Waffe hineinzuschieben.
»Waffe weg, Polizei!«, rief ich.
Ein Mann mit dunklem Oberlippenbart und großen, etwas hervortretenden Augen sah mich an und erstarrte mitten in der Bewegung. Er trug seine Baseballmütze mit dem Schirm nach hinten. Unter dem offenen Parka war die Kevlar-Weste deutlich zu sehen. Und außerdem trug er ein Headset – fast wie wir, nur dass sein Modell leichter und unscheinbarer war als die Dinger, die wir bei solchen Einsätzen benutzten.
Bei dem Kerl mit der Uzi war mir ein Headset nicht aufgefallen – was vielleicht dafür sprach, dass es noch mindestens eine Person geben musste, mit der der Mann mit dem Oberlippenbart über Funk in Kontakt stand.
Er bewegte sich nicht.
»Denken Sie nicht einmal daran, etwas Verkehrtes zu tun!«, warnte ich.
Er war klug genug, die Waffe und das Magazin sinken zu lassen. Unser Kollege Fred Rochow schob sich zwischen den eng beieinander stehenden Frachtkisten zu dem Kerl mit der Baseballmütze und legte ihm Handschellen an.
Ich nahm ihm das Headset ab und lauschte. Es war tot.
»Sie haben das Recht zu schweigen«, sagte Fred. »Sollten Sie auf dieses Recht verzichten, kann und wird alles, was Sie von nun an sagen ...«
In diesem Moment hörten wir einen heftigen Schusswechsel am anderen Ende des Frachtraums. Ein Schrei gellte.
»Was ist da los?«, fragte die Stimme unseres Kollegen Stefan Czerwinski über das Headset. Stefan hatte die Einsatzleitung. In unserem Präsidium war er der zweite Mann nach dem Chef.
»Hier Diethert. Ich habe einen Mann erschossen!«
Sören Diethert war ein junger Kollege, der frisch von der Polizeiakademie kam und noch nicht lange bei uns war. Die Art und Weise, wie seine Stimme über das Headset kam, ließ keinen Zweifel daran, dass er ziemlich mitgenommen war und vermutlich unter Schock stand.
»Der hatte eine Waffe in der Hand und auf mich gerichtet«, sagte Diethert.
»Bleiben Sie, wo Sie sind!«, antwortete Stefan. »Es ist gleich jemand bei Ihnen.«
»Hier Uwe!«, mischte ich mich in die Unterhaltung ein. »Trägt der Tote ein Headset?« Ich bekam zuerst keine Antwort. »Sören?«, hakte ich nach.
»Kein Headset«, lautete die Antwort.
 |  |

2

Für den Mann, den unser Kollege Sören Diethert erschossen hatte, konnte niemand mehr etwas tun. Der Spurenlage zufolge hatte er eine großkalibrige Automatik auf Sören gerichtet und der hatte geschossen. Er trug einen Führerschein bei sich, demzufolge er Edgar Soros hieß. Ob die Identität stimmte, würde sich erst noch herausstellen müssen. Draußen auf dem Pier fuhren mehrere unserer Einsatzfahrzeuge auf. Wir gaben die Daten, die wir über den Toten und die beiden Gefangenen ermitteln konnten, gleich in unserem Präsidium weiter, wo Max Warter und die Innendienst-Kollegen der Fahndungsabteilung sich darum kümmerten, sie mit unseren über das Datenverbund SIS zugänglichen Informationen abzugleichen.
Der Mann mit der Baseballmütze und der Automatik hieß Erik Tabbert. Zumindest besaß er unter diesem Namen einen Ausweis der Hafenarbeitergewerkschaft. Der Uzi-Schütze mit der Lederjacke, der mich mit dem Trommelfeuer seiner Maschinenpistole malträtiert hatte, trug Papiere bei sich, die ihn als Jay McCough auswiesen. Er besaß einen britischen, einen irischen und einen südafrikanischen Pass unter diesem Namen, wobei die Schreibweise von 'McCough' manchmal etwas abwich. In Großbritannien schrieb er sich 'MacCough'. Auch er hatte definitiv kein Headset bei sich getragen, was die Frage umso drängender werden ließ, mit wem Erik Tabbert wohl in Verbindung gestanden hatte.
Wir durchsuchten fieberhaft das ganze Schiff, aber außer den drei Männern war definitiv niemand an Bord. Inzwischen öffneten Kollegen die ersten Frachtkisten, um zumindest einen ungefähren Überblick darüber zu erhalten, was sich an Waffen und Munition an Bord befand.
Insgesamt entsprach es ungefähr der Frachtliste, die uns unser Informant zugespielt hatte. Die an Bord eingelagerte Munition reichte, um mehrere Wochen einen Kleinkrieg zu führen und dabei sogar mit Luftabwehrraketen und panzerbrechenden Geschossen gegen Flugzeuge und Panzer vorzugehen.
Unsere Erkennungsdienstler Frank Folder und Martin Horster trafen ein und Frank nahm sich das Headset wie das dazugehörige Mobilfunkgerät vor, das wir bei Erik Tabbert gefunden hatten. Der Mann mit dem Oberlippenbart schwieg beharrlich dazu, mit wem er damit in Verbindung gestanden hatte.
»Sie sollten jetzt reden, Herr Tabbert«, bemühte sich Roy vergeblich. »Jetzt ist Ihre Aussage noch etwas wert – wenn Sie erst so lange warten, bis wir jedes kleine Detail selbst herausbekommen haben, dann ist es zu spät und kein Staatsanwalt gibt Ihnen dann noch irgendwelchen Strafrabatt auf das, was Sie zu erwarten haben.«
Erik Tabbert grinste uns an.
»Na, dann sehen Sie mal zu, was Sie alles herausbekommen, ohne dass ich den Mund aufmache!«, meinte er. »Ich habe hier nur Wache gehalten und bin dafür bezahlt worden, aufzupassen, dass niemand Unbefugtes an Bord kommt – und ich wette, es wird Ihnen schwer fallen, mir vor Gericht irgendetwas anderes nachzuweisen.«
Er schien sich seiner Sache ziemlich sicher zu sein.
»Ich glaube, dass Sie Ihre Lage völlig falsch einschätzen«, meinte Roy.
»Ach, wirklich? Ich glaube, dass Sie Ihre Lage falsch einschätzen.« Erik Tabbert wandte den Kopf in meine Richtung. »Und insbesondere gilt das für Sie!«
»Für Sie Herr Jörgensen, so viel Zeit muss sein.«
»Ich werde aussagen, dass sich von euch niemand als Polizist zu erkennen gegeben hat, sondern dass Sie und Ihresgleichen stattdessen rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch gemacht haben.«
»Es ist Ihr gutes Recht, zu behaupten, was Sie wollen, Herr Tabbert«, erwiderte ich, obwohl mich Tabberts überhebliche Art innerlich zur Weißglut brachte. Wahrscheinlich glaubte er, dass die Hintermänner dieses Deals ihm einen guten Anwalt spendieren würden. Vermutlich hatte er sogar recht damit. Aber in diese Fall bedeutete das wohl kaum, dass er juristisch mit einem blauen Auge davon kam. Schließlich hatte er Polizisten beschossen – und Angriffe auf Polizisten wogen vor Gericht schwer. Anscheinend war ihm das allerdings noch nicht so richtig klar.
»Mit wem waren Sie in Verbindung?«, fragte ich. »Wenn Sie wirklich bei dieser Sache hier eine so harmlose Rolle gespielt haben, wie Sie uns gerade weiszumachen versucht haben, dass spricht doch nichts dagegen, dass Sie uns verraten, wer Ihnen über das Headset Anweisungen gegeben hat und wo wir denjenigen finden.«
»Ich sage gar nichts mehr ohne juristischen Beistand«, erklärte Tabbert.
»Und was ist mit dem Kapitän? Es war kein Kapitän und kein Offizier an Bord. Aber das Schiff sollte in zwei Stunden auslaufen. Wie ist das zu erklären?«
»Kein Kommentar.«
Vermutlich hatte der Kapitän irgendwo ruhig abgewartet und wäre mit seinen Schiffsoffizieren erst kurz vor dem Auslaufen an der Pier eingetroffen, während die untergeordneten Chargen die Drecksarbeit machen und ihren Kopf hinhalten mussten. Und genau so war es nun ja auch geschehen. Tabbert hatte Handschellen angelegt bekommen, McCough ebenfalls und der dritte Mann in diesem Wächter-Trio lebte nicht mehr.
»Es hat keinen Sinn, Uwe«, raunte Roy mir zu.
Vermutlich hatte er recht. Es war immer dasselbe. Leute wie Tabbert gingen lieber etwas länger in den Knast, als dass sie mit uns kooperiert hätten. Sie fürchteten einerseits den langen Arm des organisierten Verbrechens und andererseits verließen sie sich darauf, dass ihre Bosse sie rauspaukten. Oft genug klappte das auch.
Aber nicht in diesem Fall. Dafür, so hatten wir uns stillschweigend vorgenommen, würden wir mit allen zu Gebote stehenden Mitteln sorgen.
Wenig später, während die Gefangenen bereits abtransportiert wurden, sprach Frank Steinburg uns an. Dabei hielt er ein Gerät in der Hand, mit dem Tabberts Headset verbunden gewesen war.
»Tabbert hatte eine ganz normale Handyverbindung angewählt«, meinte Frank. »Soviel zumindest konnte ich herausfinden. Es gibt keine komplizierten Codes. Max hat den Geburtstag von Tabbert nachgesehen und siehe da, die Fantasie beim Einsatz von Passwörtern und Pin-Codes ist wie üblich sehr beschränkt.«
»Verstehe«, murmelte ich. »Weißt du irgendetwas über den anderen Gesprächsteilnehmer?«
»Nein – abgesehen von der Nummer, die er benutzte. Die gehört zu einem Wegwerfhandy. Man könnte herausfinden, innerhalb welcher Funkzelle es zuletzt benutzt wurde, aber bis wir die Daten haben, ist der Besitzer des Gerätes längst über alle Berge.«
»Es könnte sich um den Kapitän handeln«, meinte Roy. »Der ist bislang hier nicht aufgetaucht und wahrscheinlich wird er das auch nicht mehr, weil er gewarnt wurde.«
Als Kapitän des Schiffes war ein gewisser Lutz Gattmann eingetragen. Sein gegenwärtiger Aufenthaltsort war nicht bekannt. Dasselbe galt für seine Crew. Eigentlich hatten wir gehofft, Gattmann bei unserem Zugriff festnehmen zu können. In diesem Punkt hatten wir uns verrechnet.
Ich nahm mein Handy und telefonierte mit Max Warter aus unserer Fahndungsabteilung.
»Wir suchen Lutz Gattmann, den Kapitän der PANAMA STAR und seine Crew, die uns leider nur zum Teil namentlich bekannt ist. An Bord waren nur die drei Wachhunde, deren Daten ihr bereits habt.«
»Aber das Schiff sollte doch in Kürze auslaufen?«
»Die Formalitäten waren wohl schon erledigt und es war anscheinend so geplant, dass die Crew erst in allerletzter Minute zum Schiff kommt.«
»Dann werden wir am besten die Hotels im Umkreis der Pier systematisch telefonisch abfragen und dann den Radius erweitern«, schlug Max vor. »Ich hätte an Stelle des Kapitäns auch eine enge Schiffskabine mit einem Hotelzimmer vertauscht.«
»Wir werden schon herauskriegen, wo der Kapitän steckt«, war ich zuversichtlich. »Was ist mit den drei Männern, die an Bord waren – gibt es über die irgendwelche Erkenntnisse?«
»Erik Tabbert, Jay McCough und Edgar Soros haben alle ein langes Vorstrafenregister. Körperverletzung, illegaler Waffenbesitz und dergleichen mehr. Und sie haben alle drei mehr oder weniger starke Verbindungen zu einem dubiosen Im- und Export-Kaufmann namens Gregor Tempel, dem Besitzer von TEMPEL GmbH. Da liefen in der Vergangenheit einige Verfahren wegen illegaler Waffen- und Technologie-Exporte. Außerdem ging es um die verbotene Einfuhr exotischer Tiere, Kunstgegenstände und so weiter.«
»Das heißt, dieser Tempel handelt mit allem, was gut, teuer und verboten ist«, stellte ich fest.
»Auf diesen Nenner kann man es bringen, Uwe.«
»Worin bestand die Verbindung der drei Typen, die auf dem Schiff waren, zu Tempel?«
»Sie waren zu unterschiedlichen Zeiten bei ihm angestellt. Und vor drei Jahren ist Tempels Teilhaber Rex Dobahn unter mysteriösen und bis heute ungeklärten Umständen getötet worden. Erik Tabbert, Jay McCough und Edgar Soros wurden damals von der zuständigen Mordkommission als Verdächtige verhört worden.«
»Aber da war nichts dran?«
»Offenbar konnte der Verdacht nicht erhärtet werden. Die drei hatten Alibis, die nicht zu widerlegen waren. Aber du weißt ja, wie so etwas geht. Da ist vielleicht auch nur jemand um einen Gefallen gebeten worden und hat die drei dann in irgendeiner Bar die ganze Nacht gesehen, die dann zufällig einem Geschäftsfreund von Tempel gehörte – oder so ähnlich.«
»Vielleicht müssen wir das jetzt noch mal unter die Lupe nehmen.«
»Ein Kollege ist schon dabei«, versprach Max.
»Es würde mich interessieren, ob es auch zwischen dem Kapitän des Schiffes und Tempel eine Verbindung gibt.«
»Ich hatte noch keine Zeit, das ausreichend zu überprüfen«, erklärte Max. »Aber Jens-Dietrich hat herausgefunden, dass die panamaische Reederei, in deren Besitz die PANAMA STAR fährt, zumindest teilweise Tempel gehört. Er hat auf jeden Fall über eine Tarnfirma auf den Cayman-Islands seine Finger drin.«
Bei dem erwähnten Jens-Dietrich handelte es sich um unseren Kollegen Jens-Dietrich Richartz, unseren Fachmann für betriebswirtschaftliche Fragen. Kollegen wie er halfen uns dabei, den verbotenen Geldströmen zu folgen, die das organisierte Verbrechen hinterließ. Folgte man diesen Strömen, fand man fast immer auch die eigentlichen Hintermänner.
Ob man sie dann auch juristisch zur Verantwortung ziehen konnte, war natürlich eine zweite Frage.
 |  |

3

Wir statteten Gregor Tempels Firma TEMPEL GmbH. einen Besuch ab. Diese Im- und Exportfirma hatte in den letzten zehn Jahren mindestens so oft ihren Namen wie ihren Standort gewechselt und hatte außerdem eine äußerst undurchsichtige Struktur, was die Besitzverhältnisse anging. Es gab da offenbar ein paar stille Teilhaber, die über Beteiligungen an Briefkastenfirmen ihren Einfluss auf die Firma ausübten.
Bislang hatte weder unser Betriebswirtschaftler Jens-Dietrich Richard, noch die Kollegen der Steuerfahndung dieses Netz wirklich entwirren können. Darüber hinaus war an der Vita des größten Anteilseigners und Geschäftsführers Gregor Tempel noch bemerkenswert, dass er mit einer früheren Firma Bankrott gegangen war und deswegen eine Anklage wegen Konkursbetrugs am Hals gehabt hatte.
Er war allerdings mit einer vergleichsweise milden Bewährungsstrafe davongekommen. Es hatte offenbar eine Absprache mit der Staatsanwaltschaft gegeben.
Gregor Tempels Firma hatte ihren Hauptsitz seit kurzem in Geesthacht der Nähe der Elbe. Die Grundstückspreise waren dort für Gewerbeflächen sicherlich um einiges preisgünstiger als in Hamburg.
Auf dem in Sichtweite des Elbe befindlichen Geländes befanden sich mehrere Lagerhäuser und ein Gebäude, in dem die Büros untergebracht waren.
Unsere Kollegen Ludger Mathies und Tobias Kronburg begleiteten uns. Außerdem waren noch Erkennungsdienstler und Kollegen aus dem Innendienst dabei, denn wir hatten einen Durchsuchungsbefehl für sämtliche Firmenräume.
Nach den ersten Ermittlungsergebnissen war es für unseren Chef, Herrn Jonathan D. Bock, keine Schwierigkeit gewesen, dafür die nötigen Beschlüsse zu erwirken.
Unterstützt wurden wir von Beamten der Polizei, die dafür sorgten, dass nicht einmal mehr eine Maus das Firmengelände noch unkontrolliert hätte verlassen können.
»Sieht etwas heruntergekommen aus«, meinte Roy, während ich den Wagen vor das einstöckige Flachdach-Gebäude parkte, in dem die Firmenbüros untergebracht waren.
Eine Reihe von alten PKWs der Marke Mercedes befand sich im hinteren Teil des Geländes. Alles Limousinen, alle ohne Nummernschild und alle schon etwas rostig.
»Ich weiß nicht, wohin Tempel diese Rostlauben da vorne verticken will, aber für mich sieht das ganz und gar nicht nach einem wirklich lohnenden Geschäft aus.«
»Ist es vielleicht auch gar nicht«, meinte ich.
Roy drehte den Kopf in meine Richtung und hob die Augenbrauen.
»Du meinst, das alles hier ist nur Tarnung für Tempels eigentliche Geschäfte?«
»So könnte es sein.«
»Mal sehen, was Herr Tempel uns dazu sagt.«
Wir stiegen aus.
Während sich unsere Kollegen um die Lagerhäuser kümmerten und feststellten, ob dort jemand war, gingen Roy und ich geradewegs zum Eingang des Bürobungalows.
»Polizei. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss für das gesamte Firmengelände«, sagte ich, als sich an der Sprechanlage eine Frauenstimme meldete. »Machen Sie bitte die Tür auf, sonst müssen wir uns gewaltsam Zutritt verschaffen!«
Man ließ uns herein. Eine Frau mit brünetten, langen Haaren, schätzungsweise Ende zwanzig bis Anfang dreißig, kam uns entgegen. Sie trug Jeans und eine graue Jacke mit einem riesigen weißen Knopf, der irgendwie sofort die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zog.
»Uwe Jörgensen, Kriminalpolizei Hamburg. Dies ist mein Kollege Roy Müller.«
»Kriminalpolizei Hamburg. Was machen Sie denn hier in Geesthacht?«, fragte die junge Frau.
»Erstens gehört Geesthacht zu unserem Einsatzgebiet und zweitens wohnt Herr Tempel immer noch in Hamburg. Übrigens wird seine Privatwohnung im Moment auch gerade von Kollegen unter die Lupe genommen.«
»Was ist los? Wieder mal eine dieser Justizschikanen, mit denen Ihresgleichen unsere Firma schon seit Jahren verfolgt?«
»Wer sind Sie?«
»Diana Harm. Ich bin hier Traffic Manager. Früher nannte man das Sekretärin. Aber das klingt nicht so gut.«
»Wo ist Herr Tempel?«
»Ich habe keine Ahnung, Herr Jörgensen«, versicherte Diana Harm mir.
»Wer befindet sich derzeit noch im Haus?«
»Nur Herr Björn Schmitz, einer unserer Buchhalter.«
»Und in den Lagerhallen?«
»Niemand.«
»Sieht nicht gerade nach reger Geschäftstätigkeit aus.«
»Es ist eben mal mehr und mal weniger los.«
Ich ging an ihr vorbei, als ich aus einem der Büroräume ein Geräusch hörte. Türen gab es in dem Bürobungalow nicht. Ich war mit wenigen Schritten am Ende des Flures, folgte dem Geräusch in einen mittelgroßen Büroraum, der mit Schreibtischen und Regalen vollgestellt war. Die Computerbildschirme hatten XXL-Format und es gab außer einem Kopierer und der üblichen Büro-Elektronik auch einen Schredder, der offenbar gerade in Gebrauch war. Ein grauhaariger Mann mit breiten Schultern und streng wirkenden Hornbrille war damit beschäftigt, Papiere zu vernichten und ich hatte den Verdacht, dass er damit vermutlich erst angefangen hatte, als er uns auf das Firmengelände hatte fahren sehen.
»Schluss damit!«, rief ich und hielt ihm meinen Dienstausweis entgegen. »Hier wird kein einziges Blatt mehr in den Schredder gegeben.«
»Herr ... also ... ich ...«
Er stotterte etwas herum und brachte allerdings keinen verständlichen Satz zustande. Ich deutete auf die Klarsichthülle mit Dokumenten in seiner Hand, die wohl als Nächstes in den Schredder gewandert wären.
»Legen Sie das auf den Tisch!«
»In Ordnung«
»Sind Sie Schmitz?«
»Ja.«
»Wo ist Herr Tempel?«
Er wechselte einen Blick mit Diana Harm, die mir zusammen mit Roy gefolgt war.
»Er ist heute nicht gekommen«, sagte Schmitz. »Wir haben keine Ahnung, wo er sich befindet. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, aber er geht nicht an sein Handy.«
»Ich brauche die Nummer seines Mobiltelefons«, forderte ich. Vielleicht hatten wir Glück und konnten Tempels Aufenthaltsort mit Hilfe seines Mobiltelefons orten. Vorausgesetzt natürlich, er hatte es auch eingeschaltet.
 |  |

4

Ich gab die Handynummer an unser Präsidium weiter, nachdem Björn Schmitz sie mir mitgeteilt hatte.
Schmitz hatte inzwischen den Schredder abgeschaltet, so dass das nervtötende Surren, das dieses Gerät von sich gab, endlich nicht mehr zu hören war.
Roy deutete auf den Papierkorb, der zu einem Drittel mit dünnen Papierstreifen gefüllt war, zu dem das Gerät Dokumente aller Art verarbeitete.
»Ihr Chef scheint Ihnen ja eindeutige Anweisungen für den Fall gegeben zu haben, dass wir hier auftauchen.«
»Nein, das ist Unsinn. Wie hätte er das wissen sollen?«, gab Schmitz unsicher zurück und schob sich mit einer offenbar für ihn typischen Geste seine Brille die Nase empor. Es war bereits das dritte oder vierte Mal, dass er dies innerhalb der letzten Minute getan hatte. Irgendetwas schien ihn sehr nervös zu machen. Roy nahm die Klarsichthülle mit den Dokumenten an sich, die möglicherweise wichtiges Beweismaterial darstellte. Bevor er sich den Inhalt der Klarsichthülle ansah, streifte er sich vorschriftsmäßig ein paar Latexhandschuhe über.
»Vielleicht hatte Ihr Chef ja einen Grund, um zu befürchten, dass sich die Justiz möglicherweise für ihn interessiert«, gab ich zurück.
»Björn!«, wies ihn Diana Harm zurecht und ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht einen Fehler darstellte, dass die junge Frau bei Schmitz' Erstvernehmung anwesend war.
Als Björn Schmitz etwas sagen wollte, rief Diana Harm ihn noch einmal bei seinem Namen. »Wir sagen nichts, bis Herr Hoang hier ist.«
»Wer ist Herr Hoang, und weshalb kommt der jetzt her?«, hakte ich nach und wandte meine Aufmerksamkeit Diana Harm zu. Auch wenn sie offiziell nur 'Traffic Manager' war, sie schien einfach die stärkere Persönlichkeit zu sein und in diesem Büro einen sehr viel größeren Einfluss zu haben, als dieser Rang es vermuten ließ.
»Herr Hoang ist der Anwalt von Herrn Tempel und wir sollten am besten nichts sagen, so lange er nicht hier ist«, erklärte Diana Harm, während sie die Arme vor der Brust verschränkte. »Und er kommt her, weil ich ihn angerufen habe, kurz bevor Ihre Horde das Firmengelände gestürmt hat. Wir werden kein einziges Wort mehr von uns geben, bis Herr Hoang eintrifft.«
»Wie Sie wollen, aber ich glaube nicht, dass das besonders klug wäre«, gab ich zu bedenken.
Diana Harm verschränkte die Arme vor der Brust.
»Das gesetzlich verbrieftes Aussageverweigerungsrecht, festgeschrieben in der Strafprozessordnung, haben Sie doch noch nicht einfach außer Kraft gesetzt, oder?«, fragte sie mit schneidendem Unterton.
»Sie sind doch gar nicht verhaftet worden«, gab ich zu bedenken. »Und vielleicht haben Sie mit den illegalen Geschäften Ihres Chefs auch gar nicht so besonders viel zu tun, sondern hier nur ein paar Anrufe angenommen.«
»Wollen Sie mir jetzt schon einen Deal anbieten, bevor ich verhaftet bin?«, fragte sie und verzog spöttisch das Gesicht.
»Sagt Ihnen der Name PANAMA STAR etwas?«
»Heißt nicht ein Club auf St. Pauli so?«
»Es geht um ein Schiff und eine Ladung Waffen und Munition, die illegal aus dem Land geschafft werden sollten.«
»Tut mir leid, ich kann dazu nichts weiter sagen.«
»Wie lange arbeiten Sie hier schon?«
»Auch dazu mache ich keine Aussage.«
Mein Handy klingelte. Ich nahm das Gespräch entgegen. Es war Max Warter aus unserem Innendienst.
»Uwe?«
»Am Apparat.«
»Die Mobilfunknummer, die du durchgegeben hast, gehört zu einem Gerät, das noch eingeschaltet ist.«
»Konnte es geortet werden?«
»Allerdings. Und jetzt halt dich fest! Es muss sich auf dem Gelände von TEMPEL GmbH. befinden.«
»Wie bitte?«
»Du hast richtig gehört – und es gibt keinerlei Zweifel. Das Signal ist sehr gut zu lokalisieren. Übrigens, die Überprüfung von Tempels Privatwohnung war negativ. Stefan und Ollie waren dort und sind nur auf Tempels Lebensgefährtin getroffen.«
»Und ich wette, die hatte keine Ahnung, wo Tempel steckt!«
»Du sagst es!«
»Und irgendwelche Hinweise auf seine Geschäfte und die PANAMA STAR?«
»Unsere Leute stellen da alles auf den Kopf und untersuchen selbst den Speicher der Spielkonsole auf verdächtige Daten. Sobald sich da noch was ergibt, melde ich mich bei dir.«
Ich beendete das Gespräch und wandte mich noch einmal an Diana Harm und Björn Schmitz.
»Unsere Kollegen haben Herrn Tempels Mobiltelefon hier auf dem Firmengelände geordnet. Falls er sich also tatsächlich noch irgendwo auf dem Gelände verstecken sollte, dann sollten Sie es uns jetzt besser sagen.«
»Unseren bisherigen Aussagen gibt es nichts hinzuzufügen«, sagte Diana Harm abweisend. »Ansonsten wird Herr Hoang alle Fragen für seinen Mandanten beantworten.«
»Dazu wird er wohl auch nichts sagen können!«
»Das ist Ihr Pech!« Sie zuckte die Schultern.
Björn Schmitz schier sich sichtlich unwohl in seiner Haut zu fühlen. Er war erneut dabei, seine Brille auf der Nase hochzuschieben. Sie schien dort irgendwie nicht den nötigen Halt für eine stabile Position zu haben.
»Ist das auch Ihre Meinung, Herr Schmitz?«, mischte sich Roy ein, dem die Nervosität des Buchhalters offenbar auch aufgefallen war.
»Hören Sie, ich habe mit der ganzen Angelegenheit wirklich nichts zu tun. Ich rechne hier Zahlen zusammen und weiß von keiner PANAMA STAR und irgendeiner Munitionsladung.«
»Und Tempel?«
»Die Wahrheit ist, dass er eigentlich schon längst hätte hier sein müssen und wir uns auch schon gewundert haben, wieso er noch nicht aufgetaucht ist. Dass sein Handy hier irgendwo ist, kann ich mir nur so erklären, dass er es vergessen hat, obwohl ...« Björn Schmitz zögerte zunächst, bevor sein Wortfluss schließlich ganz abbrach.
»Obwohl was?«, hakte Roy nach.
»Björn, halt den Mund!«, fuhr Diana Harm dazwischen.
»Soll ich Sie vielleicht mal einen Augenblick hinaus begleiten und Sie in die Obhut unserer Kollegen übergeben?«, fragte ich.
Diana Harm lief dunkelrot an. In ihren Augen blitzte es ärgerlich.
»Sie können mich mal – aber glauben Sie nicht, dass das ohne rechtliche Folgen für Sie bleiben wird, Herr Jörgensen.«
Das Wort Herr betonte sie dabei auf eine Weise, die unmöglich freundlich gemeint sein konnte.
»Ich wollte nur sagen, dass Herr Tempel mit seinen Mobiltelefonen immer sehr eigen war«, meinte Schmitz. »Er hatte drei davon und wenn er mal wirklich eins davon liegengelassen hat, dann hat er Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um es wieder in seine Tasche zu bekommen. Fast so, als hinge sein Leben davon ab. Einmal hat er einen Flug nach Chicago gecancelt, nur weil er eines von den Dingern ausnahmsweise mal hier auf seinem Schreibtisch liegengelassen hatte.«
 |  |

5

Wir instruierten die Kollegen entsprechend, um auf dem Gelände nach Tempel zu suchen. Harm und Schmitz wurden von Kollegen der Polizei bewacht und hatten sich in der Kaffeeküche des Bürobungalows aufzuhalten. Schließlich wollten wir nicht, dass hier im letzten Moment noch irgendwelche Unterlagen vernichtet wurden. Andererseits erschien mir Björn Schmitz‘ Ahnungslosigkeit nicht gestellt zu sein. Er schien in Tempels Geschäfte tatsächlich kaum involviert zu sein und ich fürchtete schon, dass wir vermutlich bei der Durchsuchung der Firmenräume kaum brauchbare Beweise finden würden, die Tempel tatsächlich mit der PANAMA STAR und dem illegalen Waffenhandel in Verbindung bringen konnten.
Offenbar war Tempel ziemlich geschickt darin gewesen, eine überzeugende geschäftliche Fassade aufzubauen.
»In den Lagerhäusern war niemand«, berichtete uns Tobias Kronburg, als Roy und ich ins Freie traten. »Und wenn ihr mich fragt, dann war da auch schon lange niemand mehr. Ein paar staubbedeckte Fässer, Stapel mit Autoreifen und einige Stapel mit Kisten stehen da herum.«
»Mit was für einem Inhalt?«
»Wir sind noch nicht so ganz durch, aber es scheint sich um Restpostenware zu handeln. Spielzeug, Gartengeräte, Bleistifte, Scherzartikel – kurz gesagt, alles was nicht verrottet und billig ist.«
»Und was ist in den Fässern?«, hakte Roy nach.
»Gar nichts«, erklärte Tobias. »Die sind leer. Der Aufschrift und dem Geruch nach war da mal Salatöl drin.«
»Scheint ja wirklich ein richtiges Gemischtwarenlager zu sein«, mischte sich Roy ein. »Am besten Jens-Dietrich kümmert sich mal darum.«
Die vorrangige Frage war nun, wo sich Tempel selbst – beziehungsweise sein Handy – befanden. Jeder Quadratzentimeter des Geländes mussten wir jetzt noch einmal absuchen. Die Kollegen waren bereits dabei. Inzwischen hatten wir eine Signalpeilung, die auf vierzig Meter genau war. Das bedeutete, nur eines der Lagerhäuser kam als Quelle des Signals infrage. Das Gebäude war nicht unterkellert.
Als wir bereits auf dem Weg zu dem betreffenden Gebäude waren, fuhr eine Limousine auf das Firmengelände. Ein champagnerfarbener Mercedes.
Roy hatte unterdessen zum wiederholten Mal versucht, Tempels Handynummer anzurufen, denn eigentlich hätte das Gerät dann klingeln und einem unserer Kollegen auffallen müssen. Tat es aber nicht. Vielleicht war es auf stumm geschaltet. Oder es befand sich in einem schallisolierten Raum, von dem sich aber im Moment wohl niemand von uns vorstellen konnte, wo sich er befinden sollte.
Aus der Limousine stiegen einen Mann und eine Frau. Beide waren sehr gut gekleidet. Er trug einen tausend Euro-Maßanzug, sie ein Kostüm, das ihr auf den zierlichen Leib geschneidert war und ihre Figur zwar betonte, aber nicht billig wirkte. Beide hatten asiatische Gesichtszüge. Ich schätzte den Mann auf Mitte dreißig, die Frau auf höchstens dreißig. Das lange schwarzblaue Haar trug sie zu einer elegant wirkenden Hochfrisur aufgesteckt. In den Ohrläppchen steckten Diamanten und am Handgelenk des Mannes blitzte eine Rolex auf.
Er streckte mir die Hand entgegen.
»Cheng Hoang von Hoang, Dramann & McCoy.«
»Uwe Jörgensen, Polizei. Dies ist mein Kollege Roy Müller. Dann sind Sie Herr Tempels Anwalt?«
»So ist es. Ich wurde angerufen und bin so schnell wie möglich gekommen.«
Ich wandte mich an die Frau.
»Und wer sind Sie?« Meinem Gefühl nach war sie nämlich nicht Hoangs Mitarbeiterin. Zumindest nicht nur.
»Das ist meine Frau May«, erklärte Hoang. »Wir hatten eigentlich einen – wie soll ich sagen? - familiären Termin.«