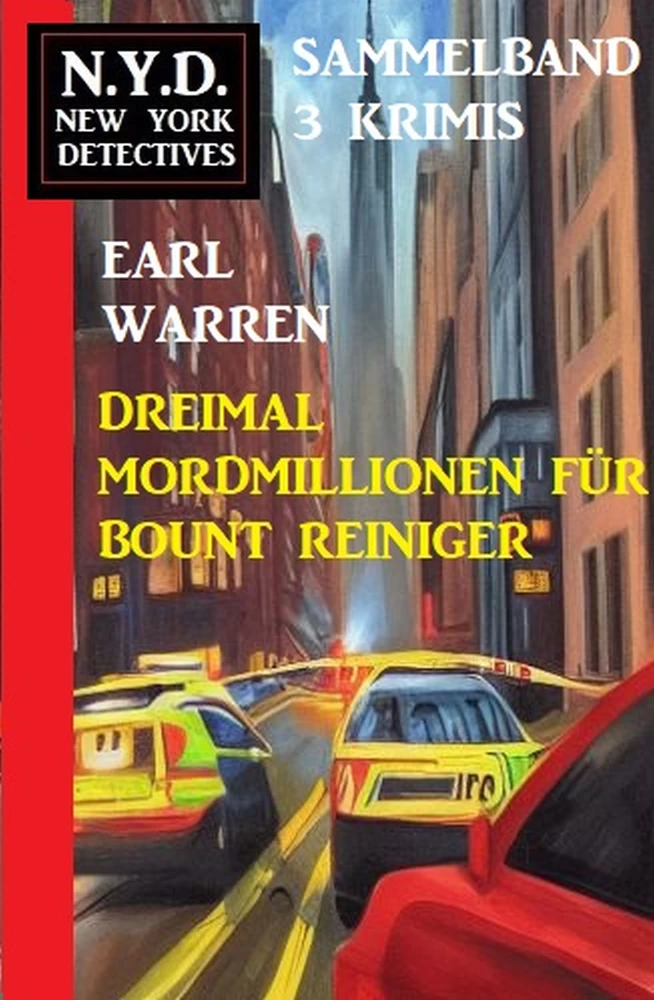Zusammenfassung
»Jetzt lassen Sie sich mal nicht alles aus der Nase ziehen, Shark«, sagte Bount schließlich, als ihm der Geduldsfaden riss. »Nicht ich bin für Sie da, sondern Sie sind mir als Interessenvertreter der Eltern des Mordopfers Rechenschaft schuldig.«
»Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden«, schnappte Bailey.
»Der Polizeichef sieht das vermutlich anders. Sie wissen bestimmt, dass ich einen direkten Draht zu ihm habe. Soll ich ihn mal fragen? Vergessen Sie nicht, dass ich selbst aus dem Polizeidienst komme und genau weiß, welche Auskünfte statthaft sind und welche nicht. Sie haben kein grünes Bübchen vor sich.«
Dieser Band enthält folgende Krimis
von Earl Warren:
Bount Reiniger und die Millionenmacher
Bount Reiniger und die Killer-Universität
Bount Reiniger und die Mörder-Cops
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Dreimal Mordmillionen für Bount Reiniger: N.Y.D. New York Detectives Sammelband 3 Krimis
Earl Warren
Der Lieutenant war Mitte Dreißig, schwarzhaarig, drahtig und sehr elegant gekleidet. Mit seinen eisblauen Augen fixierte er Bount, bevor er sich einige Informationen entlocken ließ. Bount musste ihn noch zu jeder Kleinigkeit dreimal fragen.
»Jetzt lassen Sie sich mal nicht alles aus der Nase ziehen, Shark«, sagte Bount schließlich, als ihm der Geduldsfaden riss. »Nicht ich bin für Sie da, sondern Sie sind mir als Interessenvertreter der Eltern des Mordopfers Rechenschaft schuldig.«
»Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden«, schnappte Bailey.
»Der Polizeichef sieht das vermutlich anders. Sie wissen bestimmt, dass ich einen direkten Draht zu ihm habe. Soll ich ihn mal fragen? Vergessen Sie nicht, dass ich selbst aus dem Polizeidienst komme und genau weiß, welche Auskünfte statthaft sind und welche nicht. Sie haben kein grünes Bübchen vor sich.«
Dieser Band enthält folgende Krimis
von Earl Warren:
Bount Reiniger und die Millionenmacher
Bount Reiniger und die Killer-Universität
Bount Reiniger und die Mörder-Cops
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
Bount Reiniger und die Millionenmacher
Auf dem Traumschiff ist Mord angesagt – Bount Reiniger bucht eine Kreuzfahrt mit Sterbegarantie
von Earl Warren
1.
Bount Reiniger stand mit aufgeklapptem Mantelkragen gegenüber dem »Blue Monkey«, einer Seemannskneipe an den East Side Docks. Es nieselte, ein eisiger Wind webte vom Atlantik. Da wurde die Kneipentür aufgestoßen. In einem Schwall von Tabakqualm trat ein hochgewachsener Matrose ins Freie.
Erblickte zu Bount herüber, der sich nun aus dem Schatten des Hauseingangs löste. Da zuckte der Seemann zusammen.
Mit steifen Bewegungen näherte er sich quer über die pfützenübersäte Fahrbahn. Sein Gesicht, in dem Regentropfen glitzerten, war totenblass, der Mund weit aufgerissen zu einem stummen Schrei.
»Das Gangsterschiff«, röchelte er noch, ehe er zusammenbrach. Bount fing den schlaffen Körper auf. Da sah er das Heft des Messers aus dem Rücken des Mannes ragen.
Bount sah in gebrochene Augen und unterdrückte einen Fluch. Der Ermordete war ein Seemann des Luxus-Ozeanliners ›Amber‹, um den Bount sich demnächst kümmern sollte. Die Reederei hatte ihn damit beauftragt. Mit dem Mann hatte sich Bount nach kurzer vorhergehender Recherche – wie er glaubte, streng geheim – zu einem Treffen an diesem Abend verabredet.
Der Seemann Joe Braxter war ihm von der Reederei als absolut zuverlässig und kooperativ geschildert worden. Zu kooperativ, das passte verschiedenen Leuten nicht. Der Mörder musste noch in der Nähe sein. Gerade als Braxter das Lokal verließ, hatte er kaltblütig zugestochen.
Bount ließ den Toten aufs Pflaster sinken und wollte seine Taschen durchsuchen, als sich zwei unterschiedliche Männer aus dem erleuchteten Eingang des »Blauen Affen« lösten.
Der eine war ein spilleriger, wieselartiger kleiner Kerl, dem Typ nach ein Südländer. Der andere, ein kohlrabenschwarzer Farbiger mit einem großen Goldring im linken Ohr, maß an die zwei Meter und konnte vor Kraft kaum laufen. Das Duo näherte sich Bount Reiniger, der sich aufrichtete und vorsichtshalber in den Mantel griff, wo er die 38er Automatic hatte.
»Ist was?«, fragte er kühl.
Der Kleine grinste ihn an und gab seinem Kumpan einen Wink. Der Schwarze sprang vor wie ein Grizzlybär auf die Beute. Der Kleine riss eine Pistole unter der Lederjacke hervor.
Bount trat ihm die Waffe aus der Hand, dass sie über die Straße segelte, wich dem Schwarzen aus, der gegen die Hauswand krachte, und zog seine Automatic. Der Schwarze war jedoch clever. Sein Faustschlag erwischte Bount wie eine Dampframme und schüttelte ihn durch. Bount ächzte. Der Kleine versuchte einen heimtückischen Tritt anzubringen.
Das scheiterte knapp. Während der Schwarze Bount mit einer Bärenumarmung umklammerte, flitzte der Kleine über die Straße und suchte seine Pistole. Mattschimmernd lag sie in einer Wasserpfütze.
Bount hatte alle Mühe, die Bärenumarmung zu sprengen. Er schaffte es, indem er dem Gegner die Pistolenmündung unter das Kinn drückte. Statt auf ihn zu schießen, stieß Bount den Bullen zurück. Der Kleine hob seine Pistole auf.
Bount sah die wütende Entschlossenheit in seinem Gesicht, ihn zu töten. Er hatte keine Chance mehr, auszuweichen oder schneller als der Gegner zu schießen.
Der Kleine drückte ab. Doch nichts geschah. Vergeblich riss der Kleine am Abzug. Das schlammige Dreckwasser aus der Pfütze blockierte die feinmechanischen Teile der Pistole. Es war ein störungsanfälliges Modell und Bount Reinigers Glück.
Ein Colt Government oder russische Nagan hätte funktioniert.
»Mistding!«, fluchte der Kleine und warf Bount, der auf ihn zusprang, die nutzlose Pistole entgegen.
Bount riss den Kopf weg. Das Schießeisen verfehlte knapp sein Gesicht, und er packte den Burschen. Der Kleine sträubte sich, hatte gegen Bounts überlegene Kräfte und seine Judokenntnisse jedoch keine Chance. Er wurde in einen Polizeigriff genommen. Der riesige Schwarze mit dem baumelnden Ohrring stürzte herbei.
Bount ließ ihn in die Pistolenmündung sehen.
Sofort stoppte der Schwarze, rollte mit den Augen, hob die Hände und sagte: »Nicht schießen, Mister!« Dann drehte er sich auf dem Absatz um und rannte hakenschlagend davon.
Bount schickte ihm einen Warnschuss hinterher. Die Kugel schlug Funken aus dem Pflaster und jaulte als Querschläger davon. Der Schuss hallte durch die Gasse bei den Docks, an deren Anlegestellen Lastkräne wie Ungetüme in den düsteren Himmel über Manhattan ragten.
Der Schwarze stolperte, landete auf Händen und Füßen, und Bount fürchtete schon, ihn entgegen seiner Absicht getroffen zu haben. Doch der Mann robbte schnell durch die Lücke zwischen zwei geparkten Autos zu einem schmalen Durchgang zwischen den Häusern. Dort verschwand er, als ob es ihn nie gegeben hätte.
Bounts Ruf »Halt, stehen bleiben!«, beeindruckte ihn nicht. Bount hielt seinen Gefangenen fest, durchsuchte dessen Taschen und war auf der Hut, dass ihm der Giftzwerg keinen Messerstich versetzte. Er konnte sich gut vorstellen, den Mörder Bount Braxters erwischt zu haben. Der schwarze Hüne war bestimmt kein Messerstecher.
Aus dem »Blauen Affen« tauchten Neugierige auf, die den Schuss gehört hatten. Aus zwei Wohnungen – es gab nicht viele hier – starrten die Bewohner. Der Schuss hatte sie alarmiert. Fragen in verschiedenen Sprachen schwirrten durcheinander. Bount fand kein Messer und auch sonst keine Waffe mehr in den Taschen des Kleinen.
Der Mann trug jedoch nur an der rechten Hand einen einzelnen Handschuh, was an sich schon auffällig war. Bestimmt hatte er dazu gedient, dass an der Mordwaffe keine Fingerspuren zurückblieben.
Ein Kellner des »Blauen Affen«, an der ehemals weißen Schmuddeljacke und der Säufernase erkenntlich, wandte sich an Bount.
»Was is'n hier geschehen, Mister?«, fragte er Bount mit einer Raspelstimme. »Warum fuchteln Sie mit 'ner Pistole rum?«
Bount hielt die 38er nach wie vor schussbereit. Vielleicht gab es hier noch weitere, die ihm ans Leder wollten.
»Wer hat dem Mann dort das Messer in den Rücken gejagt?«, fragte einer.
Der bäuchlings an der Hauswand liegende Tote war nicht zu übersehen.
»Das muss die Polizei herausfinden«, sagte Bount. »Verständigt sie endlich und ruft die Mordkommission an. Ich glaube, der hier ist der Mörder. Ich halte ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.«
»Gern ruf ich die Bullen nich'«, ächzte der Kellner.
»Es wird sich nicht vermeiden lassen«, beschied ihn Bount. »Oder sind Sie auf Ärger scharf?«
»Na gut.« Der Kellner blickte den kleinen Gangster in Bounts Fesselgriff vorwurfsvoll an. »Musstest du den Mann ausgerechnet vor unserer Kneipe erstechen? Wärst du um die Ecke gegangen, hätten wir jetzt keine Schererei. Moment mal, dich kenne ich doch! Du hast doch die ganze Zeit mit 'nem zweistöckigen Schwarzen in der Ecke gesessen und bist dann gleich nach dem Seemann gegangen. Ihr habt jeden Drink gleich bezahlt.« Der Kellner schaute sich den Seemann genauer an. »Das ist der Mann. Ihr seid ihm gefolgt.«
Der Kleine schwieg. Der Kellner hatte ihn damit ans Messer geliefert. Im »Blauen Affen«, vielleicht auch bei den Anwohnern, wurde schon telefoniert. Bis zum Eintreffen der City Police und auch der Mordkommission dauerte es. Bount Reiniger und die übrigen, darunter auch grell geschminkte Hafenschlampen, standen im Nieselregen.
Endlich bog das erste Patrolcar um die Ecke. Das Jaulen seiner Sirene erstarb, als es bremste. Roter Schein von der Drehleuchte malte das Pflaster wie mit Blut. Bount stieß seinen Gefangenen zu dem Patrolcar und gab dessen zwei uniformierten Insassen, die sofort ausstiegen, einen knappen Bericht.
»Ich heiße Bount Reiniger und bin Privatdetektiv. Legt diesem Burschen Handschellen an und setzt ihn auf die Rückbank. Passt gut auf ihn auf und stellt seinen Handschuh sicher. Wenn Blutspritzer daran sind, ist das ein Beweis.«
Der Handschuh wurde dem Gangster ausgezogen. Der Mann erhielt die stählerne Acht. Die beiden blauuniformierten Cops drängten ihn zum Wagen. Der Killer schaute mit dem Kopf übers Wagendach weg. Bount hörte ein leises Plopp, vermutlich von einem Hausdach. Die genaue Richtung konnte er wegen der übrigen Geräusche nicht feststellen.
Ein Ruck lief durch den Körper des kleinen Killers. Stocksteif und tot kippte er auf das Pflaster. Ein exakt gezielter Schuss in die Stirn aus einem Präzisionsgewehr mit Schalldämpfer hatte ihn gefällt.
Bount spürte ein flaues Gefühl im Magen. Zwei Tote innerhalb von nicht mal zwanzig Minuten, direkt vor seinen Augen, ohne dass er die Morde verhindern konnte. Das war ziemlich happig.
*
Um vier Uhr früh stand Bount mit seinem Freund Captain Rogers, dem Leiter der Mordkommission Manhattan Süd, vor den beiden Toten im Leichenschauhaus. Rund vier Stunden zuvor hatte Bount den Scharfschützen und Mörder des kleinen Killers vergeblich gesucht. Der Bursche war irgendwo bei den Docks oder in der Stadt untergetaucht. Es gab keine Spur von ihm. Nicht mal die Patronenhülse wurde gefunden.
Wie ein Phantom hatte er zugeschlagen. Von dem Schwarzen mit dem Ohrring hatte man am Tatort auch nichts mehr entdeckt. Die Mordkommission war dann eingetroffen und hatte die Zeugenbefragungen und im Licht aufgebauter Standscheinwerfer eine akribische Spurensicherung vorgenommen. Jetzt lag der Tote friedlich neben seinem Opfer.
Telly Canarsie, so hieß er, wie man mittlerweile wusste, hatte Joe Braxter nicht sehr lange überlebt. Der Polizeiarzt zeigte Bount und Toby Rogers die Kugel, die Canarsie getötet hatte. Rogers fasste sie mit der Pinzette.
»Kaliber 223 Long Rifle, wenn mich nicht alles täuscht«, sagte er. »Die Ballistikexperten im Headquarters müssen feststellen, ob die Waffe, aus der diese Kugel stammt, registriert ist.« Anhand der charakteristischen Rillen am Geschoss konnte man das zweifelsfrei nachweisen.
»Canarsie war wie Braxter Seemann auf der ›Amber‹.« So hieß der Transozeanliner, wegen dem Bount seit dem Vortag ermittelte. »Die Aussage des Kellners, kleinste Blutspritzer an seinem Handschuh und mikroskopisch feine Spuren von dessen Lederimprägnierungsmittel an der Mordwaffe beweisen einwandfrei, dass Canarsie Braxter ermordete. Warum?«
»Weil Braxter mir Verschiedenes verraten sollte und Canarsie das verhindern wollte«, erklärte Bount. Im »Blauen Affen« hatten sich die beiden Männer, obwohl sie zum selben Schiff gehörten, nicht unterhalten. Captain Rogers hatte in der kurzen Zeit allerlei erfahren. Die Spezialisten seiner Mordkommission arbeiteten fix. »Du solltest dich bei der Reederei und dem Kapitän der ›Amber‹ erkundigen, Toby. Dort dürfte die Lösung des Rätsels zu finden sein. Die ›Amber‹ ist gestern früh in den Hafen von New York eingelaufen. Sie liegt am West Side Dock 27.«
»Das ist ganz in der Nähe der Battery Park City.« Toby Rogers zog Bount Reiniger aus der Hörweite des Polizeiarztes. »Wie passt du ins Bild? Du sagtest, die Reederei der ›Amber‹ hätte dich beauftragt. Warum?«
»Es hat da gewisse Vorfälle im Zusammenhang mit dem Transozeanliner gegeben. Die ›Amber‹ unternimmt Kreuzfahrten durch die Karibik. Sehr reiche Leute leisten sich diesen Spaß oder solche, die lange darauf gespart haben. In Kingston, Jamaica und in Port of Spain sind im letzten Jahr zwei reiche Passagiere gekidnappt und gegen eine hohe Lösegeldzahlung wieder freigelassen worden. Einer Millionärsfrau wurde während einer anderen Kreuzfahrt der teure Schmuck geklaut. Er ist nie wieder aufgetaucht. Ein Steward verschwand spurlos von Bord, und ein Seemann wurde auf einer der letzten Fahrten unter mysteriösen Umständen von einem herabfallenden Ladebaum erschlagen. An der letzten Kreuzfahrt der ›Amber‹ hat ein von der Golden Globe Line beauftragter Schifffahrtsdetektiv teilgenommen. Jemand, der speziell für diese Linie und Reederei arbeitete. Er ging in Caracas von Bord, und man hat nie wieder etwas von ihm gehört.«
»Das ist schon merkwürdig, aber noch kein Beweis, dass es auf der ›Amber‹ nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Entführungen sind jeweils an Land geschehen. Der Detektiv verschwand an Land. Unfälle und dass ein Steward einfach wegbleibt, ohne offiziell abzumustern, sind bei einem so großen Schiff auch nichts Ungewöhnliches. Der Schmuckdiebstahl, na ja, der kriminalisiert noch kein ganzes Schiff mit mehreren hundert Leuten an Bord.«
»Siebzehnhundert, um genau zu sein«, sagte Bount. »Tausend Passagiere und siebenhundert Mann Besatzung. Die ›Amber‹ ist eine schwimmende Stadt, in der allerlei passieren kann. Sie hat zweimal bei Atlantiküberquerungen das Blaue Band gewonnen und verfügt über allen Luxus. Aber das ist nicht alles. Joe Braxter stammelte noch ›Das Gangsterschiff!‹, bevor er mir tot in die Arme fiel. Und warum hat ihn Canarsie wohl ermordet und ist dann selbst getötet worden, damit er nichts mehr verraten kann?«
»Das ist allerdings verdächtig. Aber ich als New Yorker Polizeicaptain kann nicht mit der ›Amber‹ durch die Weltmeere schippern, um dort an Bord Nachforschungen anzustellen. Das könntest du als Privatdetektiv.«
»Genau. Deshalb werde ich auch an der nächsten Kreuzfahrt der ›Amber‹ teilnehmen, die in einer Woche wieder ausläuft. Es sei denn, bis dahin ist der Fall aufgeklärt. Ich halte mich bedeckt, bis ich an Bord gehe, weil ich nicht schon vorher als Privatdetektiv auffallen will.«
»Verstehe. Du hast Angst, das Schicksal deines Vorgängers zu teilen. Du glaubst, er wurde in Caracas ermordet?«
»Wenn er noch lebte, hätte er sich inzwischen gemeldet«, sagte Bount. »Man weiß nicht, was er herausgefunden hat. Seine verschlüsselten Meldungen, die ich bei der Reederei einsehen konnte, gaben nicht viel her. Unter uns gesagt, scheint er nicht die allertüchtigste Spürnase gewesen zu sein.«
»Auch ein blindes Huhn findet ein Körnchen«, sagte Captain Rogers. »Er ist an seinem erstickt. Ich überprüfe die ›Amber‹ und ihre Besatzung, solange der Ozeanliner im New Yorker Hafen liegt. Man sollte sich auch mal ans FBI wenden. Für Verbrechen auf hoher See sind die G-men zuständig.«
»Ich glaube nicht, dass aus der Ecke was erfolgt«, sagte Bount Reiniger. »Außerdem will es auch die Reederei nicht und blockt da ab und verharmlost. Der Golden Globe Line ist es um ihren guten Ruf zu tun. Ich soll möglichst diskret arbeiten.«
»So wie letzte Nacht, wie?«, meinte Toby Rogers gallig. »Vielleicht löse ich ja den Fall. Dann hat sich's was mit deiner Kreuzfahrt.«
Auf der Heimfahrt in seinem silbergrauen 450 SEL ging Bount die Verballhornung eines Schlagertextes durch den Kopf: Eine Seefahrt, die ist tödlich ...
Eine Woche später war es soweit. Bount ging am Pier 27 an Bord des Transozeanliners mit den zwölf Decks. Zwei massige Schornsteine, der Radarmast und das vordere und hintere Ladegeschirr überragten die Decks. Die ›Amber‹ sollte in Kürze auslauten. Noch wurden Vorräte sowie Gepäck und Container eingeladen und verstaut. Ein Betrieb herrschte, der nur auf den ersten Blick unkoordiniert erschien. Von den Besatzungsmitgliedern und Hafenleuten wusste jeder, was er zu tun hatte.
June March war mitgefahren, um ihren Chef zu verabschieden. Sie sollte den 450er Mercedes zurückbringen und in die Garage stellen. Das Wetter war noch unfreundlicher und trüber geworden. Die Wolkenkratzer stießen in einen diesig-grauen Novemberhimmel und in die Bäuche der Wolken. In Kälte und Nässe sah man in New York nur bleiche und missvergnügte Gesichter.
Ein Schiffsoffizier kontrollierte Bounts Bordkarte.
»Herzlich willkommen an Bord der ›Amber‹, Mister Reiniger. Bitte begeben Sie sich aufs A-Deck, Kabine 253. Folgen Sie einfach den Hinweisschildern. Steward, nimm Mister Reinigers Handgepäck. Dürfte ich jetzt um die Bordkarte der Frau Gemahlin bitten?«
Die Pass- und Zollkontrolle hatte durchs US Custom Office schon vor dem An-Bord-Gehen stattgefunden.
»Miss March ist weder mit mir verheiratet, noch fährt sie mit«, erklärte Bount dem Offizier. »Sie verlässt das Schiff noch vor dem Auslaufen.«
»Schade.« Der Offizier verbeugte sich höflich. »Für einen so hübschen Passagier hätten wir immer einen Platz. Wollen Sie es sich nicht überlegen, Miss March? Es sind noch Kabinen frei.«
»Mein Chef, ein übler Antreiber und Schinder, gibt mir keinen Urlaub«, zwitscherte June. In ihrem marineblauen Kostüm und dem hellen Mantel sah sie zum Anbeißen aus. »Leider nicht möglich.«
Der Steward brachte Bounts Reisetasche weg. Bount blieb mit June auf dem Sonnendeck stehen, das seinen Namen jetzt schlecht verdiente. Sie schauten sich den Betrieb kurz vor dem Auslaufen an. Der Offizier und der Zahlmeister begrüßten immer neue Passagiere.
Die meisten verabschiedeten sich schon am Kai von ihren Angehörigen und Freunden. Bount sah einen jungen Mann im Rollstuhl. Eine Decke über den Füßen, wurde er von einem schlanken schwarzen Pfleger die Gangway hochgeschoben. Ein Deck höher hörten June und Bount seine Begrüßung.
»Herzlich willkommen an Bord, Mister Safford. Wir werden alles tun, damit Sie sich wohl fühlen. Wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, äußern Sie ihn. Die Besatzung der ›Amber‹ steht Tag und Nacht zu Ihrer Verfügung. Mister Russen, ich begrüße Sie.«
Die zweite, merklich kühlere Begrüßung der beiden Offiziere galt dem farbigen Pfleger, der keine Miene verzog. Fürsorglich ordnete er die Decke über den gelähmten Beinen seines Herrn.
Rudy Saffords Mund verzog sich geringschätzig.
»Sie brauchen mir keinen Honig ums Maul zu schmieren«, sagte er zu den Schiffsoffizieren. »Ich weiß sehr wohl, dass ich für meine Umwelt eine Last bin und mein Anblick den Gesunden und Gehfähigen ein stetiger Vorwurf ist. Meine Angehörigen haben mich zu der vierzehntägigen Kreuzfahrt überredet, damit sie mich für eine Weile los sind.«
»Mister Safford, Ihre Familie meint es nur gut mit Ihnen«, sagte der schwarze Pfleger. Er mochte 27 oder 28 Jahre alt sein, Safford ein wenig jünger. »Die Seeluft wird Sie kräftigen. Sie empfangen neue Eindrücke.«
»Halt deinen Mund, du schwarzer Affe!«, fauchte Safford. »Du brauchst mich schon gar nicht zu trösten. Ich weiß sehr genau, dass du mich am liebsten mit dem Rollstuhl ins Wasser schieben würdest.«
Der Pfleger schwieg. Bount erkannte an seiner Miene, wie sehr er verletzt war. Stumm schob er seinen Herrn weiter.
»Das ist Rudy Safford, der Millionenerbe und Rennfahrer«, sagte June March. »Vor sieben Monaten ist er beim Großen Preis von Daytona Beach schwer verunglückt. Er musste aus den Trümmern seines Formel-Eins-Rennwagens geschweißt werden. Seitdem ist er von der Taille abwärts gelähmt. Ein harter Schlag für einen so jungen, vitalen Mann.«
Man hatte zuvor in den Klatschspalten viel über Rudy Safford gelesen. Über seine tollen Streiche und waghalsigen Abenteuer, seine Amouren und Skandale. Er war im tiefsten Afrika gewesen, in den Urwäldern des Amazonas. Er hatte mit einer europäischen Prinzessin eine vielkommentierte Romanze gehabt. Hollywood hatte ihn gerufen.
Dann war er an der eigenen Tollkühnheit gescheitert, sich mit den besten Rennfahrern der Welt zu messen. Jetzt saß er im Rollstuhl.
»Ja«, sagte Bount Reiniger, »ein harter Schlag.«
»Hallo, froh, Sie zu sehen«, sagte da eine Stimme mit unverkennbar britischem Akzent hinter ihnen. Bount und June schauten sich um und sahen einen hochgewachsenen schnurrbärtigen Herrn im Military-Look-Mantel mit einem Wappen auf der Brusttasche. Er musste in den Fünfzigern sein, wie sein stahlgraues Haar verriet. Sein Teint war der eines Freiluftmenschen, sein Auftreten das eines reichen Müßiggängers. »Arthur Conan Lord Raftbury. Ich hoffe, wir schließen auf der Reise eine enge Bekanntschaft.«
Formvollendet küsste Lord Arthur Junes Hand. Es sah aus, als wolle er hineinbeißen. Da er sichtlich darauf wartete, stellte Bount June namentlich als seine Mitarbeiterin und dann sich vor. Er erwähnte, dass June gleich von Bord gehen werde.
»Oh, was für ein Pech! Wissen Sie, wie viele Rettungsboote die ›Amber‹ hat, Mister Reiniger?«
»Aus dem Kopf nicht. Da müsste ich im Prospekt nachsehen.«
»Nein, keinesfalls. Lassen Sie uns wetten. Wer am nächsten dran ist, gewinnt hundert Pfund. Oder möchten Sie einen anderen, möglichst höheren Einsatz?«
»Ich wette nicht, Lord Arthur. Außerdem, wer sagt mir denn, dass Sie die genaue Anzahl nicht schon kennen und mich hereinlegen wollen?«
»Sir, mein Ruf als ein Gentleman steht dagegen! Davon abgesehen würde mich das des Vergnügens an der Wette berauben. Sie wetten tatsächlich nicht? Keine Pferde, Windhunde, Karten, Würfel und sonstige Glücksspiele? Jetzt sagen Sie bloß, Sie spielen auch kein Whist und kein Kricket?«
»Nein.«
»Was müssen Sie da für ein freudloses Leben führen. Ich wette für und gegen alles und jeden. Die Kreuzfahrten mit der ›Amber‹ sind immer hochinteressant. Ich fahre jetzt schon zum vierten Male mit. Auf der letzten Fahrt bin ich auch dabei gewesen. Ich liebe die Seefahrt.«
»Da müssen Sie doch auch Frank Chilpern getroffen haben«, sagte Bount.
So hieß der verschwundene Reederei-Detektiv.
»Waren immerhin fast tausend Faxe dabei«, sagte Lord Arthur. »Passagiere, meine ich.« Er schnippte mit den Fingern. »Das war so ein kleiner Kerl mit zu viel Brillantine im Haar. Hatte die scheußliche Angewohnheit, lautlos auf seinen Gummisohlen herumzuschleichen und plötzlich hinter einem zu stehen. Er war ein Detektiv oder so was Ähnliches. Hatte seine Nase ständig in allem und stellte allzu viele neugierige Fragen. Wettete mit ihm, dass das nicht gut gehen könnte. Habe die Wette gewonnen, aber Kerl leider spurlos verschwunden, vermutlich tot. Kann verlorene Wette nicht bezahlen, hat Betrag auch nicht hinterlegt. Kein feiner Stil.«
Lord Arthur hatte die Angewohnheit, Worte zu verschlucken und unvollständige Sätze zu bilden. Bount wollte sich später genauer mit ihm unterhalten, selbst wenn er deshalb mit dem Engländer wetten musste. Lord Arthur erschien fast zu spleenig und englisch, um wahr zu sein. Natürlich hatte er einen Regenschirm über dem Arm, trug einen Bowlerhut und hielt sich gerade wie ein Ladestock.
Täuschte er vielleicht nur und überzog dabei? Man würde sehen.
»Sagen Sie mal, Mister Reiniger, sind Sie vielleicht auch Detektiv? Der berühmte Bount Reiniger?«
Bount hatte seinen vollen Namen genannt. Jetzt schüttelte er den Kopf.
»Nein, das ist nur eine zufällige Namensgleichheit, Sir Arthur. Ich bin Konservenfabrikant – für Hundefutter und Katzennahrung. Dog's Heaven und Friscat. Sie kennen es sicher.«
»Die Jagdhunde auf meinem Landsitz in Essex erhalten niemals Konservenahrung, und Katzen verabscheue ich. Würde jeden sofort entlassen, der meinen Hunden so was füttert. Na ja, Amerikaner, haben keine Manieren und kein Verständnis für Tiere. Ist doch so! Ich mache in Zeitungen und in Rohstoffen. Das heißt, ich persönlich widme mich den Geschäften nicht. Meine Vettern und Fachleute erledigen das. Ich durchbummle lieber die Welt und wette. Habe mal mit einem südamerikanischen Zinnkönig um zehntausend Tonnen Bauxit wetten wollen, doppelte Bezahlung oder gar keine. Lehnte der Mann ab und verstreute Gerüchte über mich, gehörte entmündigt. Keinen Sportsgeist haben diese Leute. Immer nur mit den Bilanzen und mit diesem Dow-Jones-Index. Unsympathischer Bursche, das. Muss sich in Wall Street herumtreiben. Bin ihm dort nie begegnet und möchte das auch nicht. – Entschuldigen Sie mich jetzt. Muss mich weiter umsehen und vielleicht ein, zwei Wetten platzieren. So long.«
Der Lord schlenderte weiter. June tippte sich an die Stirn.
»Was ist das denn für einer?« Die Schiffssirene tutete zum zweiten Mal. Beim dritten Signal wurde die Gangway eingezogen. »Ich muss jetzt von Bord. Viel Erfolg, Chef, und pass auf, dass man dich nicht zu den Haifischen schickt. Ich würde dich zu gern begleiten, schon um dem trüben und nasskalten New Yorker Wetter zu entwischen.«
»Das könnte dir so passen, June. Einer muss ja in unserer Detektei die Stellung halten. Sei ein tüchtiges Mädchen und grüße Toby Rogers. In drei Wochen sehen wir uns wieder. Dann kann ich dir genau sagen, was es mit der ›Amber‹ auf sich hat.«
June stellte sich auf die Zehenspitzen, drückte Bount einen Kuss auf die Wange und eilte zur Gangway hinunter. Vom Kai aus winkte sie Bount noch einmal zu. Man war schon dabei, die Gangway einzuholen, als ein knallroter Thunderbird heranpreschte und mit quietschenden Reifen am Kai hielt.
Ein Mann mit Glatze stieg auf der Fahrerseite aus. Auf der Beifahrerseite verließ eine kurvenreiche schwarzhaarige Schönheit den Thunderbird. Die Lady im weißen Thermoanzug packte ihr Handgepäck und lief zu der Anlegestelle.
»Halt!«, rief sie zum Zahlmeister hinauf. »Ich bin Carmen Lopez. Ich muss noch mit.«
Die Gangway wurde noch einmal ausgefahren. Miss Lopez' Begleiter schleppte einen ganzen Berg Koffer heran, mit denen der Rücksitz und der Kofferraum des Thunderbirds überladen gewesen waren. Seeleute packten die Koffer und beförderten sie hastig an Bord. An den Relings mehrerer Decks standen die Passagiere, am Kai jene, die sie zum Schiff begleitet hatten.
Man winkte und tauschte Abschiedsgrüße aus. Carmen Lopez war die letzte, die an Bord ging. Sie sah keinen Grund, sich sonderlich zu beeilen oder für die Verzögerung zu entschuldigen. Endlich hatte man sie mitsamt dem Gepäck an Bord. Die Sirene ertönte zum vierten und letzten Male. Die Stahlseile wurden von den Pollern losgeworfen, und die ›Amber‹ löste sich langsam vom Kai, um den Hudson hinunter in Richtung Atlantik zu fahren.
June stand beim Mercedes im Hintergrund und winkte Bount zu. Sie schickte ihm eine Kusshand. Die tüchtige, immer cool und kess auftretende June March hatte schon seit langem eine ganze Menge für ihren Chef übrig.
Die ›Amber‹ verschwand hinter den Hochhäusern der neuen Battery Park City aus June Marchs Blick. Traurig setzte sie sich in den Mercedes. Würde sie Bount Reiniger lebend wieder sehen?
Bount blieb an Deck. Die frische kalte Luft tat ihm gut.
Neben ihm tauchte die Schwarzhaarige auf, wegen der man mit der Abfahrt hatte warten müssen. Die ›Amber‹ fuhr in die Lower Bay.
»Ah, die Freiheitsstatue«, sagte Carmen Lopez und rückte ihre große Sonnenbrille zurecht. Die Seebrise zauste an ihrem Kopftuch. »Dann muss das links wohl Governors Island sein, wo man die Einwanderer zusammenpfercht, bis sie die Einreisegenehmigung erhalten?«
»Es ist Governors Island. Aber so sehr gepfercht wird da nicht, Miss Lopez.«
»Sagen Sie, kennen wir uns nicht? Ich glaube, ich habe Sie schon mal gesehen.«
»Ich kann mich nicht erinnern, und ich hätte Sie bestimmt nicht vergessen.«
Bount Reiniger stellte sich nicht vor. Er verzichtete auch auf die Geschichte vom Tierfutterfabrikanten. Zurückhaltung erschien ihm momentan dieser Miss Lopez gegenüber als das beste.
»Ah«, sagte da Lord Arthur, der sich wieder hinzugesellt hatte. »Sie scheinen die schönen Frauen ja magisch anzuziehen, Mister Reiniger.« Er wandte sich an Carmen Lopez. Sie war knapp einssechzig groß, aber ein Temperamentbündel. Der Lord stellte sich abermals formvollendet vor. »Reisen Sie auch zum Vergnügen?«
»Ja«, erwiderte Carmen Lopez schnippisch. »Aber zu meinem und nicht zu Ihrem.«
Damit ließ sie Lord Arthur stehen. Bount Reiniger, dem athletischen Privatdetektiv mit dem markanten Gesicht, schenkte sie jedoch einen verheißungsvollen Blick aus den hinreißend dunkelblauen Augen, wie man sie bei Schwarzhaarigen selten fand. Mit wiegenden Hüften entfernte sie sich.
»Eine hinreißende Frau.« Lord Arthur seufzte. »Ich würde sie zu gern in einem bodenlangen Kleid, bis zum Hals verhüllt, und mit einem riesigen Hut sehen.«
»Wie?«, fragte Bount, der das für einen Scherz hielt. Sicher hatte Sir Arthur das genaue Gegenteil gemeint, nämlich eine hüllenlose Ansicht der Senorita Lopez.
»Genau so«, entgegnete der Engländer jedoch todernst. »Für mich ist das das Allergrößte. Nacktheit stößt mich ab. Sie ist vulgär.«
Bount verabschiedete sich ernst und möglichst höflich von dem spleenigen Lord. Er grinste erst, als er um die Ecke war.
2.
Die ›Amber‹ erreichte die offene See. Ein letztes Tuten grüßte die zurückbleibende Acht-Millionen-Metropole New York. Dank der Stabilisatoren merkte man auf dem Schiff von dem starken Seegang nichts. Bount hatte eine Erster-Klasse-Kabine vorgefunden, die an Komfort nichts zu wünschen übrig ließ. Er überlegte, wie er weiter vorgehen sollte.
Vom FBI war niemand an Bord. Das wusste er von Captain Rogers. Der hatte in jener Woche seit dem Doppelmord in den Docks nicht viel erreicht.
Jener kleine Messerkiller Canarsie und der herkulische Schwarze mit dem großen goldenen Ohrring waren wie Joe Braxter Besatzungsmitglieder der ›Amber‹ gewesen. Canarsie war laut Angaben des Kapitäns wegen Unregelmäßigkeiten fristlos entlassen worden. Von dem schwarzen Hilfsmaschinisten mit dem Goldohrring fehlte jede Spur.
Der Kapitän und andere Besatzungsmitglieder der ›Amber‹ hatten der New Yorker Mordkommission nicht weitergeholfen. Es müsse sich um eine private Fehde zwischen Canarsie, dem Schwarzen und Braxter gehandelt haben, erklärten sie. Und wer Canarsie erschoss, das sei rätselhaft.
Bount sah das anders. Entweder hatte der Schwarze den Mord begangen, oder ein weiterer Killer mit einem Schalldämpfergewehr hatte für alle Fälle in der Nähe gelauert. Er beseitigte die Gefahr, wie Canarsie sie darstellte. Das hing nicht nur mit dem Mord an Braxter zusammen.
Es musste ein Geheimnis um die ›Amber‹ geben. Braxters letzte Worte »Das Gangsterschiff!«, gingen Bount nicht aus dem Sinn. Er fragte sich, welche Verbrechen großen Stils auf der ›Amber‹ abliefen. Zwei Lösegelderpressungen und ein Schmuckdiebstahl, die zudem schon eine Weile zurücklagen und nicht aufgeklärt worden waren, erschienen ihm zu wenig, um einen Doppelmord zu rechtfertigen.
Es musste etwas Akutes im großen Maßstab sein. Bount war offiziell unter seinem richtigen Namen an Bord gegangen, angeblich um für eine Weile auszuspannen und den Luxus einer Kreuzfahrt in die sonnige Karibik zu genießen.
Die Kreuzfahrt war teuer. Die erste Station war Miami. Dann sollte die ›Amber‹ durch die Straße von Yucatan in die Karibik gelangen. Die nächsten anzusteuernden Häfen hießen Maracaibo, Caracas und Port of Spain. Schließlich, auf der Rückfahrt, sollten San Juan auf Puerto Rico und Santo Domingo auf der Insel Haiti angelaufen werden – alles Perlen mit dem tropischen Zauber der Karibik. Von Haiti würde es durch die Windward-Passage und an den Bahamas vorbei wieder zurück nach New York gehen.
Bount beschäftigte sich mit den technischen Daten des Ozeanliners. Knapp 54.000 Bruttoregistertonnen, Gesamtlänge 315 Meter, Breite 34 Meter. Die Höhe vom Kiel bis zum Rand des vorderen Schornsteins betrug 53 Meter, die vom untersten Deck bis zur Wasseroberfläche immerhin 15. Neunzehn Fahrstühle bewältigten den Verkehr zwischen den einzelnen Decks, die außer den Kabinen der verschiedenen Klassen mehrere Theater, Bordkinos, Büchereien, Ballsaal, Speisesäle, Rauchsalons, Schwimmbad und Fitnessräume enthielten.
Außer dem Hallenbad im Schiffsinneren gab es auf dem Sportdeck einen offenen Swimmingpool für die tropischen Breiten. Ferner die Küchen, Bäckerei, und Konditorei, Arzt und Kindergärten sowie die technischen Anlagen und Werkstätten. Vorratsräume, die Offiziersunterkünfte sowie Gepäck-, Fracht- und Maschinenräume schlossen sich an. Die Maschinen der ›Amber‹ lieferten 74.000 PS. Damit konnte der Ozeanliner eine Spitzengeschwindigkeit bis zu 38 Knoten erreichen.
Die technischen Einrichtungen entsprachen dem letzten Stand. Die Sicherheitsvorkehrungen galten als perfekt, die ›Amber‹ als unsinkbar. Zu jeder Klasse gehörten Schönheitssalons und Bäder. Man hatte außer der regulären Besatzung und den Stewards Animateure, Sportlehrer und Entertainer an Bord, um jedem ein Maximum an Unterhaltung und Betätigung bieten zu können.
Messebälle und Extraveranstaltungen für die Kinder sowie Tennis-, Schach- und sonstige Turniere rundeten das Programm ab. Bount betrachtete sich das in jeder Kabine ausliegende Informations-Book für die ›Amber‹ sowie den Schiffsplan mit den verschiedenfarbig eingezeichneten Decks. Er überflog die Hinweise und las das Programm.
Wer an allem teilnehmen wollte, würde zweifellos auf der schiffseigenen Intensivstation landen oder nach seiner Rückkehr eine Bluttransfusion und einen längeren Urlaub brauchen. Satellitenfernsehen mit über vierzig Kanälen aus aller Herren Länder gehörte ebenso selbstverständlich zum Angebot jeder Kabine wie das Funktelefon, mit dem man im Selbstwählverkehr weltweit telefonieren konnte. Das Problem daran konnte nur die spätere Rechnung sein.
Bount beschloss, sich erst mal auf eigene Faust umzusehen, bevor er sich dem für ihn vorgesehenen Animateur anvertraute. Beim folgenden Begrüßungsabend würden die Passagiere einen Vorgeschmack dessen erhalten, was sie erwartete.
Er blätterte gerade flüchtig die Bordzeitung »Neptun News« durch, als es an seiner Tür klopfte. Bount bewohnte eine geräumige Doppelkabine mit einem Vorzimmer. So ausgebucht waren die Kreuzfahrten nicht mehr, und da die Reederei es bezahlte, konnte Bount das ausnutzen.
Er lockerte die Automatic in der Schulterhalfter unter dem Jackett – man konnte nie wissen! – und rief:
»Herein!«
Die Tür wurde geöffnet, und eine schlanke Frau mit apartem Gesicht, grünen Augen und langen roten Haaren trat ein. Sie trug große Metallohrringe, einen kurzen Rock, der ihre formvollendeten Beine betonte, und eine Hemdbluse mit dem Emblem »Amber Animatic« auf der linken Brust. Lächelnd zeigte sie weiße Zähne, die für jede Zahnpasta hätten werben können.
»Ich bin Daniela Aiken, Ihre Animateurin oder Hostess. Wenn Sie irgendwelche Wünsche oder Fragen haben, wenden Sie sich an mich, Mister Reiniger. Sie können mich unter null-null-sieben jederzeit anrufen. Sonst bin ich, wenn ich nicht gerade unterwegs bin, im Hostessenoffice im Hauptdeck zu erreichen.«
Der Anblick der rassigen Daniela erweckte in Bount eine Menge männlicher Wünsche. Doch er mochte nicht mit der Tür ins Haus fallen.
»Null-null-sieben? Die Nummer haben Sie James Bond geklaut. Suchen Sie alle Ihre Schutzbefohlenen auf, Miss Aiken?«
»Klar. Ich halte den persönlichen Kontakt für sehr wichtig. Ich will Ihnen helfen, ein Programm zusammenzustellen, damit Sie die Kreuzfahrt mit der ›Amber‹ optimal genießen können.«
»Eigentlich wollte ich mich mal richtig ausruhen«, log Bount.
»Aber ich bitte Sie, Mister Reiniger, ein agiler Mann wie Sie! Dazu ist die Kreuzfahrt doch viel zu teuer. Nein, Sie sollen an Bord etwas erleben. Die Kreuzfahrt soll Ihnen als unvergessenes Erlebnis im Gedächtnis bleiben.«
Das würde zweifellos der Fall sein. Die Frage war nur, ob er es überlebte.
Daniela Aiken setzte sich. Bount bot ihr einen Drink an, den sie dankend ablehnte.
»Ich habe zahlreiche Besuche zu erledigen. Wenn ich bei jedem einen Drink annehme, bin ich bald volltrunken.«
Bount erklärte, dass er sportlich interessiert sei, gern Tennis spiele und in Kampfsportarten aktiv sei.
»Außerdem bin ich in New York Mitglied eines Schießsportclubs.«
»Den Aktivitäten können Sie hier allen frönen. Selbstverständlich haben wir eine Tennishalle, Trainingsräume und einen Schießstand, der sich über dem Maschinenraum befindet. Wie steht es mit schöngeistigen Interessen?«
»Ich habe ein Faible für hübsche Frauen.«
»Oh! Es gibt zahlreiche weibliche Mitreisende, und die Seeluft erotisiert. Sie werden auf Ihre Kosten kommen.«
Bount flirtete mit der charmanten Hostess. Er fragte sie nach dem verschwundenen Detektiv und einem der beiden Entführten.
»Der Aufenthalt in den Hafenstädten, kann gefährlich werden, besonders, wenn jemand 2u leichtsinnig wird und sich von der Reisegruppe absondert«, erklärte Daniela. »Wir gehen gruppenweise an Land. Die beiden Genannten haben gegen die elementaren Vorsichtsmaßnahmen verstoßen. Woher wissen Sie, dass Mister Chilpern ein Detektiv war?«
»Lord Arthur plauderte aus der Schule. Warum sagen Sie ›war‹? Es gibt doch keinen Beweis, dass er tot ist, oder?«
»Es ist keine Lösegeldforderung für ihn eingegangen, und er hat sich nicht wieder gemeldet. Das gibt doch zu denken, nicht wahr?«
»Sie beurteilen das reichlich kühl.«
»Ich finde es furchtbar, dass dem armen Mann offenbar etwas zugestoßen ist. Doch wenn ich weine und wehklage, würde das nichts ändern.«
»Nein. Chilpern hat an Bord der ›Amber‹ Nachforschungen angestellt, Miss Aiken. Warum wohl? Was hat er gesucht und erfahren?«
»Ich bin keine Hellseherin. Warum interessiert Sie das? In unserem Computer sind Sie als Industrieller gespeichert. Ist das verkehrt? Sind Sie ein Detektiv oder nur besonders neugierig?«
»Ich bin überhaupt nicht neugierig, ich weiß nur gern alles. Besonders gern kläre ich Geheimnisse auf, und hier liegt eins vor. Würden Sie mir dabei behilflich sein. Miss Aiken?«
»Bedaure, da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Wenden Sie sich an unseren Sicherheitsbeauftragten an Bord. Das ist der Dritte Offizier, Buster Maine. Er hat mehrere Mitarbeiter, weiß alles und ist sehr diskret.«
»Ich wollte schon lange mal jemanden treffen, der alles weiß. Bisher dachte ich immer, dazu müsste ich erst sterben und vor den höchsten Richter treten.«
Daniela Aiken war darauf aus, das Gespräch zu beenden. Bount hatte den Eindruck, dass ihr das Thema unangenehm war. Sie deutete auf den Tisch mit dem Telefon.
»In dem Heft dort mit dem Bordnummernverzeichnis finden Sie auch die von Mister Maine. Wenn Nachforschungen Ihre Spezialität sind, sind Sie bei ihm sicher richtig. Wir haben nichts zu verbergen. An Bord der ›Amber‹ geht alles mit rechten Dingen zu. Jene Vorfälle, auf die Sie anspielten, sind bedauerliche Geschehnisse, wie sie sich in Hafenstädten ereignen können. Sie sind nicht spezifisch für die ›Amber‹. Sie sollten wirklich Ihre Urlaubskreuzfahrt und die Schönheiten der Karibik genießen, statt sich um solch unangenehme Dinge zu kümmern, Mister Reiniger. Entschuldigen Sie mich jetzt. Wir sehen uns dann im Ballsaal zur Begrüßung. Bitte ziehen Sie Ihren Smoking an. Es herrscht Krawattenzwang. Oder Fliege oder Schleife.«
Daniela rauschte hinaus. Der Duft eines dezenten Parfüms blieb. Bount überlegte, ob er nicht zu direkt gefragt habe. Andererseits musste er ein Risiko eingehen, und ihm war an einer möglichst schnellen Aufklärung gelegen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass alle rund siebenhundert Besatzungsmitglieder der ›Amber‹ Verbrecher waren.
Bei den Gangstern an Bord musste es sich um eine kleine, allerdings maßgebliche und womöglich gefürchtete Gruppe handeln. Bei den redlichen Besatzungsmitgliedern hoffte Bount Unterstützung zu finden. Er duschte und zog sich um. Bald würde es Zeit sein, zum Dinner und danach in den Ballsaal zu gehen, wo der Kapitän die Begrüßungsrede halten und eine Gruppeneinteilung erfolgen würde.
Denn abgesehen von dem horrenden Preis für die Kreuzfahrt versuchte man den Passagieren durch Extraveranstaltungen und die Bewirtung noch einiges aus der Tasche zu ziehen. Zwar gehörte zu einer Passage Vollpension. Doch schon die Drinks an den diversen Bordbars summierten sich, und wenn jemand nicht aufpasste, konnte er gut und gern noch mal den Preis der Passage verbraten.
Andererseits konnte man, wenn man sich einschränkte und die Dollarfallen mied, damit und mit einem Taschengeld über die Runden kommen, vorausgesetzt, dass man sich bei den Landgängen die Geldbörse zunähte.
Bounts Problem war das nicht. Er hatte ein ganz anderes. Er konnte an Bord der ›Amber‹ ausgeben, soviel er wollte. Die Reederei stand dafür gerade. Vor Jahren wäre das für ihn ein Traum gewesen. Jetzt verspürte er gemischte Gefühle.
»Geld allein«, sagte er, als er vor dem Spiegel die Schleife zurechtzog und den Sitz der Automatic unter dem Jackett prüfte, »macht nicht glücklich.«
*
Bount hatte an Ausrüstung in seinem Koffer einen Scanner zum Aufspüren von Minispionen, ein Abhörset, Gasmaske, Blend- und Gasgranaten sowie ein in einem Koffer eingebautes leistungsfähiges Funkgerät mitgebracht. Ein Nachtsichtgerät gehörte auch noch dazu. Zudem eine Scorpion MPi, Kaliber 31, die kaum größer war als eine großkalibrige Pistole. Er war also gut sortiert – oder hätte es sein sollen.
Denn als er die betreffenden Koffer öffnen wollte, stellte er fest, dass man sie vertauscht hatte. Seine Wäsche und Garderobe waren angeliefert. Die Ausrüstung fehlte. Bount kribbelte es im Nacken. Er spürte das Wirken eines mächtigen, ihm noch unbekannten Feindes.
Obwohl überzeugt, dass das kein Zufall war, rief er den Decksservice. Ein Steward erschien, der einen Schiffsoffizier herbeiholte. Der fragte bei dem Ehepaar nach, dessen Koffer Bount statt der seinen gebracht worden waren. Das Ehepaar vom Kabinendeck hatte seinerseits reklamiert, dass zwei Gepäckstücke fehlten. Bounts Koffer hatte das Ehepaar nicht erhalten.
Dem Offizier war die Geschichte peinlich.
»Natürlich erhalten Sie Ihr Gepäck, Mister Reiniger. Es kann schließlich nicht verloren gegangen sein. Auf der ›Amber‹ kommt nichts weg.«
Außer Menschen, Schmuck und so weiter. Bount hatte Daniela Aiken zuvor absichtlich nicht mit allem konfrontiert, was er wusste. Er wollte nicht zu gut unterrichtet erscheinen. Jetzt fragte er sich, ob das überhaupt einen Zweck hatte, denn wenn seine Ausrüstung fehlte, bedeutete dies, dass die Gegenseite seine Rolle längst durchschaut hatte.
Dann reiste er auf einer schwimmenden Todesfalle. Der Offizier versprach, sich um die Sache zu kümmern und verschwand mit dem Steward. Bount suchte den mahagonigetäfelten Erster-Klasse-Speisesaal auf, in dem ein schwerer Kristalllüster von der Decke hing. Das Verschwinden seiner Ausrüstung hatte ihm den Appetit nicht verdorben. Er dachte auch nicht daran, seine Mission abzubrechen.
Seine Automatic und die dazugehörige Munition hatte er. Bount verließ sich auf seinen Verstand und seinen durchtrainierten Körper. Er improvisierte gern und gekonnt.
Bount bestellte sich eine Seezunge. Er hatte kaum zu essen begonnen, als sich Carmen Lopez zu ihm gesellte. Sie rauchte eine filterlose Zigarette.
»Essen Sie ruhig weiter, Mister Reiniger, Sie stören mich nicht beim Rauchen. Lord Arthur sagte mir, Sie wären Tierfutterfabrikant? Das stelle ich mir als Beruf ziemlich uninteressant vor. Reizt es Sie nicht, ab und zu etwas Gefährliches zu erleben?«
»Ganz und gar nicht«, behauptete Bount. »Ich bin ein staatlich geprüfter Feigling. Zu Hause getraue ich mich nicht mal allein in den Keller. Was treiben Sie denn, wenn Sie nicht gerade eine Kreuzfahrt unternehmen und fremden Männern beim Essen den Rauch ins Gesicht blasen?«
»Sie sind ein Flegel und machen sich über mich lustig.«
»Das würde ich mir nie erlauben. Ich habe Sie etwas gefragt.«
»Ich gebe das Geld meiner Familie aus«, sagte Carmen. »Mein Vater hat an der Wall Street ein Vermögen eingesackt. Dann erlag er einem Herzinfarkt, der Arme. Jetzt bemühe ich mich als gerechten Ausgleich, das von ihm zusammenspekulierte Geld wieder unter die Leute zu bringen. Das ist harter Job, Mister Reiniger, das kann ich Ihnen versichern.«
»Sie haben mein tiefes Mitgefühl. Gelegentlich helfe ich Ihnen gern beim Geldausgeben.«
Bounts Augen funkelten spöttisch, aber auch wachsam. Er bemerkte an einem Nachbartisch einen weißuniformierten Mann mit eigenartig glänzenden Augen und stecknadelkopfgroßen Pupillen.
Carmen Lopez war seinem Blick gefolgt.
»Das ist Miguel Segueiras, der Bordarzt. Ein phantastischer Kerl und amüsanter Unterhalter, wenn er sein Spritzchen hat. Sie verstehen, Mister Reiniger?«
»Was spritzt er? Heroin oder Morphium?«
»Was würden Sie bei einem Mediziner denn vermuten?«
»Morphium. Diese Sucht ruiniert einen Menschen nicht ganz so schnell wie das Heroin. Woher sind Sie so gut informiert, Miss Lopez, dass Sie den Schiffarzt und seine Schwäche kennen?«
Die schwarzhaarige schöne Carmen blieb Bount die Antwort schuldig. Bount fragte sich, ob das ihre erste Fahrt mit der ›Amber‹ war. Oder ob sie in einem besonderen Auftrag handelte. Sie schaute auf seine Achsel.
»Sie tragen eine Schusswaffe bei sich, Mister Reiniger.«
Es gehörte ein scharfes Auge dazu, das zu entdecken. Bount hatte die Mahlzeit beendet und zündete sich ebenfalls eine Zigarette an.
»Ein Teil meines Angstkomplexes«, sagte er leichthin. Er deutete zu der Uhr an der Wand. »Es ist Zeit, in den Ballsaal zu gehen. Darf ich Sie begleiten?«
»Ich suche mir lieber einen mutigeren Kavalier. Einstweilen jedenfalls. Eine Frage noch, Mister Reiniger. Was ist der Zweck Ihrer Kreuzfahrt?«
»Mich zu entspannen und über ein revolutionierendes Hundefutter nachzudenken«, schwindelte Bount unverschämt.
Carmen verließ ihn empört. Bount hatte den Eindruck, dass sie aus ihm ebenso wenig schlau wurde wie er aus ihr. Er erwog, sich ihr zu erkennen zu geben und seine wirkliche Absicht zu erläutern. Aber das schob er noch ein wenig auf. Schließlich wollte er sich nicht an die falsche Adresse wenden.
Er verließ den Speisesaal, orientierte sich, was am Anfang noch verwirrend für ihn war, und fuhr mit dem Lift aufs Promenadendeck, wo sich neben dem Restaurant und der geschlossenen Promenade der festlich hergerichtete Ballsaal befand. Männer im Anzug oder Smoking und schmuckbehangene Frauen im Abendkleid tummelten sich hier.
Alle Passagiere sollten der Begrüßungsparty beiwohnen können.
Bount sah den wettbegeisterten Lord Arthur, der mit einer qualmenden Meerschaumpfeife im Mund herumschlenderte, und den in seinen Rollstuhl geduckten, verbiesterten Rudy Safford mit seinem Pfleger. Safford hatte als einziger keine Krawatte angelegt, sondern trug ein offenes Hemd und eine vergammelte Wolljacke. Sein Pfleger prangte im guten Dunkelblauen.
»Hallo, Mister Safford«, sagte Bount freundlich, um den Jungen in eine Unterhaltung zu ziehen. »Freuen Sie sich auf die Kreuzfahrt?«
»Einen Dreck freue ich mich«, giftete Safford. »Was geht Sie das überhaupt an?«
Der Pfleger schwieg mit betretenem Gesicht. Er kannte die Launen seines Herrn.
»Ich wollte Sie nicht ärgern, Mister Safford. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass Ihnen scheußlich zumute ist. Ich habe auch keinen Trost für Sie. Aber dadurch, dass Sie die ganze Welt hassen und vergiften wollen, wird es Ihnen auch nicht besser ergehen.«
Weitere Kommentare ersparte er sich. Im menschenwimmelnden Foyer und jetzt überhaupt war nicht der Zeitpunkt, Safford einen Vortrag über die Meisterung seines schweren Schicksals zu halten. Dazu musste er die Kraft in sich selbst finden.
»So, Sie können sich das vorstellen?« Safford wäre Bount am liebsten ins Gesicht gesprungen. »Wie denn, bitte? Woher wollen Sie wissen, wie mir zumute ist? Ihnen war vielleicht schon mal der Fuß eingeschlafen, aber von einer Querschnittlähmung haben Sie überhaupt keine Ahnung. Was erlauben Sie sich eigentlich, mich einfach anzusprechen? Ich will Ihre Gesellschaft nicht. Wenn Sie mich bemitleiden und darum nett zu mir sein wollen, das können Sie sich schenken. So weit, dass ich Ihr Mitleid brauche, bin ich denn doch nicht!«
Bount wandte sich ab. Da war jedes weitere Wort vergebens. Safford hatte mit seiner lauten Stimme Aufsehen erregt. Man schaute zu ihm und Bount hin und tauschte Bemerkungen hinter der vorgehaltenen Hand aus. Saffords Pfleger sagte leise etwas zu ihm.
»Du hast mich nicht zu belehren, du blöder Nigger!«, wurde er angefaucht.
Der Pfleger rollte Safford in seinem Rollstuhl auf den Saaleingang zu. Ein Steward wollte die fehlende Krawatte des Querschnittgelähmten bemängeln. Doch der Zahlmeister brachte ihn mit einem Wink zum Schweigen und winkte Safford durch. Safford titulierte ihn dafür vernehmlich als Blödmann.
Der Saal füllte sich. Bount sah Daniela Aiken in einem tollen, ausgeschnittenen Kleid. Kapitän Anthony Rivers und seine Schiffsoffiziere erschienen auf der Bühne, um sich vorzustellen. Sie trugen ihre Ausgehuniformen.
Rivers war ein stattlicher dunkelblonder Seebär mit angegrauten Schläfen und einem gepflegten Vollbart. Sekt und Aperitifs wurden gereicht. Sie waren im Kreuzfahrtpreis inbegriffen. Kapitän Rivers hieß alle durchs Mikrophon und über Lautsprecher willkommen. Die Passagiere hatten auf den Sitzreihen, an Tischen und auf der Galerie Platz genommen. Durch die verglasten Wände sah man übers Deck und auf die dunkle See.
Rivers hatte kaum mit seiner launischen Ansprache begonnen, als Lord Arthur Bount anstieß und sich zu ihm beugte.
»Wetten, dass er genau das gleiche erzählt wie beim letzten Mal? Habe den Text hier. Hundert Dollar?«
»Um einen Drink.«
»Sie sind vielleicht eine Spielernatur! Na, besser als gar nichts. Einverstanden.«
Lord Arthur drückte Bount ein Blatt Papier in die Hand und ging wieder zu seinem Platz. Bount verfolgte nur die ersten Sätze. Der Lord hatte sich getäuscht. Der Kapitän wich vom niedergeschriebenen Text ab. Er nannte die Schiffsoffiziere und sagte, an wen sich die Passagiere jeweils wenden könnten. Der übermäßig hagere Schiffsarzt mit dem schütteren schwarzen Cäsarenschnitt verbeugte sich wie die anderen.
Die Augen des ausgemergelten Mannes lagen tief in den Höhlen. Er sah aus, als hätte ihm die Sucht alles überflüssige Fleisch von den Knochen gebrannt. Der Dritte Offizier und Sicherheitsbeauftragte Buster Maine fiel Bount besonders auf. Er war ein dunkelhaariger, drahtiger, schnurrbärtiger Typ.
Bount stufte ihn als gefährlich ein. Der Erste Offizier war auch nicht ohne, der Zweite nichtssagend. Kapitän Rivers empfahl sich. Der Chefanimateur erläuterte die hauptsächlichen Veranstaltungen der nächsten Tage und wies auf das Bordprogramm hin. Anschließend spielte die Bordkapelle zum Tanz auf.
Jetzt begann der gemütliche Teil. Safford ließ sich hinausfahren und schimpfte dabei vernehmlich über das sinnlose Gehopse, wie er es nannte. Dabei brannten Tränen in seinen Augen, denn er würde nie wieder tanzen können. Bount hätte ihm gern Mut und Zuversicht gegeben.
Doch wie sollte er das? Plötzlich merkte er, dass er beobachtet wurde. Er spürte förmlich den durchdringenden Blick, der auf ihm ruhte. Als er hochschaute, sah er den Dritten Offizier auf der Galerie stehen. Buster Maine fixierte ihn. Mit einer Kopfbewegung wies er zwei kräftige Seeleute auf Bount hin.
Dann drehte er sich abrupt um und verschwand.
*
Eine Weile später suchte Bount die offene Promenade am Vorderdeck auf. Er rauchte eine Zigarette und schaute zum erleuchteten breiten Fenster der Kommandobrücke und dem hinter ihr aufragenden Radarmast mit der Parabolantenne auf. Frische Seeluft umwehte ihn. Mit 29 Knoten pro Stunde rauschte die ›Amber‹ durch die See. Die Positionslampen brannten. Aus Dem Ballsaal wehte Musik.
Bount hörte Stimmen und Lachen. Er schlenderte am vorderen Ladebaum vorbei und an den Bug. Im Schatten des Ankerspills sah er eine zusammengekauerte Gestalt im Rollstuhl. Ein trockenes Schluchzen drang zu ihm. Er zog sich diskret zurück. Rudy Safford war ganz allein. Er hatte seinen Pfleger weggejagt und ließ sich den Seewind um die Ohren wehen.
Möwen flogen über ihn hinweg.
»Warum ausgerechnet das?«, hörte Bount Rudy Safford verzweifelt stöhnen. »Warum bin ich bei dem Unfall nicht gestorben? Warum bin ich an dieses Ding gefesselt?«
Er meinte den Rollstuhl. Bount erreichte wieder den erhöht stehenden Ladebaum. Durch den Decksaufbau konnte man zu den Kabinen der Touristenklasse sowie zu den Räumen der Besatzung gelangen. Im Niedergang war die Beleuchtung ausgefallen.
Bount sah dort einen zusammengeduckten Mann stehen und stutzte. Im selben Moment, ohne dass er ein Geräusch gehört hätte, wurde ihm von oben eine Drahtschlinge um den Hals geworfen. Zwei Männer hatten auf dem Aufbau gelegen. Der eine würgte Bount. Der andere sprang hinunter.
Er trug eine übers Gesicht herabgezogene Wollmütze mit Sehschlitzen und Zivilkleidung. Er schwang einen Handhaken, wie man ihn zum Verstauen der Ladung benutzte. In der Hand eines damit Geübten war ein solcher Haken eine mörderische Waffe.
»Ich schlage dir den Schädel ein, Schnüffler!«, zischte der Maskierte. »Dann fliegst du über Bord und kannst den Golfstrom von unten kennen lernen!«
Der Würger und der dritte Mann, der jetzt aus dem Niedergang sprang und in dessen Hand ein kurzes Messer blitzte, waren ebenfalls maskiert. Bount kämpfte verzweifelt. Die Drahtschlinge schnürte ihm Luft und Blutzufuhr ins Gehirn ab.
Trotzdem gelang es ihm, dem Maskierten mit dem Handhaken einen Tritt zu versetzen, so dass er zurücktaumelte. Bount griff nach der Automatic. Der Mann mit dem Messer schlug sie ihm aus der Hand. Bount war schon halb hinüber. Mechanisch wehrte er den Messerstich ab.
Er war erledigt. Der Mann mit dem Stauerhaken griff wieder an. Bount hing bereits in der Schlinge. Aus! schoss es ihm durch den Kopf. Er war erkannt worden und scheiterte mit seinem Auftrag, noch bevor er ihn recht begonnen hatte.
Da hörte Bount eine Stimme und das metallische Klingen, als ein Rollstuhlrad gegen die Reling stieß. Mit verschleiertem Blick sah er Safford in seinem Rollstuhl heranfahren, ein Metallstück, das er irgendwo aufgehoben hatte, in der rechten Hand.
»Verfluchte Mörder!«, schrie der Gelähmte mit einer Stimmkraft, die man ihm nicht zugetraut hätte. »Wollt ihr den Mann wohl loslassen? Da habt ihr – und da – und da!«
Der Angriff des Rollstuhlfahrers erfolgte so überraschend und war so ungewöhnlich, dass die drei Verbrecher sekundenlang völlig verdutzt waren. Safford schlug mit dem kantigen Eisenteil zu. Mut hatte er – und auch kräftige Arme. Er verstand es, mit seinem Rollstuhl umzugehen. Er wendete ihn einhändig auf der Stelle, beugte sich vor und knallte dem Maskierten mit dem Stauerhaken das Eisenstück an den Schädel.
Der Maskierte ließ den Haken fallen und taumelte zurück. Zweifellos hatte er eine Beule und eine blutige Platzwunde. Bount konnte die mörderische Schlinge um seinen Hals lockern. Er riss an dem Drahtseil, fasste nach hinten und erwischte den Würger am Kragen. Mit einem kräftigen Ruck riss er den Würger vom Aufbau herunter.
Der Mann krachte auf die Planken und rollte bis an die Reling, wo er stöhnend liegen blieb. Bount streifte die Drahtschlinge über den Kopf und atmete pfeifend ein. Es war herrlich, wieder Luft schöpfen zu können. Das Wundervollste, was ihm seit langem widerfahren war.
Der noch unangeschlagene Bursche griff mit seinem Messer Rudy Safford an. Safford in seinem Rollstuhl wich nicht zurück. Er drohte dem Maskierten mit seiner Schlagwaffe.
»Na los, du Scheißkerl!«
Der Kerl sprang zur Seite, um Safford zu täuschen und zustechen zu können. Bei dem Versuch, seinen Rollstuhl zu wenden, stürzte Safford und kippte samt Stuhl an Deck. Sein Unterkörper und die Beine, beides gelähmt, hingen wie leblos an ihm und behinderten ihn. Der Killer sprang hinzu.
Doch da war Bount Reiniger da. Er packte den Arm des Messerstechers und hebelte ihn herum. Der Bursche jaulte auf. Das Messer flog weg. Der Mann sackte zu Boden. Sein rechter Arm baumelte schlaff herunter. Bount hatte ihn ruckartig ausgekugelt.
Er wandte sich Safford zu, der an Deck herumkroch.
»Sind Sie verletzt?«
»Nein.«
Als Bount seine Pistole aufhob, flohen die drei Maskierten. Sie verschwanden auf der Backbordseite hinter dem Aufbau der hochragenden Kommandobrücke, aus derem breiten Bugfenster helles Licht schimmerte. Den Kampf an Deck hatte man von der Kommandobrücke aus nicht bemerkt.
Bount jagte hinter den Schlägern her, konnte sie jedoch nicht stellen. Sie kannten sich an Bord besser aus als er und wussten alle Schlupfwinkel und Fluchtwege. Zweifellos handelte es sich um Mitglieder der Besatzung. Schon die Bemerkung des Würgers über den Golfstrom ließ auf einen Seemann schließen.
Bount kehrte zu Rudy Safford zurück, der vergeblich versuchte, seinen Rollstuhl wieder aufzustellen und hineinzugelangen. Zunächst lehnte er Bounts Hilfe ab. Erst als er es allein nicht schaffte, ließ er sich von Bount in den Rollstuhl helfen und die Decke über seine Beine breiten.
»Sie haben mir das Leben gerettet«, sagte Bount. »Das werde ich Ihnen nie vergessen.«
»Ach, nicht der Rede wert. So jämmerlich bin ich nun auch wieder nicht, dass ich tatenlos zusehe, wie drei Kerle einen einzelnen Mann umbringen. Warum hatten es die Kerle auf Sie abgesehen? Unglaublich, dass hier Gangster an Bord sind.«
Safford nahm wieder Anteil an seiner Umgebung. Er fühlte sich wichtig und nützlich, was zuvor nach seiner eigenen Ansicht bei ihm nicht der Fall gewesen war.
»Das kann ich Ihnen schlecht an Deck erklären«, sagte Bount. »Ich heiße Bount Reiniger, Privatdetektiv aus New York. Ich bin hier, um einen Kriminalfall aufzuklären. Jetzt muss ich erst mal zum Kapitän und versuchen, die drei Schurken gleich zu erwischen.«
»Dann erwischen Sie mal«, sagte Safford schroff. So leicht konnte er aus seiner Reserve nicht heraus. Von einem Moment zum anderen änderte sich seine Lebenseinstellung nicht. »Ich schaffe es allein in meine Kabine. Viel Glück, Mister Gangsterjäger, und passen Sie in Zukunft besser auf sich auf, damit Sie auch ohne die Hilfe eines Krüppels überleben.«
Mit diesen bitteren Worten rollte Safford davon.
3.
Bount wandte sich an den Kapitän, der den Ballsaal verließ und sich mit ihm unter vier Augen in seiner Kabine unterhielt. Bount hatte darum gebeten. Kapitän Rivers protestierte lautstark dagegen, dass sein Schiff eine schwimmende Gangsterhöhle sei.
»Das ist nie und nimmer der Fall! Es gibt keinen Beweis, dass diese drei Maskierten Mitglieder meiner Besatzung waren. Es kann sich ebenso gut um Passagiere gehandelt haben.«
»Das glauben Sie doch selbst nicht, Kapitän. Die drei Männer hatten es gezielt auf mich abgesehen, weil ich an Bord Nachforschungen anstellen will. Ohne Rudy Saffords Eingreifen hätten sie mich umgebracht und über Bord geworfen. Es sind schon mehr Leute von diesem Schiff spurlos verschwunden.«
»In den Hafenstädten, ja. Daraus kann man mir keinen Strick drehen.« Rivers ging erregt auf und ab. »Es mag sein, dass sich unter meinen siebenhundert Besatzungsmitgliedern eine Handvoll schwarzer Schafe befinden. Doch dass eine komplette Gangsterbande die ›Amber‹ als Hauptquartier und schwimmende Operationsbasis benutzt, weigere ich mich zu glauben. Was sollten sie hier denn anfangen? So tolle Möglichkeiten gibt es auf dem engen und überschaubaren Raum nicht. Die Fluchtwege sind abgeriegelt. Nein, das kann nicht der Fall sein.«
Bount erwähnte Braxter, Canarsie und den schwarzen Hilfsmaschinisten mit dem goldenen Ohrring, der nach dem Doppelmord in New York nicht mehr an Bord zurückgekehrt war.
»Dafür bin ich nicht verantwortlich.« Rivers wand sich. »Ich habe als der Schiffsführer seemännische Aufgaben. Ich kann nicht ständig hinter jedem einzelnen von meiner Besatzung stehen.«
»Sie sind auch für das Wohlergehen Ihrer Passagiere verantwortlich«, erwiderte Bount. »Und Sie müssen Ihre Mannschaft kennen. Die meisten sind bereits längere Zeit an Bord. Sie leben auf engem Raum mit diesen Leuten zusammen. Da muss Ihnen doch Verschiedenes auffallen.«
»Auf was wollen Sie hinaus, Mister Reiniger?«
»Ich will wissen, ob Sie für oder gegen mich sind, Kapitän Rivers. Ihre Reederei erwartet, dass Sie mich unterstützen und gegen die Gangster an Bord vorgehen. Oder stecken Sie mit denen unter einer Decke oder werden vielleicht von ihnen bedroht?«
Bount hatte sich dem Kapitän als Privatdetektiv mit einem fest umrissenen Auftrag zu erkennen gegeben und sprach Klartext.
»Das ist eine Frechheit, das zu behaupten!«, fauchte Rivers ihn an. Sein wallender, parfümierter blonder Bart über den seemännischen Abzeichen schien sich zu sträuben, so erregte er sich. »Das werden Sie sofort zurücknehmen! Ich weiß von keinen Gangstermachenschaften, und damit Punktum! Ich habe keinen Detektiv angefordert, weder Sie noch vor Ihnen diesen penetranten Chilpern, dem man vermutlich wegen seiner schleicherischen Art in einem Kneipenhinterzimmer in Casablanca die Kehle durchgeschnitten hat. Ich kann an Bord meines Schiffs allein klarkommen. Als Sicherheitsbeauftragter und Schiffsdetektiv dient mir der Dritte Offizier, Mister Maine.«
»Offensichtlich können Sie es doch nicht, Rivers, nämlich klarkommen. Wenn Sie nichts wissen, dann sollte ich vielleicht an die Reederei telegrafieren, damit man Sie ablöst und jemanden einsetzt, der mehr weiß.«
Rivers atmete schwer.
»Ich kann Sie nicht daran hindern, das vorzuschlagen, Mister Reiniger, Wenn Sie mich für inkompetent halten, ist das Ihre Meinung, und es wird sich herausstellen, ob sich das mit der Ansicht der Reederei deckt. Ich kann auf dreißig Jahre seemännische Erfahrung zurückblicken und habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen. Unser Gespräch ist beendet. Ich lehne eine Zusammenarbeit mit Ihnen ab. Wenn es an Bord meines Schiffs verbrecherische Elemente zu entlarven und festzusetzen gilt, erledige ich das mit meinen Leuten und Mitteln. Sie haben mir nichts zu befehlen. Ist das klar?«
»Ich rede Ihnen nicht in Ihre seemännischen Aufgaben hinein, Kapitän«, sagte Bount. »Aber was die Schiffssicherheit und die Entlarvung der Gangster betrifft, werden Sie mit mir zusammenarbeiten und mich unterstützen müssen. Gegebenenfalls haben Sie meine Anweisungen auszuführen. Das erhalten Sie von Ihrer Reederei schriftlich. Jetzt erwarte ich, dass Sie sich darum kümmern, dass mein Gepäck mit meiner Ausrüstung gesucht wird. Zudem ist einer der drei Verbrecher, die mich angriffen, verletzt worden. Er braucht ärztliche Behandlung, um seinen ausgekugelten Arm wieder einzurenken. Sie werden mit Ihrem Schiffsarzt sprechen und verlangen, dass er Ihnen Meldung erstattet, wenn ein Mann mit ausgekugeltem Arm ihn aufsucht. Das geben Sie dann an mich weiter. Darüber hinaus verlange ich von Ihnen eine Aufstellung Ihrer Offiziere und Besatzungsmitglieder, die Sie als absolut zuverlässig ansehen.«
»Was den Anschlag auf Sie betrifft, Mister Reiniger, will ich die Schuldigen finden und den Behörden übergeben«, sagte der Kapitän. »Auch Ihr verschwundenes Gepäck wird gesucht, das ist selbstverständlich. Was jedoch die Kompetenzen und die Befehlsgewalt betrifft, frage ich zuerst bei meiner Reederei zurück und kläre das ab. Gute Nacht, Mister Reiniger.«
Der Kapitän kehrte Bount schroff den Rücken zu. Als Bount die Kabine verließ, begegnete er auf dem Gang Lord Arthur. Mit der Meerschaumpfeife im Mund, im Smoking eine gepflegte Erscheinung, lehnte Seine Lordschaft lässig an der Wand.
»Hallo, Mister Reiniger, haben Sie mit dem Kapitän geplaudert? Gibt es Neuigkeiten?« Der Mordanschlag auf Bount wurde geheim gehalten, schon um die Passagiere nicht zu erschrecken. »Wollen wir eine Wette abschließen?«
»Welche wieder? Die letzte haben Sie bereits verloren. Sie schulden mir einen Drink.«
»Können ihn gleich an der Bordbar nehmen, alter Junge. Von mir aus auch zwei. Ich wette, um was Sie wollen, dass Sie gar kein Tierfutterfabrikant sind. Ich habe mich nämlich erkundigt. Dog's Heaven und Friscat werden von einer Firma in Salt Lake City hergestellt. Sie sehen mir aber nicht wie ein Mormone aus.«
»Das täuscht, Sir Arthur. Ich habe meine sieben Frauen zu Hause gelassen, um einmal ausspannen zu können. Entschuldigen Sie mich jetzt.«
»Wetten, dass ich schon noch herausfinde, was wirklich mit Ihnen los ist?«, rief Lord Arthur hinter ihm her. Als Bount es nicht mehr hörte, murmelte er vor sich hin: »Unwirscher Bursche. Typischer zweckgerichteter Yankee. Jedem Wettspaß glatt abgeneigt. Möchte nur mal wissen, was auf ›Amber‹ vorgeht. Wird eine gefährliche Kreuzfahrt.«
Weil Rudy Safford wegen seines entschlossenen Eingreifens für Bount Repressalien ausgesetzt sein konnte, suchte Bount dessen Erster-Klasse-Kabine auf. Auf sein Klopfen hin öffnete jedoch nur der Pfleger.
»Mister Safford hat sich hingelegt«, erklärte er. »Er will niemanden sehen. Ihnen, Mister Reiniger, soll ich ausrichten, Sie sollten sich selber um Ihren Kram kümmern und Mister Safford in Ruhe lassen.«
Bount ging in den Ballsaal und suchte den Schiffsarzt auf, der vor Leben und Charme nur so sprühte. Segueiras musste sich eine Dosis gespritzt haben, die ausreichte, einen Elefanten anzutörnen.
»Ja, der Kapitän hat mich schon eingeweiht, und ich habe mein medizinisches Personal angewiesen«, sagte Segueiras. »Wenn sich bei mir oder einem Sanitäter ein Mann mit einem ausgekugelten Arm meldet, wird er sofort vom Dritten Offizier und seinen Sicherheitsleuten festgesetzt, und Sie werden verständigt, Mister Reiniger. Hören Sie diese Musik? Einfach wundervoll. Ich muss diesen Walzer tanzen. M-tata m-tata!«
Damit enteilte der Schiffsarzt. Kopfschüttelnd kehrte Bount um und begab sich in seine Kabine.
*
In der Kabine versuchte er zunächst mal ohne Scanner Minispione aufzuspüren. Er fand nichts, was jedoch nicht besagte, dass die Kabine frei davon war. Er öffnete die Bullaugen – er hatte auf einer Außenkabine bestanden – und keilte einen Stuhl unter die Tür. Danach erst legte er sich schlafen. Irgendwann gegen Morgen wachte er mit schwerem Kopf und benommen auf.
Er hörte ein leises Zischen aus dem Bad, richtete sich mühsam auf, fiel aus dem Bett und krabbelte auf allen vieren ans Bullauge. Er gelangte kaum hoch. Seine Glieder gehorchten ihm nicht. Mit schwindendem Bewusstsein erfasste er, dass man ihm durch die Lüftung im Bad Gas in die Kabine leitete.
Bount vermutete, dass es ein tödliches war. Er fiel zweimal um, ehe er das Gesicht ans Bullauge pressen konnte. Die frische, klare Seeluft belebte ihn und vertrieb die Schleier aus seinem Gehirn. Er sah die bewegte, im Mondschein glänzende See mit den weißen Wellenkämmen und den schwankenden Sternenhimmel darüber.
Durch die Bewegungen des Schiffes hatte Bount diesen Eindruck. Als er sich einigermaßen erholt hatte, hielt er die Luft an, holte seine Pistole, zog den Stuhl unter der Türklinke weg und schloss auf. Schweißgebadet taumelte er in den mit synthetischer, unbrennbarer Faser verkleideten Korridor.
Dort lehnte er sich erst mal an die Wand. Kein Mensch war zu sehen. Im Pyjama suchte er die Brücke auf. Er gelangte dorthin, nachdem er einmal die falsche Abzweigung gewählt hatte. Auf der Brücke mit den navigatorischen Einrichtungen hielten sich der Erste Offizier, der Navigationsoffizier und ein Maat auf. Der Maschinentelegraf links vom Steuerstand mit dem Ruder war auf dreiviertel gestellt. Der Betrieb auf der Brücke wirkte beruhigend normal. Instrumente summten, die Reflektion des Radarbilds ließ die Gesichter der Männer grünlich erscheinen.
Der Manövertelegraf klingelte. Man gab eine Anweisung an den Ingenieur. im Maschinenraum durch. Die Besatzung der ›Amber‹ war ein aufeinander eingespieltes Team, und, von den Gangsterstücken an Bord abgesehen, durchaus nicht untüchtig.
Der Erste Offizier, ein Wikingertyp mit wettergegerbtem Gesicht, bemerkte Bount zuerst.
»Ah, Mister Reiniger, haben Sie sich verlaufen?« Dann sah er die Pistole. »Was soll denn die Waffe? Wollen Sie sich als Pirat betätigen?«
Im Pyjama und mit dem Schießeisen sah Bount ungewöhnlich aus. Ihm stand der Sinn nicht nach Scherzen.
»Auf mich ist ein Gasanschlag verübt worden! Ich verlange, dass die Sache sofort untersucht wird!«
»Ein Gasanschlag? Sind Sie sicher?«
»Sehe ich vielleicht wie ein Idiot aus? Unternehmen Sie was, aber fix!«
Der Erste Offizier verständigte den Dritten Offizier Buster Maine. Der Schiffspolizist, wie Bount ihn für sich nannte, rückte mit zwei Maaten und einem Seemann an. Alle waren bewaffnet, erschienen jedoch nicht sonderlich aufgeregt.
»Immer mit der Ruhe«, erklärte Buster Maine. »Was ist passiert, Mister Reiniger?«
Bount erstattete Bericht. Maine ließ einen Gas-Chromatographen sowie einen Scanner holen. Dann begab man sich zwei Decks tiefer in Bounts Kabine. Das Zischen hatte aufgehört. Es war kein Geruch zu bemerken. Nur die würzige Seebrise wehte durch die geöffneten Bullaugen herein.
Der Dritte Offizier schnupperte. Er stellte den Gas-Chromatographen an, der auch noch eine geringe Gaskonzentration anzeigen sollte. Es erfolgte keine Anzeige des modernen Geräts, das elektronisch nach dem Halbleitersystem funktionierte. Mit dem Scanner fanden Maine und seine Helfer auch nichts.
Der Dritte Offizier salutierte spöttisch.
»Alles in Ordnung, Mister Reiniger. Wie Sie sehen, gibt es nichts Außergewöhnliches. Sie werden wohl schlecht geträumt haben.«
»Nichts ist in Ordnung. Ich werde sofort eine Funkmeldung an die Reederei und ans FBI absetzen. Sollte mir an Bord dieses Schiffs etwas zustoßen, wird man es bis auf die letzte Schraube auseinander nehmen, und zwar sofort. Sie wissen Bescheid, wer ich bin. Ist jener Gangster mit dem ausgekugelten Arm entdeckt worden?«
»Auf der Sanitätsstation ist niemand mit einer solchen Verletzung aufgetaucht. Ich bin vom Kapitän eingeweiht worden, Mister Reiniger. Selbstverständlich arbeite ich mit Ihnen zusammen, obwohl ich mich frage, ob Sie nicht einem Hirngespinst hinterher jagen. Welchen Zweck sollte es haben, eine Gangsterbande auf einen Ozeanliner zu schleusen? Vielleicht, um das versilberte Geschirr aus der Messe zu klauen?«
»Ich verbitte mir Ihre dummen Witze! Es ist schon genug geschehen.«
»Es hat Vorfälle gegeben.« Der drahthaarige, breitschultrige Maine wiegelte ab. »Doch sie rechtfertigen nicht, die ›Amber‹ als Gangsterschiff in Verruf zu bringen. Ich kläre das schon. Wir haben alles im Griff.«
»Auf dem Gangsterschiff«, bemerkte Bount gallig. »So wie AI Capone in seiner größten Zeit ganz Chicago, was?«
Er schaute sein Gegenüber unverwandt an. Seine 38er Automatic zeigte mit dem Lauf auf den Boden. Aber er hatte den Finger am Drücker und war bereit, sich zu verteidigen. Er traute dem Sicherheitsoffizier nicht über den Weg. Wenn möglich, wollte er den Zeitpunkt der Konfrontation bestimmen, weil er dann vorbereitet war.
Die Maate und der Seemann schauten den Dritten Offizier in seiner normalen Borduniform an. Spannung lag in der Luft. Die vier Besatzungsmitglieder waren bewaffnet.
Doch Buster Maine lachte Bount ins Gesicht.
»Sie leiden an einer überhitzten Phantasie, Mister Reiniger, und sehen die Dinge falsch. Funken Sie, wenn Sie unbedingt wollen. Ich habe nichts dagegen. Ich muss allerdings den Kapitän davon unterrichten, dass Sie einen unnötigen Wirbel veranstalten.«
»Wecken Sie von mir aus den Kapitän oder Neptun persönlich. Ich funke auf jeden Fall«, brummte Bount.
Er zog rasch Hose und Hemd über und schlüpfte in seine Slipper. Dann suchte er die Funkstation auf, wo man ihm keine Schwierigkeiten bereitete. Der Kapitän ließ nichts von sich hören, würde jedoch stocksauer sein. Darauf konnte Bount keine Rücksicht nehmen. Als er sich wieder hinlegte, war er sicher, dass man sich einen weiteren Gasanschlag gut überlegen würde.
Leider war er mit den Versorgungsanlagen auf der ›Amber‹ noch nicht so vertraut, dass er eine fachgerechte Überprüfung hätte vornehmen und feststellen können, woher das Gas genau geleitet worden war. Davon abgesehen fehlte ihm seine Ausrüstung, zu der auch die Geräte und Mittel zur Spurensicherung gehörten. Er hatte ziemlich schlechte Karten.
Lord Arthur hätte vermutlich nicht auf ihn gegen die Gangster gewettet – oder mit eins zu tausend.
*
Mit der Reederei, deren Funkstation Tag und Nacht in Betrieb war, und dem FBI in New York hatte Bount vereinbart, dass er sich jeden Tag melden würde. Das war eine Lebensversicherung für ihn und sollte verhindern, dass er sang- und klanglos über Bord flog und das zunächst nicht weiter auffiel. Am nächsten Morgen suchte er nach Rudy Safford, den er im Speisesaal fand.
»Ah, Mister Reiniger, ich wollte Sie gerade aufsuchen.« Safford hatte seinem Pfleger frei gegeben, damit er ins Schwimmbad konnte. Er wollte sich nicht dauernd bemuttern lassen. »Wie geht es Ihnen?«
Safford wirkte weniger verbiestert und irgendwie energiegeladen. Er wollte wissen, was auf der ›Amber‹ vorging. Am Vorabend war er mürrisch gewesen, weil Bount ihn nicht sofort aufgesucht hatte. Von Stack Russen, dem Pfleger, war er wieder weggeschickt worden. Jetzt ließ die Neugierde Safford keine Ruhe.
»Im Moment gut. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten?«
»Im Lesesaal. Der ist leer. Aber erst, wenn ich fertig gefrühstückt habe.«
Schon eilte ein Steward herbei und erkundigte sich nach Bounts Wünschen. Bount frühstückte auch gleich. Als er Safford dann zum Fahrstuhl schieben wollte, lehnte der junge Mann ab.
»Ich kann meinen Rollstuhl schon selber bewegen. Was meinen Sie, ob ich einen Formel-Eins-Motor reinbauen lassen soll? Das Problem wären dann bloß die überbreiten Reifen.«
»Dafür werden Sie zweifellos eine technische Lösung finden.«
Der Lesesaal war verlassen, wie Safford erwähnt hatte. Nur die Bibliothekarin gähnte vor sich hin und dämmerte über einem Krimi. Bount und Rudy Safford begaben sich in eine Ecke und nahmen sich jeder eine Schwarte als Alibi. Sie unterhielten sie halblaut, was keinen störte, weil sie allein waren.
Bount erzählte die ganze Geschichte.
»Sie haben ein Anrecht darauf, zu erfahren, in was Sie da eingegriffen haben, Mister Safford.«
»Rudy.«
»Bount.«
Sie schüttelten sich die Hand. Saffords Händedruck war bemerkenswert fest. Seine Wangen hatten sich gerötet. Der missvergnügte, verbiesterte Ausdruck war aus seinem Gesicht verschwunden.
»Ich brauche dich als Reserve, Rudy. Ich will dich nicht in Gefahr bringen. Sollte mir etwas zustoßen, musst du weitergeben, was ich bereits herausgebracht habe.«
»Ich will aber aktiv mitwirken, Bount.«
»Es ist zu gefährlich. Außerdem, wie wolltest du das?«
»Ach was, gefährlich! Ich habe mir die ganze letzte Zeit überlegt, ob ich nicht Schluss machen soll – und war drauf und dran. Jetzt sehe ich endlich mal wieder einen Sinn in meinem Leben. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich bin beweglicher und kann dir nützlicher sein, als du denkst Auch wenn ich im Rollstuhl sitze, wenn ich irgendwo hin will, dann schaff ich das auch. In der letzten Nacht zum Beispiel wäre der große Bount Reiniger ohne mich ganz schön aufgeschmissen gewesen. Dann ist noch Stack Russen da. Er wird mir und dir helfen. Stack hat bei der Army eine Nahkampfausbildung erhalten und kann schießen. Er ist ein cleverer Bursche. Wir drei zeigen es diesen Gangstern.«
»Sieht so aus, als ob ich einen Partner gewonnen hätte«, sagte Bount lächelnd. »Auf gute Zusammenarbeit, Rudy.«
Bount wollte Safford nicht über Gebühr in Gefahr bringen. Doch der Bursche war auf jeden Fall zuverlässig. Bount konnte seine Unterstützung gebrauchen. In der Kabine des Millionenerben hielten sie weiteren Kriegsrat. Russen wurde hinzugezogen, als er von seiner Schwimmstunde zurückkehrte.
Wie sich herausstellte, hatte Safford eine Pistole in seinem Gepäck.
»Ich spielte mit dem Gedanken, mich damit zu erschießen«, sagte er freimütig zu Bount. »Jetzt können wir die Knarre für andere Zwecke gebrauchen. Ich erschieße mich nicht mehr. Ich kann allerlei leisten, schätze ich.«
»Ja«, sagte Bount. »Ich weiß noch immer nicht, was der Zweck dieses Gangsterschiffs ist. Die beiden Entführungen und der Schmuckdiebstahl rechtfertigen nicht die Morde und all den Aufwand, der da betrieben wird. Für mich sind das sekundäre Verbrechen.«
»Wie sind die Kidnappings begangen worden?«
»In den Hafenstädten, die ich schon nannte. In beiden Fällen erhielten die Opfer beim Landgang einen Knockout-Drink in einer Bar. Der eine Entführte hatte sich von einer Lockvogel-Lady umgarnen lassen. In deren Armen in einem Separee verließ ihn das Bewusstsein. Das zweite Opfer, eine Frau, brach nach dem Genuss des Knockoutdrinks zusammen. Ein falscher Krankenwagen mit getürktem Personal brachte sie weg. Beide erwachten in verdunkelten Verliesen, ohne zu wissen, wo sie sich aufhielten. Sie waren wochenlang ohne Kontakt zur Außenwelt. Sobald das Lösegeld bezahlt worden war, wurden sie wieder betäubt und wachten dann jeweils in einem Park auf. Völlig ausgeplündert und nur mit dem bekleidet, was sie am Leib trugen. Sie gingen zur Polizei, und das Konsulat ermöglichte ihnen die Heimreise oder nahm mit der Familie Verbindung auf. Der Schmuckdiebstahl hat so stattgefunden, dass der Kabinensafe nach dem Auslaufen von Santo Domingo leer war. Die Millionärin, der die Pretiosen gehörten, war reichlich exaltiert und wollte ihren Schmuck immer bei sich haben.«
»Hm«, sagte Safford. »Die Entführungen sind demnach nicht von Besatzungsmitgliedern verübt worden. Die ›Amber‹ war jeweils längst ausgelaufen, wenn das Lösegeld bezahlt wurde, und Hunderte von Seemeilen weg.«
»So ist es«, erwiderte Bount. »Diese Verbrechen könnten unabhängig von der ›Amber‹ stattgefunden haben, wenn da nicht der mysteriöse Unfalltod eines Seemanns, Chilperns Verschwinden und der Doppelmord in New York wären. Ich sehe das so, dass die Gangster an Bord der ›Amber‹ mit kriminellen Elementen in den jeweiligen Hafenstädten, die der Ozeanliner auf seiner Kreuzfahrt anläuft, in Verbindung stehen.«
»Aber wozu?«, fragte Safford. »Um ihnen alle Jubeljahre mal ein Kidnapping-Opfer in die Hände zu spielen? Das lohnt für die ›Amber‹ – Gangster nicht. Von dem Lösegeld würden sie bloß einen geringen Teil erhalten, ein Trinkgeld, denn das Risiko liegt ja bei den anderen.«
»So ist es. Der Schmuckdiebstahl, na ja, das sind alles Zusatz- und Nebeneffekte. Dafür bringt man niemanden um. Mich interessiert, welche ganz große Sache dahintersteckt.«
Safford schnippte mit den Fingern.
»Rauschgift vielleicht! Die ›Amber‹ könnte ein schwimmendes Rauschgiftdepot sein. Man könnte mit ihr große Rauschgiftmengen in jene Hafenstädte schmuggeln.«
Bount schüttelte den Kopf. »Das Rauschgift wird aus Südamerika und eventuell über Karibik-Hafenstädte in die USA gebracht, nicht umgekehrt.«
Stack Russen hörte interessiert zu.
»Dann wird es das sein!«, rief Safford. »Die ›Amber‹ bunkert Rauschgift und bringt es nach New York.«
Bount musste Safford und Russen enttäuschen.
»Nein. So schlau sind das FBI und die US-Drogenfahndung schon lange. Man hat das überprüft. Es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass die ›Amber‹ als Rauschgiftkurier dient.«
»Das wird man den Behörden ja wohl nicht auf die Nase binden«, sagte Stack Russen. »So ein Riesenschiff bietet tausend Verstecke.«
»Dann müsste aber jeweils nach dem Anlegen der ›Amber‹ in New York eine größere Rauschgiftmenge in Umlauf geraten sein«, sagte Bount. »Ich habe selbst die Statistik studiert. Negativ. V-Leute wurden befragt, der hauptsächliche Dealer und Verteiler in New York City dazu vernommen. Dieser Mann wurde neulich verhaftet und zeigte sich kooperativ. Er will als Kronzeuge straffrei ausgehen und braucht staatliche Unterstützung, damit ihn seine früheren Komplizen nicht umbringen. Dieser Mann kennt sämtliche größeren Kanäle, durch die Rauschgift in die USA einsickert. Von der ›Amber‹ wusste er nichts. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit lässt sich ausschließen, dass die ›Amber‹ im Rauschgiftgeschäft ist. Auch deshalb ist keiner vom FBI mit an Bord. Man sah keinen Ansatzpunkt.«
»Ja, was, zum Teufel, treiben die Ozeanliner-Gangster denn dann?«, fragte Safford. »Irgendwas muss doch da sein, was sich enorm für sie lohnt und was sie mit der ›Amber‹ günstig durchziehen können.«
»Ja«, sagte Bount, »eben was? Was lässt sich an Bord der ›Amber‹ bewerkstelligen oder herstellen und sichert einer Bande von organisierten Verbrechern einen so hohen Profit, dass sie dafür über Leichen gehen?«
Sie fanden darauf keine Antwort. Bount wollte weiter ermitteln. Er hatte vor, einige von den Gangstern an Bord zu stellen und aus ihnen die Wahrheit herauszubringen. Die Gangster wiederum wollten Bount Reiniger schleunigst beseitigen, möglichst ohne dass ein Verdacht auf sie fiel.
Die nächste Möglichkeit, außerhalb des Schiffs zuzuschlagen, war beim Landgang in Miami. Bount wollte dort auf jeden Fall an Land, schon weil er bei den Behörden, auf die er sich stützte, verschiedene Informationen einholen musste.
4.
Bounts Gepäck wurde nicht gefunden. Wahrscheinlich war es über Bord geflogen. Der Gangster mit dem ausgekugelten Arm konnte auch nicht gefunden werden. Die Besatzungsmitglieder behaupteten alle, sie wüssten nichts von einem Mann mit einer solchen Verletzung.
Bount begegnete einer Mauer der schweigenden Ablehnung. Er fragte sich, was da los war, und er zermarterte sich weiter den Kopf, in welcher höchst lukrativen Verbrechenssparte sich die Gangster von der ›Amber‹ betätigten.
Bount inspizierte das Schiff. Der Kapitän hatte von der Reederei klare Anweisungen erhalten. Sie lauteten:
Kooperation oder Entlassung. Bount durchforschte, oft mit Buster Maine und dessen Schiffspolizisten zusammen, das 54.000 Bruttoregistertonnen große Kreuzfahrtschiff vom obersten Schornsteinrand bis hinunter zu den Maschinenräumen, den Wassertanks und dem Frachtraum.
Noch war er mit dem Schiff nicht vertraut, da lief man schon nach zweieinhalb Tagen Fahrt Miami an. Bount hatte etliche Passagiere und Besatzungsmitglieder näher kennen gelernt. An den Sport- und Freizeitprogrammen nahm er kaum teil. Er war zu sehr mit seinen Nachforschungen beschäftigt.
Rudy Safford und dessen Pfleger halfen Bount, so gut sie konnten, Lord Arthur hatte erfahren, dass Bount ihn mit seiner Geschichte vom Tierfutterfabrikanten hereingelegt hatte. Im Foyer von dem Rauchsalon im Oberdeck sprach er ihn darauf an.
»Haben sich da mit mir einen Spaß erlaubt, alter Junge! Hörte, Sie wollen kriminelle Machenschaften aufklären?«
»Woher wissen Sie das?« Bount arbeitete diskret. Die Kreuzfahrtpassagiere sollten nicht verschreckt werden.
»Man hat seine Informationsquellen. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, dann lassen Sie es mich wissen. Bin schon zum vierten Male auf der ›Amber‹ dabei. Wetten, dass ich Ihnen behilflich sein kann?«
»Was fasziniert Sie denn so an der ›Amber‹? Es gibt doch auch noch andere Schiffe.«
»Schiff fasziniert mich. Muss vielleicht auch an der Besatzung liegen. Gibt tolle Leute an Bord.«
Bount stellte fest, dass Lord Arthur hauptsächlich von der rothaarigen Bordhostess Daniela Aiken angezogen wurde. Bei den Rettungsbooten auf dem Sportdeck wurde er Zeuge einer Szene, als er unter der Persenning der Boote nachschaute und nicht gleich gesehen werden konnte.
Lord Arthur und die rothaarige Schönheit, die wie immer einen atemberaubend knappen Rock trug, wähnten sich allein.
»Wollen Sie Lady Raftbury werden, Daniela?«, fragte Lord Arthur. »Lege Ihnen alles zu Füßen und bin sogar bereit, auf das Wetten zu verzichten, wetten? Kann nur noch an Sie denken.«
»Lassen Sie mich endlich in Ruhe, Sir Arthur! Ich habe Ihnen klar und deutlich gesagt, dass Sie sich bei mir keine Hoffnungen zu machen brauchen. Suchen Sie sich Ihre Ehefrau in den Kreisen des Hochadels, wenn Sie unbedingt noch heiraten wollen.«
»War bisher immer Junggeselle, möchte jetzt aber in den Hafen der Ehe einlaufen. Mit Ihnen, Daniela.«
»Ich bleibe lieber auf See«, erwiderte Daniela schnippisch.
Mit ganz unenglischer Vehemenz zog Lord Arthur sie an sich. Er wollte Daniela küssen und empfing eine schallende Ohrfeige. Die Hostess löste sich aus seiner Umarmung und ließ ihn stehen. Lord Arthur wollte hinterher eilen. Bount räusperte sich, so dass der Lord auf ihn aufmerksam wurde, und sprang aus dem Rettungsboot.
»Was treiben Sie denn da, Mister Reiniger? Verstehe. Wollten nachsehen, ob in den Rettungsbooten was verborgen ist. Unglückliche Geschichte mit Daniela, das. Können Sie mir vielleicht einen Rat geben, wie sie zu erobern wäre?«
Bount wollte dem Lord nicht sagen, er solle sich liften lassen und seinen Charakter umkrempeln.
»Nein, leider nicht. Geben Sie die Hoffnung nicht auf. Oft führt Hartnäckigkeit doch noch zum Ziel.«
»Habe mir schon überlegt, ob ich Schiff nicht kaufen soll, um ihr zu imponieren. Oder Anteil an Reederei übernehmen. Sind aber nicht im Seefahrtsgeschäft.«
»Sind Sie denn so reich, Lord Arthur?«
»Glaube schon. Reicht für ein paar Kreuzfahrtschiffe, und es ist immer noch was übrig.«
»Dann sollten Sie vorsichtig sein. Es sind schon zwei reiche Passagiere der ›Amber‹ entführt worden. Für sie wurde Lösegeld erpresst.«
»Habe keine Angst. Geschah immer in Hafenstädten. Passe gut auf. Gehe nicht in Bars und lasse mich auch nicht von einheimischen Schönheiten verlocken. Sind Sie mit Ihren Ermittlungen schon weiter?«
»Bisher nicht.«
»Kann mir auch nicht erklären, was mit ›Amber‹ getrieben wird. Ob vielleicht Gold an Bord ist?«
»Wie meinen Sie das?«
»Na, in Karibik besteht Möglichkeit, Goldmengen günstig einzukaufen. In den USA schlägt man Zoll und Steuern drauf. Das wäre ein gutes Geschäft. Oder Waffen oder technische Geräte aus den USA in Karibikhäfen liefern.«
»Das ist es alles nicht. Das wurde schon überprüft.«
Bount trennte sich von Lord Arthur, der auf dem Sportdeck eine Runde Golf spielte. Er konnte den Ball immer nur wenige Meter putten, was ihn jedoch nicht hinderte. Bount konnte von dem reichen Engländer auch nichts erfahren, was ihm weitergeholfen hätte. Ihm war jedoch aufgefallen, dass Daniela Aiken ihn mit Interesse musterte, und auch Carmen Lopez suchte seine Nähe.
Man war jetzt in südliche Breiten gelangt. Das Wetter hatte sich deutlich gebessert, seit der 30. Breitengrad überschritten war. Auf dem Sonnendeck suchte Bount Carmen Lopez Gesellschaft.
»Ah, sieht man Sie auch mal?«, fragte die rassige Frau. »Sie sind doch immer so sehr beschäftigt. Was haben Sie denn in Miami vor?«
»Ich will mir nur mal die Stadt ansehen.«
»Kann ich Sie dabei begleiten?«, fragte Carmen kokett.
»Warum nicht?«, fragte Bount, richtete es aber so ein, dass er die ›Amber‹ im Hafen von Miami vor Carmen verließ.
Mit einem Taxi fuhr er zum Police Headquarters. Dort informierte er sich unter anderem auch über Carmen Lopez. Sie hatte ihm gesagt, ihrer Familie gehörten Grundbesitz und Hotels auf Puerto Rico. Einen Teil des Jahres verbringe sie indessen in New York, wo sie in die High Society eingegliedert sei. Bount konnte jedoch keine Hinweise auf eine Carmen Lopez finden, auf die diese Behauptungen zutrafen.
Carmen war für die Behörden ein unbeschriebenes Blatt.
»Vielleicht hat sie bloß angegeben«, sagte der Polizeichef zu Bount. »Auch Frauen wollen sich darstellen. Vielleicht ist Carmen Lopez eine kleine Sekretärin, die sich das Geld für die Kreuzfahrt zusammengespart hat und bei der reichen Gesellschaft auf der ›Amber‹ unter Minderwertigkeitskomplexen leidet und sich aufwerten will. Sie könnte auch auf der Suche nach einer guten Partie sein.«
Bount glaubte, dass mehr dahintersteckte. Sein Besuch bei der Miami Police brachte ihm lediglich das Ergebnis, dass er nur auf der ›Amber‹ selbst die Lösung auf seine Fragen finden würde. Außerhalb konnte er Informationsquellen anzapfen, soviel er wollte, und sich wenden an wen auch immer. Er besorgte sich einen Scanner, mit dem er seine Kabine auf Mini-Spione untersuchen wollte, sowie weiteres, was für seine Nachforschungen notwendig war.
Er stellte sich einen Detektivkoffer ähnlich wie jenen zusammen, den man ihm entwendet hatte. Die Golden Globe Reederei und seine bekannt gute Zusammenarbeit mit staatlichen Organen ermöglichten ihm das ohne große Probleme.
Mit seiner Ausrüstung fuhr er, wieder im Taxi, durch den abendlichen Verkehr zum Hafen zurück. Er hatte neben dem Fahrer in dessen Buick-Taxi Platz genommen. Durch den Spiegel an der Sonnenblende beobachtete er den Verkehr hinter sich.
In einem schnittigen Corvette Stingray Cabrio fuhr eine schwarzhaarige Frau mit weißem Kopftuch und Sonnenbrille. Beim Stopp an einer roten Ampel, als sie zwei Autos hinter dem Taxi hielt, betrachtete Bount sie genau.
Kein Zweifel, es war Carmen Lopez. Nach dem Anfahren verlor Bount sie aus den Augen. Noch vor dem Hafen, auf einer Kreuzung, geschah es. Von links schoss ein Pontiac Firebird heran und rammte das Taxi. Es gab einen lauten Krach.
Das Buick-Cabby wurde einmal um die Achse gedreht.
»Duck dich!«, rief Bount dem Fahrer zu und sprang aus dem Taxi, kaum dass es stand. »Gleich knallt es!«
Er hatte sich nicht getäuscht. Aus dem Firebird stiegen zwei Männer. Die Kreuzung wurde von den übrigen Fahrzeugen geräumt, deren Fahrer sich schleunigst verdrückten. Die beiden Gangster, in hellen Anzügen, mit bunten Krawatten und großen Sonnenbrillen, eröffneten mit schweren Pistolen das Feuer.
Gegenüber, bei einem Straßencafe, erschien ein Mann mit einem Geigenkasten, ähnlich wie die zwei Amokfahrer gekleidet. Er öffnete seinen Geigenkasten und holte eine Thompson-MPi heraus. Noch bevor er sie in Anschlag bringen konnte, streckte Bount den Virtuosen mit einem gezielten Schuss nieder.
Die Magnum-Pistolen der beiden Gangster beim Firebird dröhnten und stanzten hässliche Löcher in den Buick. Bount duckte sich hinter den Wagen und feuerte dann über die Motorhaube zurück. Ein Gangster schrie auf. Bount hatte ihn in die Schulter getroffen.
Als das Sirenengeheul heranbrausender Streifenwagen zu hören war, flüchteten die Gangster. Ehe Bount noch einmal auf sie schießen konnte, waren sie um die Ecke. Der Firebird blieb mit von dem Aufprall aufgesprungener Motorhaube wie mit einem klaffenden Maul stehen.
Zwei letzte Schüsse krachten von der Straßenecke. Dann verschwanden die Killer in einer Passage, hinter der sich ihnen mehrere Fluchtmöglichkeiten boten. Bount schaute nach dem Cabdriver, den er stöhnen hörte.
Der Mann hatte einen glatten Durchschuss am Unterschenkel. Das war seine einzige Verletzung. Bount half ihm aus dem Auto und legte ihm einen Notverband an, als die ersten Streifenwagen eintrafen.
Bount wies sich aus und setzte die Cops auf die Fährte der Gangster. Der verhinderte MPi-Schütze, den Bount niedergeschossen hatte, war schwerverletzt und ohne Bewusstsein. Man brachte ihn mit der Ambulanz ins nächste Krankenhaus, wo die Ärzte auf der Intensivstation um sein Leben kämpften.
Die Kreuzung wurde geräumt. Bounts Taxifahrer musste gleichfalls ins Hospital. Bount suchte wieder das Police Headquarters auf. Dort erfuhr er, dass der von ihm niedergeschossene Kerl ein einheimischer Hitman war, also ein Lohnkiller, der auf Bestellung arbeitete.
»Man nennt das System, mit dem Sie erledigt werden sollten, Eins-Zwei«, erklärte ein Police Lieutenant Bount. »Jemand mit guten Verbindungen und reichlich Bargeld muss einiges gegen Sie haben und Sie unbedingt aus dem Verkehr ziehen wollen.«
Bount fragte sich, wer dieser Jemand war. Er dachte an Carmen Lopez, die angebliche Multimillionärin aus Puerto Rico. Sie war ihm heimlich gefolgt, und sie konnte sehr gut die Killer bestellt und gelenkt haben.
Er würde in Zukunft bei der schönen Carmen höllisch auf der Hut sein müssen.
*
Kurz vor dem Auslaufen, das um Mittemacht erfolgte, kehrte Bount auf die ›Amber‹ zurück. Er überprüfte seine Kabine und fand zwei Minispione im Bad und unter dem Bett, die er beide ausbaute und aus dem Bullauge warf. Dann legte er sich beruhigt schlafen.
Bei seinem Erwachen schwamm die ›Amber‹ bereits wieder auf hoher See. An den Florida Keys vorbei ging es zur Straße von Yucatan. Bount erholte sich auf dem Sonnendeck von den Aufregungen des vergangenen Abends. Der von ihm niedergeschossene Hitman in Florida würde nichts über seine Auftraggeber verraten können. Solche Aktionen wurden über einen Mittelsmann in die Wege geleitet.
Der wahre Initiator schirmte sich ab. Auch wenn man die beiden Gangster aus dem Firebird zusätzlich fasste, würde das wenig bringen. Doch Bount konnte triumphieren. Man hatte ihn nicht erledigt. Und er wurde als eine Gefahr angesehen. Sonst hätten sich die Gangster von der ›Amber‹ nicht solche Mühe gegeben, ihn umzubringen.
Bount saß noch nicht lange im Liegestuhl, als sich Daniela Aiken zu ihm gesellte.
»Ich habe Sie noch nie bei unserem Sportprogramm gesehen, Mister Reiniger. Wollen Sie komplett abschlaffen? Haben Sie keine Hobbys?«
»Doch. Schöne Frauen.«
»Stößt Ihr Faible denn auf eine Gegenliebe?«
»Das hängt ganz davon ab.«
In Daniela Aikens Nähe knisterte es vor Erotik. Bount flirtete mit der Rothaarigen und lud sie zu einem Drink an der Bar ein.
Auf dem Barhocker verrutschte Danielas ohnehin knapper Rock und zeigte ihre Beine bis zu einem spitzenbesetzten Slip. Sie zog am Rocksaum.
»Ich habe da etwas munkeln hören, Bount. Du vermutest Gangster an Bord?«
»Mittlerweile weiß anscheinend jeder über meine Mission Bescheid. Die Haifische lachen schon, wenn sie an mich denken. Jetzt durchfahren wir auch noch das Bermuda-Dreieck, in dem schon ganze Schiffe und Flugzeuge spurlos verschwunden sind. Da kann wohl leicht auch ein einzelner Mensch verloren gehen?«
»Das hängt davon ab, wie er auf der Hut ist. Ich würde dir gern helfen. Mir ist manches an Bord auch nicht geheuer. Vor allem möchte ich dich vor Carmen Lopez warnen. Sie ist nicht die, die sie zu sein vorgibt.«
Bount und Daniela waren sich näher gerückt. Lord Arthur, der an der Bar vorbeischlenderte, sah es mit Kummer. Er seufzte und zog sich zurück, um seinen Weltschmerz an einer anderen Bar mit doppelten Whiskys zu ersäufen.
»Was weißt du über Carmen Lopez?«, fragte Bount.
»Sie hieß nicht immer so. Ich weiß, dass dies nicht ihre erste Fahrt mit der ›Amber‹ ist. An der letzten hat sie mit blonder Perücke und unter einem anderen Namen teilgenommen. Ich bin überzeugt, dass sie auch davor schon verschiedene Male an Bord war. Bei tausend und mehr Passagieren, die bei jeder Fahrt wechseln, kann das jemand leicht bewerkstelligen, wenn er es darauf anlegt, besonders wenn er Komplizen an Bord hat.«
»Und der Zweck der Übung?«, fragte Bount.
»Das weiß ich nicht. Aber wir sollten uns zusammentun.«
Bount kannte sich mittlerweile auf der ›Amber‹ recht gut aus. Er wurde das Gefühl lauernder Gefahr nicht los. Die Gegenseite beobachtete ihn. Man belauerte jeden seiner Schritte, und wenn er allzu nahe an die Wahrheit geriet, würde man sich auch an Bord nicht zurückhalten. Zudem musste er sich vor heimtückischen Anschlägen und vor so genannten Unfällen hüten.
Er besprach sich in seiner Kabine mit Rudy Safford und Stack Russen und erzählte den beiden, was ihm in Miami passiert war.
»Seid nur auf der Hut!«
Am Abend fand ein Bordfest statt. Bount tanzte immer wieder mit Daniela. Carmen Lopez ließ sich nicht sehen. Als er sich bei dem für sie zuständigen Steward erkundigte, erfuhr er, sie liege mit Übelkeit in ihrer Kabine. Bount glaubte eher, dass sie Wichtigeres zu erledigen hatte, als sich beim Bordfest in den geschmückten Passagierräumen zu amüsieren.
Nach Mitternacht begleitete ihn Daniela in seine Kabine. Sie war angeheitert. Die Nacht war lau, und das Kreuz des Südens strahlte über dem Golf von Mexiko, den man jetzt verließ.
Bount war bereits aufgefallen, dass die alleinreisenden Männer an Bord große Chancen hatten, denn es befanden sich mehr Frauen als Männer an Bord. Auch die Besatzung kam auf ihre Kosten. Besonders die Offiziere wussten sich der liebeshungrigen Kreuzfahrttouristinnen kaum zu erwehren.
Es war ein Traumschiff und Liebesdampfer, das da in die Karibik gondelte. Jene, die sich von der Kreuzfahrt nur Urlaubserlebnisse und Amouren versprachen, ahnten nichts von dem Gangstertreiben, in das auch der allergrößte Teil der Besatzung nicht eingeweiht sein konnte. Die harmlosen Seeleute, Stewards und Maschinisten erlagen den Einflüsterungen jener, die behaupteten, sämtliche Anschuldigungen seien harmlos und Bount Reiniger ein unangenehmes Subjekt und Unruhestifter.
Daniela tänzelte durch Bounts Kabine und breitete die Arme aus.
»Ich könnte die ganze Welt umarmen. Die Nacht ist wie Samt.«
»Fang ruhig mit mir an.«
Bount goss Champagner in Danielas Stöckelschuh. Sie tranken beide und sanken in enger Umarmung aufs Kabinenbett. Daniela kicherte. Die Kleider fielen, und eine heiße Liebesnacht begann. Daniela hatte einen göttlichen Körper und war eine Offenbarung. Sie kannte keine Tabus.
Erst am Morgen schliefen sie ein. Gegen zwölf schreckte Daniela auf.
»Du meine Güte, ich habe meine Animationsstunde verschlafen! Wie soll ich das nur den Passagieren erklären, die im Sportsaal auf mich warteten?«
»Was stand denn auf dem Programm?«
»Rhythmische Gymnastik.«
»Die kann man auch anders betreiben. Nach dem rauschenden Bordfest werden sowieso noch die meisten völlig hinüber sein.«
Bount zog Daniela in die Arme und zeigte ihr, was er unter rhythmischer Gymnastik verstand. Später, als Daniela summend die Kabine verlassen hatte, rief Bount übers Funktelefon in New York bei seiner Detektei an. June March hob ab.
»Hallo, Chef, wird Zeit, dass du dich mal meldest! Wie geht es an Bord voran?«
»Mühsam. Gibt's in New York was Neues?«
Alte und neue Klienten hatten angerufen. Das Finanzamt wollte Geld, und ein unbekannter Gangster hatte Bounts Detektei eine Bombendrohung zugeschickt. Also das übliche. Wegen der Bombendrohung verwies Bount June an Captain Rogers, der ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen würde.
»Vermutlich steckt nicht viel dahinter. Wenn einer es ernst meint, schickt er gleich die Bombe und droht nicht bloß.«
»Womöglich eine Sexbombe.« June kicherte. »Wie sieht es denn damit auf der ›Amber‹ aus? Über Kreuzfahrten hört man mitunter tolle Geschichten. Auf so einem Schiff lernt man sich eng kennen, und es gibt nach einer Weile nicht mehr viele Abwechslungsmöglichkeiten. Die Seeluft wirkt stimulierend.«
»Auf mich nicht«, log Bount. »Ich bin fünfundzwanzig Stunden am Tag im Ermittlungseinsatz.«
»Wie das?«
»Die Mittagspause von einer Stunde arbeite ich durch und rund um die Uhr. June, ich habe einen Auftrag für dich. Du studierst parallel zu meiner Arbeit die Kriminalstatistik der Länder, in deren Häfen die ›Amber‹ jeweils anlegt. Nicht nur zu dem Zeitpunkt, da die ›Amber‹ dort ist, sondern grundsätzlich müssen wir feststellen, ob da eine Steigerung in einer Verbrechenssparte festzustellen ist, die mit der ›Amber‹ in einer Verbindung stehen könnte. Notier dir alles, was dir auffällt, und gib es mir durch.«
»In Ordnung, Chef. Du führst also ein solides und arbeitsames Leben?«
»Und wie!«
Bount beendete das Gespräch. Es war über einen Telefon-Scrambler geführt worden, einen elektronischen Zerhacker, den Bount sich in Miami besorgt hatte. Per Telegramm aus Miami hatte er June March die Codierung mitgeteilt, so dass sie den Scrambler in der Detektei programmieren konnte. Der Anschluss des Telefons an den Scrambler war äußerst einfach: Man legte den Telefonhörer auf den Scrambler und hörte und sprach dann durch dessen Hörer, der ähnlich dem eines Telefons war.
Der Code konnte während des Gesprächs gewechselt werden. Bei X-Millionen Möglichkeiten konnten sich die Gangster an Bord amüsieren, wenn sie seine Gespräche überwachten. Bount beschloss, sich als nächstes den Bordarzt Dr. Miguel Segueiras vorzunehmen und Carmen Lopez auf die hübschen Zähne zu fühlen.
Wenn er sie in die Enge trieb, musste die Gegenseite reagieren. Ständig konnte man ihn an Bord nicht hinhalten.
*
Die Sanitätsstation befand sich im Hauptdeck, ziemlich am Heck. Es handelte sich um eine modern eingerichtete Mini-Klinik, die sogar über einen Operationssaal und selbstverständlich ausgebildetes Personal verfügte. Bount hätte sich allerdings lieber durch den Kopf geschossen, als den rauschgiftsüchtigen Dr. Segueiras mit dem Skalpell in der Hand an sich heranzulassen.
Carmen Lopez verließ die Sanitätsstation gerade, als Bount sie betrat.
»Hallo!«, sagte Bount. »Was fehlt Ihnen denn? Zuletzt in Miami waren Sie doch noch ganz munter.«
»Ich bin nicht an Land gewesen.« Carmen wollte an Bount vorbei. Er hielt sie am Arm fest. »Lassen Sie mich los. Sie haben mich versetzt und es nicht mal für nötig gehalten, sich dafür zu entschuldigen.«
»Ich war verhindert«, erwiderte Bount allgemein. »Sie sind nicht zufällig in einem Corvette Stingray Cabrio in Miami herumgefahren, knapp hinter meinem Taxi?«
Carmens blaue Augen funkelten wütend.
»Weder zufällig noch sonst wie. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Lassen Sie mich los!«
»Ich besuche Sie demnächst mal, und dann unterhalten wir uns.«
Damit ließ Bount Carmen gehen. Sie knallte die Tür zu, dass man es weithin hörte. Bount fand Dr. Segueiras damit beschäftigt, eine ältere Passagierin zu behandeln, die sich an Bord den Knöchel verstaucht hatte. Die Frau jammerte, als müsse sie in Kürze sterben.
»O mein Gott! Wenn ich das gewusst hätte. Das verdirbt mir den ganzen Spaß an der Kreuzfahrt.«
Endlich konnte Dr. Segueiras die Lady entlassen. Auf Krücken humpelte sie davon, einen Stützverband um den Knöchel. Der Bordarzt schützte dringende Beschäftigungen vor. Doch Bount, der sich von der Krankenschwester hatte anmelden lassen, ließ sich nicht wegschicken.
Im Behandlungszimmer stellte er Dr. Segueiras.
»Sie wissen, für wen ich arbeite und welche Vollmachten man mir eingeräumt hat. Wie lange fahren Sie schon auf der ›Amber‹?«
»Siebeneinhalb Jahre.«
»Also länger als Kapitän Rivers. Sind Sie schon morphiumsüchtig an Bord gekommen oder es hier erst geworden?«
»Erlauben Sie mal! Wie können Sie denn behaupten ... Das ist unerhört. Das brauche ich mir nicht gefallen zu lassen ...«
Dr. Segueiras reagierte geschockt. Er stammelte halbe Sätze. Der Bordarzt war bleich und wirkte fahrig. Seine Haut hatte einen bläulichen Schimmer, die Augen lagen glanzlos und tief in den Höhlen. Entweder wurde ihm das Morphium knapp, oder sein geschundener Organismus lehnte sich dagegen auf.
Bount fuhr mit brutaler Offenheit fort:
»Mich können Sie nicht belügen. Sie sind süchtig. Sie spritzen sich Morphium. Gewisse Leute haben Sie in der Hand. Sie haben jenen Mann verarztet, der mich mit dem Messer ermorden wollte und dem ich dabei den Arm ausrenkte. Man zwingt Sie, zu schweigen.«
»Nein, nein ...«
»Doch! Er wird sich den Arm kaum selbst wieder eingerenkt haben. Dazu bedarf es ärztlicher Kenntnisse.«
»Das kann auch ein Sanitäter oder jemand, dem man das beigebracht hat. Sie irren sich, Mister Reiniger. Ich will nicht mit Ihnen reden.«
»Aber ich mit Ihnen. Ich verlange von Ihnen, dass Sie mich unterstützen. Oder Sie verlieren Ihren Job. Ich brauche nur die Reederei darüber aufzuklären, dass Sie Morphinist sind, und Sie sind hier die längste Zeit Schiffsarzt gewesen. Dann stehen Sie auf der Straße. Man wird Sie nirgendwo mehr anstellen. Der Entlassungsgrund wird sich herumsprechen.«
Dr. Segueiras brach der Schweiß aus. Er befand sich ohnehin in einem schlechten Zustand. Seine Nerven flatterten. Bount packte ihn ungern so hart an. Doch er sah keine andere Möglichkeit. Er ließ Dr. Segueiras sich setzen.
Der süchtige Arzt litt an einem chronisch schlechten Gewissen. Er hangelte sich von einem Tag zum nächsten durch und lebte im Grunde nur für sein Morphium, ohne das er zu allem unfähig war. Für den Morphiumrausch bezahlte er einen hohen Preis, nämlich sein ganzes Leben und sämtliche anderen Interessen.
Er war eine Marionette der Sucht. Alles andere trat in den Hintergrund. Die Sucht dirigierte seinen Tagesablauf und sein Leben. Wenn man ihm eine bildschöne, heißblütige Frau ins Bett legte und eine Morphiumspritze auf den Nachttisch, würde er sich immer für die Spritze entscheiden.
»Gehören Sie zu den Gangstern an Bord?«, fragte Bount.
»Bitte ... Nein. Ich weiß nicht, von was Sie sprechen.«
»Sie wissen es ganz genau. Sie können nicht siebeneinhalb Jahre an Bord sein, ohne die Hintergründe zu kennen. Durch Ihre Morphiumabhängigkeit sind Sie ein willkommenes Werkzeug für die Verbrecher. Wie verhält es sich mit dem verschwundenen Steward? Warum verunglückte der Seemann auf einer der letzten Fahrten tödlich, was von der Technik her nie hätte passierten dürfen? Weshalb sind Passagiere entführt worden? Was geht vor auf der ›Amber‹?«
»Bitte! Ich kann darauf nicht antworten. Sie – sie bringen mich um.«
»Wer?«
»Die Gangster.« Dr. Segueiras Stimme klang wie ein Flehen.
Bount nahm ihn trotzdem weiter in die Mangel. »Wenn Sie sich mit mir verbünden, Doktor Segueiras, helfe ich Ihnen. Dann lege ich bei der Reederei ein Wort für Sie ein. Was die Strafverfolgung durch die Behörden betrifft, können Sie Kronzeuge werden – und straffrei ausgehen, es sei denn, Sie haben einen Mord oder ein ähnlich schweres Verbrechen auf dem Gewissen.«
»Nein! Nein!«
»Ich biete Ihnen die Möglichkeit, für reinen Tisch zu sorgen, Doktor. Sie können, wenn Sie alles hinter sich haben, eine Suchtklinik aufsuchen und sich einer Therapie unterziehen. Noch haben Sie die Möglichkeit, sich von Ihrer Sucht zu lösen und ein anderes Leben zu führen. Oder gefällt es Ihnen, wie es jetzt ist?«
Dr. Segueiras verbarg das Gesicht in den Händen. Der gebürtige Argentinier schluchzte bitterlich. Seine Schultern bebten.
»Nein. Es ist die Hölle. Ich spritze eigentlich nur noch, weil ich es anders nicht mehr aushalte. Wenn die Wirkung der Spritze nachlässt, kriege ich Krämpfe, Schweißausbrüche, Unruhezustände und fürchterliche Angst. Ich habe schon x-Mal versucht, von dem Zeug loszukommen. Aber es ist stärker als. ich.«
»Haben Sie schon mal fachmännische Hilfe gesucht?«
»Nein. Ich habe mich nicht getraut. Ich schämte mich zu sehr.«
»Das brauchen Sie nicht. Sie sind krank und vermindert zurechnungsfähig. Wer an Bord weiß alles von Ihrer Sucht, und wer deckt Sie?«
»Alle, die näher mit mir zu tun haben. Der Kapitän, die Offiziere, der Touristik-Leiter.« Das war der Vierte Offizier, weniger ein Seemann als quasi Chef des schwimmenden Hotels, das das Luxus-Kreuzfahrtschiff unter anderem war. »Als Schiffsarzt habe ich die Möglichkeit, mir mein Morphium leicht zu beschaffen.«
In südamerikanischen Ländern gab es keine Probleme und Kontrollen für den Bordarzt der ›Amber‹, sich mit den nötigen Ampullen zu versorgen. Nur den Verbrauch musste er kaschieren und entweder illegale und nicht über die Bücher laufende Einkäufe tätigen oder Patienten erfinden, die Schmerzmittel brauchten.
»Hm«, sagte Bount. Die Schiffsoffiziere steckten entweder alle unter einer Decke oder wurden wie Dr. Segueiras erpresst, möglicherweise auch bestochen. In der Mannschaft gab es willfährige Helfer. »Nennen Sie mir die Namen der Gangster an Bord, und sagen Sie mir, was genau gespielt wird. Das ist Ihre letzte Chance, mit heiler Haut aus dieser Sache herauszugelangen.«
Dr. Segueiras bebte. Er öffnete schon den Mund, als es klopfte. Der Dritte Offizier Buster Maine trat ein.
»Ich hörte, dass Sie beim Schiffsarzt sind, Mister Reiniger«, sagte er. »Unser Doktor hat ein Problem mit der Spritze. Abgesehen davon ist er ein tüchtiger, umgänglicher Mann, und wir wollen ihn nicht ans Messer liefern. Wir halten ihm alle die Daumen, dass er es schafft, sich von der Sucht zu lösen. Deshalb und weil sich Doktor Segueiras keine Versäumnisse zuschulden kommen ließ, wurde die Reederei bisher nicht verständigt.«
Dr. Segueiras schwieg. Das unerwartete Auftauchen des Sicherheitsoffiziers hatte ihn aus dem Konzept gebracht. Bount war ärgerlich. Dr. Segueiras war drauf und dran gewesen, ein Geständnis abzulegen.
Nach kurzem Wortwechsel scheuchte Bount Maine hinaus und wandte sich wieder an den Schiffsarzt. Doch Dr. Segueiras wollte jetzt nicht so recht heraus mit der Sprache. Als Bount ihn weiter bedrängte, entschloss er sich, eine Teilwahrheit zu äußern, um den lästigen Frager erst mal loszuwerden.
»Die Bande hat eine Chefin. Sie kennen sie. Sie sollten sich mal die Bordzeitung anschauen.«
»Die ›Neptun News‹?«, fragte Bount überrascht.
Es handelte sich um ein Blättchen, dem er wenig Interesse abgewinnen konnte. Die Schiffszeitung erschien jeden zweiten Tag und außerdem mit einer extra dicken Wochenendausgabe. Sie berichtete über das Schiff, die Besatzung, also hauptsächlich die Offiziere, und wusste mit interessanten Details aufzuwarten, wie etwa der Kapitän am Vorabend einen Hummer gegessen und was er zu der Delikatesse gesagt hatte.
Auch über prominente oder sonst wie interessante Passagiere wurde geschrieben, in der Art von: »Mr. Dora X. aus Boston, die charmante Gattin des bekannten Elektrogeräteherstellers, erschien gestern Abend beim Bordfest im Hauptdeck in einem wunderschönen altgoldenen Ballkleid. Sie tanzte mehrmals mit dem Ersten Offizier, Mister Thor Nordengaard. Mrs. X. lädt demnächst zu einer Soiree im Gesellschaftsraum C ein und veranstaltet zweimal die Woche ein Bridgeturnier. Dies ist Mrs X. dritte Kreuzfahrt mit einem Liner der Golden Globe Linie, von deren Hauptaktionär sie eine Kusine zweiten Grades ist.«
Oder: »Noch immer hat sich Kapitän Rivers in der Wahl seiner Tischdame zum demnächst stattfindenden Kapitänsball nicht festgelegt. Befragt, warum das noch nicht der Fall sei, antwortete Kapitän Rivers: Die Qual der Wahl kann mir keiner abnehmen. Selten zuvor hatte ich eine solche Auswahl schöner, charmanter Damen an Bord meines Schiffes. Es bedürfte eines Paris wie bei jenem Urteil zwischen den griechischen Göttinnen, um hier eine Wahl zu treffen.«
Außer Banalitäten und Klatsch wurde in der »Neptun News« über die Häfen berichtet, die demnächst angelaufen werden sollten, sowie über Bordfeten und Ereignisse. Man musste schon ein sehr schlichtes Gemüt haben, um die Bordzeitung zu schätzen. Über die Neuigkeiten draußen in der Welt konnte man sich über Funk und Fernsehen informieren.
Außerdem gab es an Bord täglich Zeitungen wie die »New York Times« und andere, die per Telekopierer übermittelt und ebenfalls auf der ›Amber‹ nachgedruckt wurden. Dr. Segueiras wollte sich nicht weiter äußern.
»Lassen Sie mich jetzt bitte zufrieden!«, flehte er. »Ich bin in Lebensgefahr. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Aber da ich die Verhältnisse an Bord besser als Sie kenne, muss ich Sie bitten, sich nach mir zu richten. Es muss so aussehen, als ob ich Sie abgewimmelt hätte. Wir gehen in Maracaibo gemeinsam von Bord. Sobald ich unter Polizeischutz stehe, sage ich aus. Das verspreche ich.«
Bount gewann den Eindruck, dass Dr. Segueiras es ernst meinte. Maracaibo gehörte zu Venezuela. Zwischen Venezuela und den USA bestanden diplomatische Beziehungen und gegenseitige Hilfsabkommen. Dort würde man zweifellos Unterstützung finden. Bount war nicht scharf darauf, sich mit den schwerbewaffneten und skrupellosen Gangstern an Bord herumschlagen zu müssen.
Wenn venezolanische Polizei- oder Militäreinheiten sie festsetzten, konnte ihm das nur recht sein.
»Einverstanden«, sagte Bount.
Er hatte keine Möglichkeit gehabt, das Sprechzimmer des Schiffsarztes mit dem Scanner auf Mini-Spione zu überprüfen. Der Scanner und seine restliche Detektivausrüstung waren nämlich mal wieder verschwunden. Er vermisste den Koffer, seit er nach dem Lunch in die Kabine zurückgekehrt war. Der Kabinensteward wusste angeblich von nichts.
Bount rechnete jedoch damit, dass Dr. Segueiras clever genug war, sich nicht abhören zu lassen. Oder es waren keine dementsprechenden Maßnahmen gegen den Schiffsarzt getroffen worden.
Laut genug, dass sein Sanitätspersonal draußen ihn hören konnte, legte Dr. Segueiras los: »Lassen Sie mich in Ruhe! Ich habe Ihnen nichts zu sagen, und ich verbitte mir ein für allemal Ihre Unterstellungen und Verdächtigungen! Teilen Sie der Reederei mit, was immer Sie wollen. Bei mir geht alles mit rechten Dingen zu! Scheren Sie sich gefälligst zum Teufel!«
Bount nickte dem Schiffsarzt zu. Im Vorzimmer sah er eine Krankenschwester am Arzneimittelschrank stehen. Er hätte geschworen, dass sie kurz zuvor noch mit dem Ohr an der Tür gehangen hatte.
Er verließ die Sanitätsstation.
5.
Dr. Segueiras zitterte heftig. Das Verhör durch Bount Reiniger hatte ihm zugesetzt. Der rauschgiftsüchtige Arzt wollte seine ramponierten Nerven mit einer Morphiumspritze wieder aufmöbeln. Er schaute hinaus. Draußen war niemand. Dr. Segueiras schloss die Tür ab.
Er hatte gerade die Spritze aufgezogen, als die Tür plötzlich geöffnet wurde. Buster Maine, der Sicherheitsoffizier, trat ein, gefolgt von einer atemberaubend schönen Frau, die Dr. Segueiras kannte und fürchtete. Schön wie die Sünde, kalt wie der Tod, schoss es ihm durch den Kopf. Er brachte ein verzerrtes Lächeln zustande.
»Hallo?«
»Sind Sie wieder mal bei Ihrer Lieblingsbeschäftigung, Doc?«, fragte die Bandenchefin. »Ist es wirklich so schön, sich ständig anzutörnen und die Welt unrealistisch zu sehen?« Mit scharfer Stimme fragte sie dann: »Was haben Sie Bount Reiniger erzählt?«
»Nichts. Er wollte mich aushorchen, aber ich habe ihn abblitzen lassen, obwohl er mich schwer unter Druck setzte.« Dr. Segueiras brach der kalte Schweiß aus. Er schämte sich seiner Schwäche, doch er konnte nicht gegen sie an. »Sie müssen mir glauben.«
Die schöne Frau und der Dritte Offizier tauschten einen Blick aus, der für Segueiras nichts Gutes bedeutete.
»Natürlich glauben wir Ihnen, Doktor«, sagte die schöne Lady. Die obersten Knöpfe ihrer Bluse standen offen. Die Schöne trug keinen Büstenhalter. Die halboffene Bluse brachte ihren hübschen Busen aufreizend zur Geltung. »Wir kennen Sie doch. Eine Hand wäscht die andere. Sie decken uns, und wir helfen Ihnen, damit Sie weiterhin Ihrer Sucht frönen können. Sie brauchen sich um gar nichts zu kümmern. Wir geben Ihnen sogar Ihre Spritze.«
»Wieso? Das ist nicht notwendig. Das kann ich selber.«
»Wir nehmen Ihnen alles ab.« Die Stimme der Schönen klang einschmeichelnd. »Alle Probleme und Sorgen. Vertrauen Sie mir.«
Dr. Segueiras lächelte ein wenig. Die Frau trat an den Arzneimittelschrank, an dem der Schlüssel noch steckte, öffnete ihn und schaute hinein.
»Da haben wir ja Ihre Traumampullen. Wie schön.«
Dr. Segueiras glaubte zuerst an einen Scherz, als sie seinen Ärmel über die von Stichen zernarbte Armbeuge aufkrempelte und ihm dann fachmännisch mit einer Kompresse den Arm abschnürte. Die Vene trat hervor. Die Schöne reinigte die Einstichstelle mit medizinischem Alkohol und gab Dr. Segueiras die Spritze. Eine warme, wohlige Welle schwemmte durch seine Adern.
Dr. Segueiras Sorgen und Ängste wichen. Er hörte auf zu zittern. Wie von innen heraus wurden die Falten in seinem Gesicht geglättet. Der graue Teint wich einer normalen Färbung. Dr. Segueiras war richtiggehend aufgekratzt, bis er sah, dass die Schöne eine zweite Ampulle erbrochen hatte und eine weitere Spritze aufzog.
»Für wen ist die Spritze?«, fragte Dr. Segueiras. »Ist hier noch jemand Morphinist?«
»Für Sie, Doc«, sagte die Schöne. »Damit Sie mal wirklich was Gutes erhalten.«
»Aber ...« Durch die Euphorie spürte Dr. Segueiras die kalte Todesangst. »Eine weitere Dosis überlebe ich nicht. Das wäre tödlich.«
»Sieh an!«, sagte Buster Maine, zog die sechzehnschüssige Beretta 93 R aus der Halfter und setzte sie Segueiras an die Schläfe. »Da sind wir aber unsagbar traurig. Wo nehmen wir denn so schnell einen neuen Bordarzt her?«
»Den Arm her!«, herrschte die Schöne Dr. Segueiras an. »Wird's bald? Sie haben zwei Möglichkeiten, Doc. Entweder die Spritze, die Sie ja so lieben und an der Sie schon jahrelang hängen, oder ein hässliches Loch im Kopf und dann über Bord zu den Haien. Wie wollen Sie es haben?«
Die Sucht hatte Segueiras schon lange ausgehöhlt und ihm den letzten Rest seiner Männlichkeit und seines Mutes genommen. Er wählte den leichteren Weg und ließ sich die Spritze geben. Diesmal zuckte er heftig, als das Morphium seine Wirkung entfaltete, und lief blau an im Gesicht.
Kurz darauf war es vorbei. Die Frau ließ die erste Spritze verschwinden.
»Jetzt brauchen wir nur noch seine Fingerabdrücke auf die zweite Spritze zu bringen, Buster«, sagte sie. Sie atmete nicht mal schneller. Wie ein Engel des Todes war sie. »Dann ist alles paletti. Der Morphinist hat sich den Goldenen Schuss verpasst, ob aus Versehen oder aus Absicht, darüber mögen sich andere den Kopf zerbrechen.«
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2022
- ISBN (ePUB)
- 9783738966923
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (November)
- Schlagworte
- dreimal mordmillionen bount reiniger york detectives sammelband krimis