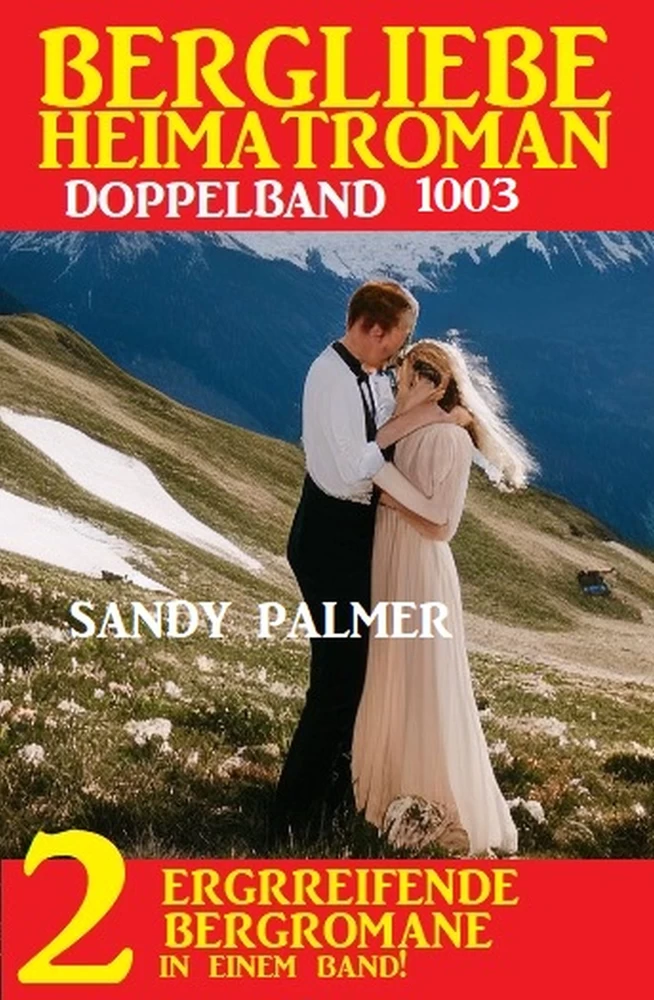Zusammenfassung
von Sandy Palmer:
Ihr edles Herz
Verschollen in der Höllenschlucht
Die schöne Bürgermeistertochter Monika Anzenberger und der Bergführer Toni Tanner lieben sich und geben sich ein Versprechen, als sie beide über das Sonnwendfeuer springen. Aber Monikas Vater hat andere Pläne. Seine Tochter soll den reichen Sägewerkbesitzer Peter Huber heiraten. Monika widersetzt sich dem Willen ihres Vaters, denn sie verabscheut Peter Huber.
Doch dann verunglückt Toni, als er in die Höllenschlucht absteigt …
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Bergliebe Heimatroman Doppelband 1003
Sandy Palmer
Dieser Band enthält folgende Romane
von Sandy Palmer:
Ihr edles Herz
Verschollen in der Höllenschlucht
Die schöne Bürgermeistertochter Monika Anzenberger und der Bergführer Toni Tanner lieben sich und geben sich ein Versprechen, als sie beide über das Sonnwendfeuer springen. Aber Monikas Vater hat andere Pläne. Seine Tochter soll den reichen Sägewerkbesitzer Peter Huber heiraten. Monika widersetzt sich dem Willen ihres Vaters, denn sie verabscheut Peter Huber.
Doch dann verunglückt Toni, als er in die Höllenschlucht absteigt …
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
COVER A. PANADERO
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
Ihr edles Herz
Heimatroman von Sandy Palmer
Der Umfang dieses Buchs entspricht 126 Taschenbuchseiten.
Als die Bäuerin vom Schranz-Hof starb, hatte sie ihrer Tochter Marei das Versprechen abgenommen, auf dem Hof zu bleiben. Und Marei hielt ihr Versprechen. So vergingen die Jahre, und aus dem Dirndl war eine fesche junge Frau geworden, die nur die Sorgen um den Hof und die beiden kleineren Brüder kannte. Nur sie allein kannte die Sehnsucht, die sie manchmal erfasste, wenn sie ihre Altersgenossinnen lachen und tanzen sah, unbeschwert das Glück der Jugend genießend. Zweimal schon hatte Marei geglaubt, dem Mann fürs Leben begegnet zu sein, aber beide Male hatte der hartherzige Bauer die Freier vom Hof gejagt. Das Glück seiner Tochter war ihm weniger wert als der Hof.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Twitter
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1
Das kleine Menschenkind lag brüllend auf dem Kissen und strampelte mit den Beinen.
„Um den Buben brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Pflüger-Bäuerin, der ist gesund“, sagte Apollonia Zurbriggen, die Hebamme von Karchenwald.
Die Bäuerin nickte verständnisvoll. Dann seufzte sie:
„Ja mei, Loni, wenn das schon so lang her ist seit dem letzten Kind, dann verlernt man halt alles.“
Die Hebamme lachte.
„So lang ist das gar net her, Bäuerin! Die Walburga ist sechs und geht g‘rad in die Schule. Beim Schranz-Bauern haben wir denselben Fall. Da ist der Gustl sechs, und nun kommt noch was Kleines.“
Sie legte den kleinen Buben resolut in die Wiege und sah sich in der Stube um.
Die Pflüger-Bäuerin verstand den Blick.
„Bring den Kaffee rein, Liesi!“, rief sie. „Du setzt dich noch, Loni, und trinkst einen Schluck?“
„Eigentlich hab ich gar keine Zeit net“, sagte die Apollonia und ließ sich schon auf den Stuhl neben dem Tisch fallen, „aber man muss ab und zu auch ein bissel das Leben genießen.“
Die älteste Tochter trat ein und trug eine Kaffeekanne und zwei Tassen auf dem Tablett. Auf einem Teller lag ein Stück Napfkuchen.
„Grüß Gott, Liesi!“, rief die Hebamme gerührt aus. „Was bist du für ein stattliches Madel geworden! Ja, ja, die Zeit vergeht. Vor achtzehn Jahren hatte ich dich hier auf dem Kissen liegen.“
Sie tätschelte dem Madel den nackten, runden Arm.
„Rundlich warst du schon immer, Liesi. Das schadet aber nix, du bekommst doch einen Mann. Wie steht denn die Sach‘ mit dem Schranz-Toni?“
Die Liesi wurde bis unter die blonden Kraushaare rot und schaute zur Seite.
„Ach, Loni …“
„Sie schämt sich“, sagte die Bäuerin und legte der Hebamme den Kuchen vor. „Nimmst du Zucker in den Kaffee, Loni? Dem Toni scheint‘s ernst zu sein. Er ist sehr oft bei uns!“
„Gut so!“, ermunterte die Apollonia. „Der Schranz-Hof ist der größte im Dorf, und der Toni wird Hoferbe, Madel!“
„Und der Hof ist voller Kinder wie bei uns!“, maulte die Liesi und schob die Lippen vor. „Bis ich da Herrin werd‘, bin ich alt!“
„Das ist nun mal net anders“, wies sie die Mutter zurecht und sah nach der Uhr. „Halb sechs, Liesi, setz‘ die Abendsuppe auf! Unsere Leut‘ kommen bald heim.“
Das Madel ging.
„Sie machen die Rüben aus“, sagte die Bäuerin. „Diesmal herbstet es früh. Wir haben Oktober, und es ist kalt wie im Dezember. Hast du auf dem Rad net gefroren?“
„Dafür ist Speck gut und wollene Unterhosen!“, lachte die Apollonia über das ganze rote Gesicht und schlug sich auf die breiten Schenkel. „Aber was ich noch sagen wollt‘, auf dem Schranz-Hof ist man noch weniger entzückt von dem Nachwuchs als bei euch. Viere sind schon da, und jetzt kommt das fünfte.“
„Auf dem Hof waren immer viele Kinder und viel Streit“, meinte die Pflüger-Bäuerin. „Da haben alle einen harten Schädel und alle sind schweigsam und verschlossen. Der Toni ist auch so einer. Stark ist er ja und gesund und groß, ein Prachtbursche. Aber ob meine Liesi es bei ihm gut haben wird, das ist noch die Frage.“
„Du bist zu weich, Bäuerin“, tadelte die Apollonia. „Das kommt aus deines Vaters Familie, die waren alle weich. Dein Mann ist anders.“
Sie dachte an den Pflüger-Bauern mit den schmalen Lippen und den kalten grauen Augen.
„Die Liesi hat die Augen von deinem Mann, Bäuerin. Und ihre stattliche Mitgift wird dem Schranz-Anton schon gefallen. Die haben nur reiche Frauen geheiratet, die Leut‘ vom Schranz-Hof,
Frauen, die rechnen und arbeiten konnten, und die haben sie dann auch anständig behandelt. Von Liebe ist da freilich net viel die Red‘. Aber das macht solchen Menschen nix aus.“
Plötzlich schob die Liesi den windzersausten Schranz-Xaver zur Tür herein.
„Da! Er will zur Apollonia! Auf dem Schranz-Hof hat‘s ein Unglück gegeben.“
„Was für ein Unglück?“, fragte die Apollonia seelenruhig und trank den letzten Schluck Kaffee.
„Das Mutterl ist vom Heuboden gefallen – ganz hoch runter!“, stotterte der Bub. „Dann könnt‘ sie net wieder auf und schrie. Der Vater und der Toni haben‘s dann ins Bett getragen, und nun jammert‘s immer noch. Sie sagt, ‘s geht los, Apollonia, du sollst kommen.“
Der Zwölfjährige zog die Nase hoch, fuhr sich mit den gespreizten Fingern durch den blonden Schopf und schwieg.
„Schöne Geschichten!“, sagte Apollonia Zurbriggen gottergeben. „Dann lass uns sofort gehen, Bub, es wird dringend sein. Schad‘ um deinen Kaffee, Bäuerin. Und glaub‘ mir‘s, der Bub ist gesund.“
Sie nahm ihr großes Wolltuch mit den Fransen von der Stuhllehne. Dann ergriff sie ihre Tasche.
„Los, Xaver! Und putz dir mal die Nase!“
Die Hebamme Apollonia Zurbriggen verlor in keiner Lebenslage die Nerven. Das war Voraussetzung für ihren Beruf.
Sie fuhren hintereinander auf dem Feldweg. Die Apollonia voraus und Xaver respektvoll hinterdrein. Rechts und links dehnten sich Felder und Viehweiden. Nach dem Dorf Karchenwald zu wurde der Boden besser; der Hof des Pflüger-Bauern lag jenseits des Baches hinter einem Waldstück und war sozusagen ein Außenseiter unter den Höfen, die sich sonst in einem Kreis um die Kirche und die Schule scharten.
Als die beiden den Wald hinter sich hatten und über die Brücke, die über den Bach gebaut war, hinübergefahren waren, konnten sie den Schranz-Hof schon liegen sehen.
Ein paar hundert Fichten standen ein wenig abseits der Straße, und unter ihnen erhoben sich gut
zwölf bis fünfzehn Gebäude, die zum Hof gehörten.
Das Wohnhaus trug über der Tür die Jahreszahl 1649.
Anton Schranz, der jetzige Bauer, stand unter der Tür des Wohnhauses und sah der Apollonia sorgenvoll entgegen.
„Kommst endlich? Es ist höchste Zeit!“
Und dann ging er ihr voraus durch alle Zimmer zur Schlafkammer.
Die Apollonia war vom Rad herunter wie der Wind und ließ es dem Xaver entgegenfallen, der selber eilig abgestiegen war. Im Gehen nestelte sie das Wolltuch los. In der Wohnstube hörte sie schon das Stöhnen der Bäuerin.
Der Schranz-Bauer umklammerte in der Schlafkammer mit eisenharten Fäusten die Bettkante und wies zu seiner Frau hin.
Die sah freilich traurig genug aus. Die Bäuerin lag auf dem Rücken und hatte die Knie hochgestellt. Ihr Kopf und die Schultern warfen sich in wilden Krämpfen herum, und ihre Lippen waren zusammengepresst.
Apollonia Zurbriggen hatte im Nu ihre Tasche abgestellt und schickte den Bauern hinaus. Dann untersuchte sie die Frau.
Schließlich kam sie wieder in die Küche und verlangte warmes Wasser, Tücher und Schüsseln.
Marei, die sechzehnjährige Tochter, gab ihr alles. Am Herd kochte die Magd. Die Jungmagd und die Kinder saßen mit ängstlichen Augen um den Tisch. Der Bauer lehnte am Schrank, und seine Wangenknochen mahlten.
Später rief ihn die Apollonia in die Schlafkammer. Er musste helfen, die tobende Bäuerin festzuhalten. Und so wurde nach knapp drei Stunden, so gegen neun Uhr abends, ein Wesen auf dem Hof zur Welt gebracht, das einmal ein Mensch und zwar ein Bub hatte werden sollen; jetzt aber war es noch gar nichts, ein kleines, armseliges Nichts, das nicht mehr lebte, als es geboren war.
Das Schlimmste aber war, dass die Kraft der Mutter in einem nicht zu dämmendem Blutstrom dahinfloss. Alle ihre Kunst und Erfahrung wandte die Hebamme an, aber nichts half. Schließlich sah sie den Bauern starr an;
„Hol den Doktor, Schranz-Bauer!“
Der wusste, was die Stunde geschlagen hatte. Niemals bisher war der Doktor auf den Hof gerufen worden – auch nicht, als die vier anderen Kinder das Licht der Welt erblickt hatten. Der Bauer ging hinaus und sagte laut in der Küche: „Der Doktor muss her – es steht schlecht.“
Der Toni, der Älteste, ging selbst und kam mit dem Arzt in dessen Wagen zurückgefahren. Und Dr. Gruber gab der Bäuerin eine Spritze, die einen momentanen Erfolg hatte.
„Bleiben Sie hier, Frau Zurbriggen!“, riet er ernst. „Wenn‘s wieder losgeht, muss sie sofort ins Krankenhaus.“
Dann fuhr er wieder fort.
Marei, die Tochter, brachte den Xaver und den sechsjährigen Gustl zu Bett. Auch die Jungmagd des Hofes ging schlafen. Toni und die Großmagd saßen weiter am Tisch und starrten dumpf vor sich hin.
Nach Mitternacht erschien der Bauer wieder auf der Schwelle der Schlafkammer.
„Ruf einen Wagen, Toni!“, sagte er. „Wir müssen sie fortbringen.“
Es war das erste Mal, dass die Bäuerin ihren Hof verließ. Und sie mochte wohl selber wissen, wie ernst es um sie stand, denn sie schickte die Apollonia hinaus und ließ die Marei zu sich rufen.
„Deine Mutter will dich sprechen“, sagte die Hebamme und wischte sich die Augen, denn die Sache ging selbst ihr nahe, obwohl sie von Berufs wegen gegen die Ereignisse von Geburt und Tod abgestumpft war.
Scheu betrat das Madel das Krankenzimmer.
Als es sich dem Bett näherte, öffnete die Bäuerin die Augen. Sie lag jetzt lang ausgestreckt, die Hände offen und matt neben dem sich unter der Bettdecke ab-zeichnenden Körper ausgestreckt. Ihr Gesicht war eingefallen und bleich, die Lippen darin waren wie ein blauer Strich.
„Marei“, flüsterte die Mutter, „ich muss jetzt fortgehen vom Hof. Ich hab Angst, was aus euch allen wird, wenn ich – wenn ich net zurückkommen sollt‘.“
„Aber du wirst doch zurückkommen, Mutterl!“, rief Marei ein wenig zu laut, um die Mutter über die Angst täuschen zu können, die hinter der betonten Zuversicht lauerte.
„Das weiß nur Gott“, sagte die Bäuerin ruhig. „Ich muss mein Haus bestellen, wenn ich‘s verlasse. Ich hab niemanden als dich, Marei! Versprich mir, dass du für Xaver und Gustl sorgen wirst nach besten Kräften und Gewissen, wie ich‘s getan hab.“
„Nach besten Kräften und Gewissen!“, wiederholte die Marei feierlich.
„Du wirst auf Vater und Toni achtgeben. Du weißt, sie streiten oft. Die Wirtschaft kennst du schon, du bist ein ernstes und zuverlässiges Madel.“
Marei schwieg und starrte aus angstgeweiteten Augen die Mutter an. War das ein Abschied für immer?
Die Mutter schien unendlich matt. Sie schöpfte zitternd Atem und verlangte noch einmal: „Versprich mir, dass du den Hof und die anderen net verlassen wirst, eh‘ net der Kleinste, eh‘ net der Gustl für sich selber sorgen kann! Du musst an meine Stelle treten, Marei.“
Ihre Stimme erstarb.
„Ich verspreche es, Mutterl!“, sagte Marei erschüttert und berührte die kalte Hand unter der Bettdecke.
Dann kam der Wagen. Die Mutter wurde mit einer Trage behutsam hineingehoben. Der Vater fuhr mit. Als die Apollonia sich nach der Abfahrt des Autos verabschiedete und in Begleitung von Toni auf ihrem Rad heimwärts fuhr, dachte sie: Die Schranz-Marei, sie kann einem leid tun! Außerdem ist sie ganz anders. Das ist net der Schranz‘sche Schlag.
Und vor ihrem geistigen Auge tauchten die Blondköpfe mit den hellen Blauaugen auf, zwischen denen Mareis Gesichtchen wie eine fremde Blume blühte.
2
Als der Bauer aus dem Städtchen zurückkam, war die Bäuerin schon tot. Auch im Krankenhaus hatte man der Blutungen nicht mehr Herr werden können. Nach zwölf Stunden war Maria Schranz eingeschlafen.
Nun kamen die Beisetzung und die große Leichenfeier. Sie musste ja großartig sein, denn es war nun einmal die Bäuerin vom größten Hof des Dorfes, die da gestorben war.
Die Marei arbeitete bis zum Umfallen, half beim Backen und Kochen, besorgte Blumen, ordnete die Stuben, kleidete die Geschwister und tat alles, was eine Erwachsene tut. Der Schmerz in ihr fand gar keinen Raum im Wirbel dieser Tätigkeit. Fast unwirklich schien es ihr, als die Erdschollen auf den Sargdeckel polterten und sie der Mutter die letzten Astern aus dem Garten ins Grab warf.
Als schließlich der Pfarrer und die vielen Trauergäste gegangen waren, saßen nur noch die engeren Verwandten in der großen Stube beisammen. Der Toni, still wie immer, lehnte in der Ofenecke, Marei hatte den Platz am untersten Ende des Tisches, der Vater in der Mitte.
„Nun sag mal, Anton“, verlangte Onkel Franz zu wissen, der drunten im Städtchen Reutlingen lebte, „wie ist das denn eigentlich gekommen mit der Maria?“
Der Schranz-Bauer sah ihn unbefangen an und antwortete ihm wahrheitsgemäß: „Sie ist von der Leiter gefallen – auf dem Heuboden von der Leiter gefallen.“
„Was hat eine schwangere Frau auf der Leiter zu suchen?“, räsonierte die Sixta, die Schwester des Bauern, die mit Franz Loibl verheiratet war, und sah ihren Bruder kopfschüttelnd an. „Warum musst‘ sie denn da hinaufsteigen?“
„Sie musst‘ ja net“, sagte der Bauer verärgert. „Sie tat‘s eben. Sie wollt‘ Stroh und Kienäpfel vom Boden holen, denn das Feuer war ausgegangen.“
„Das könnt‘ doch die Magd tun!“, ließ sich Cousine Lisbeth vernehmen.
Sie war aus der Loibl‘schen Familie und hatte nicht geheiratet, aber dennoch wusste sie alles besser, und Frau Sixta ärgerte sich ständig, dass sie ein Zimmer in ihrem Hause hatte, ein testamentarisch bestimmtes Zimmer.
„Die Magd war beim Melken“, sagte der Schranz-Bauer kurz.
„Und sonst war niemand im Hause?“, fragte die Therese, die Schwester der Verstorbenen, spitz vom oberen Ende des Tisches her. Sie hatte ihren Schwager nie leiden können. Die tote Bäuerin hatte wohl manchmal nach ehelichen Streitigkeiten ihr Herz bei der einzigen Schwester ausgeschüttet.
„Nein, wir haben die Rüben reingeholt, und alle waren beim Abladen“, sagte der Bauer und sah sie finster an.
„Alle net“, fuhr ihm die Therese dazwischen, „denn du hast doch neulich gesagt, dass ihr Streit miteinander hattet, als die Maria stürzte.“
„Kruzitürken!“
Der Bauer hieb mit der flachen Hand auf den Tisch, dass die Teller und Tassen tanzten. „Soll das ein Verhör sein? Werd‘ ich hier verdächtigt?“
„Du musst zugeben“, hüstelte Tante Ottilie aus dem benachbarten Dorf Feldenwang, die auch unverheiratet war und zu der Familie gehörte, der die Tote entstammte, „dass es sehr sonderbar ist! Ihr hattet in letzter Zeit viel Streit, mein‘ ich. Die Therese sagt‘s.“
Zustimmung heischend sah sie zu Therese hinüber und legte den kleinen, vertrockneten Vogelkopf schief.
„Ja, viel Streit“, echote Therese gehässig. „Die Maria war net begeistert über das fünfte Kind, net wahr?“
„Zum Teufel!“, schrie der Bauer. „Glaubt ihr, dass ich sie von der Leiter geworfen hab? Der Hof hätt ‘auch noch zehn Kinder ernährt, und die Maria war ein gesundes Weib. – Dummer Weiberklatsch, das alles!“
Damit verdarb er sich alles bei den Frauen.
„Die arme Maria“, lächelte Therese spitz und hinterhältig, „sie hatte net viel zu lachen! Die viele Arbeit, die vielen Kinder und einen Mann wie dich! Denn du musst doch zugeben, du bist ein Grobian, Anton!“
„Denk‘, was du willst!“, brummte der Bauer mürrisch und stützte die Ellbogen auf den Tisch. „Die Maria war eine gute Frau, und ich hab wahrhaftig nix dazu getan, sie ins Unglück zu bringen.“
Bei den letzten Worten war er halb aufgesprungen und schlug ein paarmal mit der Faust auf den Tisch.
„Du brauchst uns net rauszuschmeißen, wir gehn auch so“, sagte Therese hochnäsig. „Und dass du‘s weißt, Anton, uns siehst du net wieder!“
Damit erhob sie sich und ging zur Tür, und ihr Mann, der bisher schweigend der Auseinandersetzung gefolgt war, sah den Schranz-Anton bedauernd an, zuckte die Schultern und lief dann hinterdrein.
„Ich will auch gehn“, meinte Tante Ottilie, „es wird mir sonst zu dunkel. Lass dir‘s gut gehen, Anton, behüt‘ euch Gott, Toni und Marei!“
Sie erhob sich.
„Eigentlich“, sagte der Bauer langsam, „eigentlich hatte ich gedacht, Tante Ottilie, du könntest auf den Hof kommen und die Stelle von der Maria einnehmen, bis der Gustl groß ist.“
Es fiel ihm sichtlich schwer, er überwand sich ordentlich bei diesen Worten, aber er tat es aus Sorge um den Hof und die Kinder.
„Aber wo denkst du hin?“, ließ sich Tante Ottilie hüstelnd vernehmen. „Dazu bin ich schon zu alt und net mehr gesund genug! Und das Zusammenleben mit Mannsleuten bin ich auch net gewöhnt. Das ist nix für mich.“
Und sie nickte allen sehr flüchtig zu und ging so schnell wie möglich hinter den beiden anderen her.
„Das war schlecht, Anton“, meinte die Sixta, seine Schwester, und winkte mit der Hand ab. „Du hättest net so auftrumpfen sollen! Aber ich kenn dich. Du hattest schon immer einen Dickschädel. Ich kann dir auch net helfen, so gern ich‘s auch möcht‘, denn ich hab selber die große Wirtschaft und die Kinder, du weißt ja.“
Sie hatte recht, aber man konnte auch deutlich hören, dass sie froh war, dass es so war.
„Nein, und ich kann auch net!“, sagte Lisbeth rundheraus. „Ich würd‘ mich hier totheulen, wo alles so düster und ungemütlich ist. Und dann hab ich auch Angst vor Toten. Am End‘ wird die Maria wiederkommen …“
„Kruzitürken, hör‘ endlich auf!“, polterte der Bauer böse. „Ich kann‘s schon net mehr hören! Die Maria ist von der Leiter gefallen, weil sie rückwärts nach mir geguckt hat, denn ich stand unten und schimpfte. Donnerwetter, darf ein Mann, dem kalt ist, net mehr schimpfen? Bin ich deswegen ein Mörder? Niemand konnt‘ ahnen, dass so was draus wird, und ich bin weiß Gott am härtesten gestraft. Du bist narrisch, wenn du mehr darin siehst!“
Die Lisbeth erhob sich beleidigt.
„Ich bin net narrisch“, sagte sie und drückte das Kinn gegen den Hals. „Aber du bist wirklich kein Mensch, mit dem ich zusammenleben möcht‘. Mir tun nur die armen Kinder leid.“
Eine halbe Stunde später waren sie alle fort und das Haus leer wie nie zuvor. Die Mägde räumten das Geschirr weg, und der Bauer ging in die Stube, wo er seine Bücher führte, schob die Hände in die Taschen und rannte auf und ab.
Die Marei brachte die Kleinen zu Bett. Dann stellte sie dem Toni das Abendbrot hin und trug dem Vater einen Teller Suppe in die Stube. Er rannte hin und her und sah sie nicht an, bis sie fast wieder zur Tür hinaus war. Dann rief er sie zurück.
„Marei!“
„Ja, Vater?“ Bebend, verloren zitterten die zwei Worte im großen Raum.
„Komm hierher, Marei I Du hast‘s gehört, keiner will zu uns kommen. Sie haben Angst vor mir, sie geben mir die Schuld am Tod der Mutter. Denkst du auch so?“
„Nein, Vater, ich net!“
Die blauen Augen sahen ihn fest und ehrlich an.
„Und was soll werden, Marei? Wir müssen eine Fremde auf den Hof nehmen.“
„Nein, Vater, die Großmagd und ich, wir schaffen‘s schon!“
„Du?“
Er sah ungläubig auf sie herab, die so klein und zart vor ihm stand.
„Du bist doch noch ein Kind.“
„Ich bin eine Schranz“, sagte sie ruhig. „Ich werd‘s schon schaffen. Außerdem gab ich der Mutter mein Wort!“
„Was heißt das?“
„Sie wollt‘, dass ich ihre Stelle einnehm‘, wenn sie net wiederkäm‘. Ich musst‘ ihr versprechen, für euch alle zu sorgen, bis der Gustl groß ist.“
„Hm! Das traute sie dir zu?“
Er sah auf seine Tochter hinab, forschend, wankend, um einen Entschluss ringend.
Der große, unbeholfene Mann in seiner Hilflosigkeit rührte sie sehr. Sie lächelte tapfer.
„Ich trau‘s mir auch zu, Vater.“
„Also denn“, sagte er tief atmend, „mach‘s gut, Marei! Es ist ein hartes Stück Arbeit. Versprich mir, dass du net davonlaufen wirst!“
„Ich versprech‘s!“, antwortete sie und legte ihre kleine Hand in die seine.
Dann zog sie sie schnell wieder zurück, nahm das Tablett und floh hinaus. Draußen schluchzte sie trocken auf und unterdrückte es gleich wieder.
Sie war sich bewusst, dass sie ihre Jugend dem Hof opferte. Aber ihre Seele war bereit zu diesem Opfer.
3
Das war der trübseligste Winter, den der Schranz-Hof je erlebt hatte.
An allen Ecken und Enden fehlten die Hände der Bäuerin, nicht nur beim Backen der Christstollen und beim Schmücken des Weihnachtsbaumes.
Die Marei tat, was sie konnte, um die Mutter zu ersetzen. Die Wirtschaft lief ja fast von selbst, und die Großmagd war umsichtig und verlässlich. Xaver und Gustl hatten sich angewöhnt, mit allen Sorgen zu Marei zu kommen, die so erwachsen aussah in ihrem schwarzen Kleid, über ihre Jahre hinaus verständig, wusste die Marei Rat zu geben und Frieden zu stiften, wo es nottat.
Aber da, wo es am nötigsten war, war sie machtlos. Der Vater und der Toni gingen einander aus dem Wege, sie grüßten sich kurz, mehr aber nicht, und wenn der Vater einen Befehl gab, der dem Toni nicht passte, dann hatte der Sohn eine Art, die Lippen spöttisch zu verziehen, die Marei ängstlich machte.
Der Toni war viel bei den Pflügers. Marei wusste, dass er Liesis wegen hinging. Die Liesi war achtzehn und Toni einundzwanzig. Waren sie nicht noch zu jung für eine Ehe? Aber es konnte keinen Zweifel geben, dass der Toni eine Heirat wollte.
Die Liesi auf dem Schranz-Hof als Herrin! Marei seufzte und fürchtete sich vor der Zukunft.
Der Vater dagegen schien erfreut von diesen Aussichten. Er sah in der Schwiegertochter nur eine Arbeitskraft.
So wurde es April. Die Luft war mild und schmeckte nach warmem Regen.
Nach dem Abendbrot hatte der Toni die Mütze vom Haken genommen und „Pfüet di Gott!“ gesagt. Natürlich ging er wieder zu den Pflügers. Das war immer noch besser, als wenn er sich sonst irgendwo herumtrieb.
Die Marei stand im Kinderzimmer. Rechts und links saßen Xaver und Gustl in den Betten und hatten die Hände gefaltet, und Marei stand in der Mitte auf den gescheuerten Dielen und sprach die Worte mit: „Müde bin ich, geh zur Ruh‘…“
Ach ja, sie war müde, so ungeheuer müde und erschöpft! Von sechs Uhr früh bis nachts um zehn war sie auf den Beinen, und es gab keine Minute, die ihr gehörte.
„Schlaft gut!“, sagte sie freundlich, als das Gebet beendet war.
„Nacht, Marei!“
„Gut‘ Nacht!“
Sie löschte das Licht. Gustls Socken mussten noch gestopft werden, und die Abrechnung der Molkerei und des Eierhändlers warteten noch auf Bearbeitung.
Langsam ging sie in die Wohnstube und rieb sich die Augen. Sie waren müde, diese jungen Augen, ganz einfach übermüdet. Und ein langer Abend lag noch vor ihnen.
Währenddessen traf der Toni die Liesi am Waldrand.
Ein sachtes Rieseln kam herab, ein angenehmer Regen – Frühlingsregen. In der Dämmerung erhoben alle Vögel ihre Stimmen zu einem vieltönigen Konzert.
Keine der neuen Knospen im Gezweig war in der Dunkelheit des Waldes mehr zu erkennen. Aber Liesis blondes Haar leuchtete.
„Ich muss zurück, Toni, es fängt an zu regnen. Bringst du mich heim?“
„Bleib doch noch, Liesi! Es ist so warm, und unter den Bäumen ist‘s trocken. Ich hab mich so gefreut auf dich und diesen Abend.“
„Gut, ein paar Minuten.“
Sie schmiegte sich an ihn. Er hatte den Arm um ihre runde Schulter gelegt.
„Liesi, ich muss dich was fragen.“
Etwas beengte ihm die Kehle, er war sehr erregt.
„Na, frag‘ schon!“
„So einfach ist das net, Liesi! Bist du mir gut?“
„Wär‘ ich denn sonst hier?“
Sie lachte hell auf und warf den Kopf zurück. Ihr Gesicht leuchtete in der Dunkelheit.
Er riss sie an sich und küsste sie.
„Liesi, du …“
Reglos standen die Bäume in der stillen, regensatten Luft. Doch all das drängende Leben, das dieser weiche Vorfrühlingstag geweckt hatte, konnte noch keine Ruhe finden. Vom Felde her schrie schrill das Rebhuhn, irgendwo schnatterte ein verliebter Erpel. Auf den Weiden muhten die Kühe, die man schon hinausgebracht hatte. Die Fledermäuse huschten im Zickzack am Grabenrand, und bleiche Motten taumelten umeinander. Am immer dunkler werdenden Himmel zog eine schmale Mondsichel herauf, immer wieder von kleinen, vorüberziehenden Wolken verdeckt.
„Nun muss ich aber wirklich gehen!“
Liesi machte sich verlegen los. Sie strich über das Haar und zupfte an der Bluse. Tonis Küsse brachten sie in Erregung.
„Ich wollt‘ dich ja was fragen.“
,„Ja, Toni.“
Sie wartete und sah auf den Boden.
„Willst du meine Frau werden, Liesi?“
„Deine Frau? Wann? Toni – jetzt schon?“
Sie dehnte die Worte.
„Warum fragst du? Natürlich jetzt. Ich will net mehr warten. Wenn ich dich nach Hause bring‘, kann ich gleich mit deinen Eltern reden!“
„Nein, nein, heut‘ net! Wir sind ja noch so jung, Toni, und – bei euch müsst‘ alles anders sein.“
„Was müsst‘ anders sein?“
Er hielt sie an den Schultern mit einem harten Griff ein Stückchen von sich ab.
„Was passt dir net bei uns?“
„Ich mag net fremder Leut‘ Kinder großziehen!“, platzte sie heraus. „Ich will mich net mit der Schwägerin streiten, und mich vom Schwiegervater nur belehren lassen. Wenn ich Bäuerin bin, will ich mein Reich für mich allein haben, verstehst du?“
„Oh, sehr gut!“
Er lockerte den Griff seiner Hände und ließ die Arme herunterfallen.
„Du willst also net auf den Schranz-Hof. Der Hof passt dir wohl net?“
Seine Stimme klang kalt und enttäuscht.
„Der Schranz-Hof passt mir schon“, sagte die Liesi kleinlaut. „Es ist ein schöner Hof, ein großer Hof …“
„…nur mit etwas zu viel Drum und Dran“, lachte er bitter. „Ich weiß schon, wie du‘s meinst. Tja, das ist ja denn wohl eine Absage, net wahr?“
Ein Funken Hoffnung war noch in seiner Stimme.
„Du bist schnell damit fertig“, wurde sie jetzt böse. „Man kann doch warten, wir sind doch noch jung.“
„Warten, bis etwas Besseres kommt, und inzwischen den Toni für alle Fälle festhalten, wie? Nein, Liesi, so net! Der Gustl ist sechs und der Xaver zehn. In zehn Jahren erst ist Platz auf dem Hof. Glaubst du, ich will so lang warten?“
„Ich auch net!“, rief Liesi ärgerlich. „Ich kenn‘ diese Wirtschaft von daheim. Ich will das net. Dann heirat‘ ich lieber einen Beamten.“
„Hast am End‘ schon einen?“, rief der Toni wütend vor Enttäuschung. „Dann geh doch! Geh, warum bist du noch hier? Geh!“
„Ich geh auch!“ sagte sie patzig. „Ich pfeif auf deinen Hof!“
Und dann drehte sie sich um und lief im Dunkeln davon.
So ist das also, dachte der Toni enttäuscht. Zu unserem Treffen im Wald kommt sie, aber auf den Hof und heiraten will sie net. Dieser verfluchte Hof! Keine wird dahin wollen!
4
Am nächsten Tag goss es in Strömen. Keiner konnte draußen etwas tun, sie waren alle ans Haus gefesselt.
Xaver und Gustl waren nass von der Schule heimgekommen und tobten nun durch das Haus. Marei jagte mit trockenen Kleidungsstücken hinterher. Der Bauer saß mürrisch in der Stube über den Büchern. Der Toni drückte sich herum.
Schließlich rief der Schranz-Bauer seinen Sohn zu sich.
„Wir wollen vergleichen“, sagte er. „Lies du die Zahlen vor, ich hak‘ ab!“
Eine Weile ging alles gut. Monoton klang Tonis Stimme beim Vorlesen.
„Fünfzehn Doppelzentner Hafer, zehn Doppelzentner Gerste …“
Dann sah der Bauer auf.
„Wie steht‘s mit der Pflüger-Liesi und dir? Gibt‘s bald Hochzeit?“
Der Sohn begegnete fest dem Blick des Vaters.
„Nein, daraus wird nix!“
„Was heißt das, Bub? Habt‘s euch gestritten?“
„Es ist aus für immer. Sie will net Bäuerin werden auf unserem Hof.“
Der Toni starrte den Vater trotzig an. Beide hatten sich in den Stühlen zurückgelehnt. Beide schoben die Hände in die Hosentaschen und winkelten die Ellbogen an. Beide hatten die Beine nebeneinander lang unter dem Tisch ausgestreckt. Aber sie wussten nicht, wie ähnlich sie sich in diesem Augenblick waren.
„Warum will sie net auf unseren Hof? Herrgott, red‘ schon, Bub!“
„Sie will net in diese Wirtschaft hier! Bei ihr daheim greint jetzt der Kleine. Sie muss viel arbeiten und hat keine Freiheit. Und hier wär‘s genau dasselbe, sagt sie. Und das will sie net.“
„So, so, das will sie net. Hm, ein feines Madel, ein sauberes Madel! Das ist ja die Höhe!“
Er hieb mit der flachen Hand auf den Tisch, seine Augen funkelten.
„Es ist aus, und ich will sie auch gar net mehr“, brummte der Toni. „Soll sie doch ihren Beamten heiraten!“
Seine trotzige, gekränkte junge Stimme hatte verzweifelte Ähnlichkeit mit der eines enttäuschten Kindes.
„Aber es wird mit jeder anderen genauso gehn!“, schrie er dann und schlug ebenfalls auf den Tisch. „Du wirst sehn, Vater, keine will zu uns auf den Hof! Und daran sind nur die Buben schuld, die großgezogen werden müssen, und diese ganze verdammte Wirtschaft!“
„Du vergisst dich!“, brauste der Schranz-Bauer auf. „Keiner kann etwas dafür!“
„Doch, du! Alle sagen ja, dass Mutter noch leben könnt‘, dass alles nur deine Schuld ist, alle …“
„Du bist narrisch! Das nimmst du sofort zurück, Bub!“
Sie waren beide aufgesprungen und funkelten.sich voller Hass an.
„Ich nehm‘ nix zurück!“, schrie der Toni. „Du bist ein Tyrann! Mutter durfte nur arbeiten und gehorchen, und jetzt spielt die arme Marei diese Rolle. Und ich für mein Teil bin auch net mehr als ein Knecht und werd‘ herumkommandiert. Das passt mir schon lang net mehr. Schließlich bin ich erwachsen! Und wenn ich ein Madel auf den Hof brächt‘, würd‘s ihr genauso ergehn, jawohl! Wer hierhin kommt, gerät in die Tretmühle: der Hof, der Hof und nochmal der Hof!“
„Das muss so sein! Du sollst den Hof erben. Für wen tu‘ ich denn schließlich alles? Alle anderen Interessen müssen zurückstehen, der Hof ist das Wichtigste!“
„Mein Leben ist mir wichtiger!“, rief der Toni aus und fuchtelte mit den Händen durch die Luft. „Die Liesi hat recht. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ich pfeif‘ auf den Hof!“
„Gut! Wenn das dein Ernst ist, dort ist die Tür, Toni!“
Unheimlich ruhig und kalt klang auf einmal die Stimme des Schranz-Bauern. „Dann geh und sieh zu, wie du ohne den Hof zurechtkommst.“
„Pah! Ich mein‘s ernst, ich geh!“
„Dann red‘ net, sondern geh! Der Hof legt keinen Wert auf Verräter!“ Hoch aufgerichtet stand der Bauer neben dem Tisch.
Der Toni maß den Vater drohend. Er atmete schwer, öffnete die Lippen zu einer Entgegnung, doch dann ließ er es, zuckte die Schultern und wandte sich ab. Er ging hinaus, die Tür flog hinter ihm ins Schloss.
Das war wohl der schlimmste Streit zwischen Vater und Sohn bisher gewesen. Der Jähzorn war daran schuld und viel aufgespeicherte Bitterkeit, Missverständnisse und Trotz, vor allem der Trotz, der keinen Schritt nachgeben wollte.
Toni stand in seiner Kammer.
Verräter hat er mich genannt, grübelte er. Narrisch wär‘ ich, hat er gesagt, und dann hat er mich hinausgeworfen!
Was er selber gesagt hatte, beachtete er nicht. Dass er seine Wut und Enttäuschung über Liesis Ablehnung an seinem Vater ausgelassen hatte, ging ihm nicht auf. Aber nun war dieses Wort gesagt: Der Hof legt keinen Wert auf Verräter!
Gut, ich werd‘ gehn!, beschloss der Toni. Für immer! Mich sieht er net wieder!
Die Marei hörte ihn fortgehen. Sie lief ihm nach.
„Toni, Toni – wohin gehst du denn?“
„Fort, Marei, für immer! Ich hab mich mit dem Vater zerstritten.“
„O mein Gott, das kann doch net wahr sein! Denk‘ an die Mutter! Was soll werden? Du bist doch der Erbe. Vater hat‘s g‘wiss net so gemeint. Komm zurück, Toni, du darfst net gehn!“
Sie hatte Tränen in den Augen, die jetzt mit den Regentropfen zusammen über ihr schmales Gesicht liefen.
„Nein, ich kann net zurück! Behüt‘ dich Gott, Marei!“
Er wandte sich brüsk ab und schritt mit selbstquälerischer Gelassenheit davon.
Die Marei lief zurück ins Haus und in die Stube zum Vater.
„Vater!“, schrie sie. „Der Toni geht fort, für immer, Vater! Das darf net sein!“
„Ich halt‘ ihn net“, sagte der Vater langsam mit kalten Augen. „Er ist mein Sohn net mehr!“
Das Madel zuckte wie unter einem Schlag zusammen und wankte davon in seine Kammer. Über dem Bett sank die Marei weinend zusammen. Die Mutter, sie fehlte; sie allein hätte hier vielleicht zu vermitteln vermocht. Mareis Hände waren zu schwach, ihre Worte hatten zu wenig Gewicht.
Wie schwer war die Aufgabe doch, die die Tochter des Schranz-Bauern übernommen hatte! Sechzehn Jahre war sie alt, und was verlangte das Leben bereits von ihr! Mit schmerzenden Gliedern, matt und müde, raffte die Marei sich auf und ging an ihre Arbeit. Pflichten, nur Pflichten gab‘s für sie, nach Tonis Weggang mehr denn je.
5
Die Zeit verging. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, eine niemals abreißende Kette, die die Menschen gefangen hielt. Warum nur fand die Marei keine anderen Bilder für ihre Gedanken als „Kette“ und „Gefangenschaft“?
Sie war nun siebzehn Jahre alt und voll erblüht. In voller Blüte stand auch der Obstgarten und feierte den Maiensonntag, und die Marei stand an der Hecke und sah auf die Dorfstraße hinaus.
Der Vater hatte den jetzt siebenjährigen Gustl mitgenommen und machte einen Besuch beim Bürgermeister. Xaver war mit dem Rad unterwegs, die Großmagd saß in der Diele, und die anderen Knechte und Mägde waren allesamt ausgeflogen, um den Sonntag zu genießen.
Vom Dorfe her kam eine junge Frau mit einem eleganten Kinderwagen. Es war die Liesi, die den Postmeister geheiratet hatte. Sie machte einen Besuch bei den Eltern, denn nun steuerte sie auf die Brücke und auf das Wäldchen zu. Nach dem Schranz-Hof schaute sie nicht hinüber.
Die Liesi war inzwischen Mutter geworden. Wie weit lag das alles schon zurück! Ihretwegen hatte der Toni den Hof verlassen und blieb in der Fremde verschollen. Seinetwegen war der Vater so verändert, sprach nur das Nötigste und ging wie fremd zwischen den Seinen umher.
Vom Dorf her hörte man Tanzmusik.
Niemals hatte die Marei in ihrem Leben getanzt. Zwar trug sie nun keine dunklen Trauerkleider mehr, aber ihr Wesen war so ernst und verschlossen, als habe sie sie noch nicht abgelegt.
Wieder erschien jemand auf der Dorfstraße. Diesmal war‘s Elisabeth Sarch, mit der Marei zur Schule gegangen war.
Elisabeth war die Tochter eines Tagelöhners. Ihr Kleid war schon ein wenig aufgetragen, aber lustig und voll bunter Blumen. Das dunkle Haar trug sie kurzgeschnitten und modern gewellt. Aber ihr etwas schwerfälliger Gang sah sonderbar aus auf den hohen Absätzen.
„Grüß Gott, Elisabeth!“, rief die Marei über die Hecke.
„Grüß Gott!“, gab das Madel verlegen zur Antwort und kam näher.
„Gehst du tanzen?“
„Ja, ich geh tanzen. Im Karchenkrug ist heut‘ Tanz.“ Ihre Augen glänzten.
„Unsere Knechte sind auch dort“, sagte die Marei leise.
Elisabeth verstand sie falsch. Sie fühlte, sich ein wenig gekränkt, weil die andere nur von den Knechten redete.
„Auch Bauernsöhne tanzen im Karchenkrug, sagte sie steif. „Du kannst ruhig hingehen, Marei.“
„Nein, nein, das mein‘ ich net. Ich kann ja gar net tanzen. Was sollt‘ ich wohl dort?“
„So was lernt man schnell“, meinte Elisabeth rasch versöhnt. „Man muss halt mitmachen, dann fällt‘s gar net auf. – Warum gehst du nie hin?“
„Ich muss daheim die Mutter ersetzen. Es gibt viel Arbeit bei uns auf dem Hof. Und dann die beiden Buben …“, sagte sie leise.
„Jessas, ja!“, bestätigte Elisabeth mitleidig. „In deiner Haut möcht‘ ich auch net stecken. Manchmal ist‘s ganz schön, daheim nur eine kleine Wirtschaft zu haben. Schließlich bist du ja auch jung, net wahr?“
Die Marei lachte unsicher und senkte den Blick.
„Ja mei, du musst auch einmal heraus, sonst versauerst du ja! Lass‘ es dir gut gehen, Marei!“
Weg war sie! Und ihrem munter flatternden Rock sah man an, dass sie froh war, das höflich-steife Gespräch hinter sich zu haben. Wie würde sie gleich lachen und fröhlich sein im Karchenkrug und mit den Burschen tanzen! Dorthin passte sie, aber nicht zu der ernsten Marei! Das junge Madel wanderte langsam, einen Fuß vor den anderen setzend, durch den Obstgarten.
.Schließlich bist du ja auch jung!, hatte die Elisabeth gesagt.
Tatsächlich, sie war jung, sie war gerade siebzehn Jahre alt.
Mein Gott, dachte Marei betrübt, ich leb‘ wie eine alte Jungfer!
Der Grasgarten war zu Ende. Mechanisch öffnete die Marei das kleine Gartentor, das auf die Dorfstraße hinausführte, und wanderte weiter. Kein Mensch war weit und breit zu sehen.
Die Marei schlug den Weg zum Bach ein und überquerte die kleine Bohlenbrücke. Dann trat sie unter die Tannen des Wäldchens und schlenderte auf dem schmalen Fußweg weiter.
Seit wann war sie wohl nicht mehr spazieren gegangen? Immer hatten ihre Ausgänge einen praktischen Sinn gehabt, einen Einkauf, eine Bestellung oder einen wichtigen Besuch.
Jenseits des Wäldchens begann das offene Land, in dem links der Pflüger-Hof lag. Diesen mied sie und hielt sich nach rechts, wo der Weg nach Feldenwang führte. Es kam ihr nicht ein einziges Mal in den Sinn, dass es gefährlich sein könnte, so mutterseelenallein durch die Einsamkeit zu wandern.
Wie schön!, dachte sie. Wie wunderschön ist meine Heimat! Man vergisst‘s vor lauter Arbeit und Müh!
Und dann setzte sie sich auf einen kleinen Hügel, den zwei Tannen krönten, und blickte in das Tal hinab, in dem Feldenwang lag.
Rechts von ihr ragte hoch bis in den Himmel die Karchenspitze, der Hausberg von Karchenwald. Daran schlossen sich die anderen Bergriesen an. Von der Frühlingssonne überglänzt lagen sie da, ruhig, unerschütterlich, und alles menschliche Jagen und Hetzen seinen so fern.
Frieden zog ein in das Herz des jungen Madels, und es legte still-glücklich die fleißigen Hände einmal untätig in den Schoss.
In Feldenwang wusste man auch, dass heute in Karchenwald im „Karchenkrug“ Tanz war.
Loisl Windegger, der junge Herr vom Windegger-Hof, stand vor dem Spiegel und band sich die Krawatte.
„Ist‘s so gut, Mutterl? Schau doch mal her!“
Die alte Bäuerin kam angeschlurft. Sie bekam den Rücken nicht gerade, als sie zu dem hochgewachsenen Sohn aufschaute. Das kam daher, dass Magdalena Windegger eine Wirbelsäulenverkrümmung hatte, die ihr viel zu schaffen machte. Dieser Sohn war ihr Jüngster, denn auf dem Windegger-Hof bestimmte das Erbrecht dem Jüngsten den Hof.
„Freilich, Loisl, ‘s ist schon alles so recht“, sagte sie. „Nun eil‘ dich, sonst kommst hin, wenn schon viele betrunken sind, und dann gibt‘s gleich wieder Streit!“
„Ich hab nie Streit, Mutterl“, erklärte der Loisl selbstbewusst. „Du weißt, ich bin ein sehr ruhiger Mensch.“
„Es kann der Frömmste net in Frieden leben, wenn‘s dem bösen Nachbarn net gefällt“, antwortete die Mutter und fügte hinzu: „Und was die Ruh angeht, Loisl, so wünsch ich mir, dass du ein bissel mehr Schwung hast als bisher. Die Madeln wollen genommen werden, und der Hof wartet auf eine junge Frau!“
„Ich weiß, ich weiß!“
Der junge Bauer mit den breiten Schultern und der gesunden Gesichtsfarbe wehrte gleich ab.
„Ich kann ja net dir zulieb‘ irgendeine heiraten! Ein bissel mögen muss ich sie schon, net wahr?“
„Ich machs‘ net mehr lang, Loisl“, sagte seine Mutter ernst mit zittriger Stimme. „Und ich will beruhigt sterben. Also sieh dich ein bissel um!“
„Ja, Mutterl“, versprach der Sohn, klopfte noch ein Stäubchen vom Janker und ging.
Schön gemächlich ging er. Er hetzte nicht, er war nicht ungeduldig, nach Karchenwald zu kommen. Die Windeggerin sah ihm nach und seufzte.
6
Schon von Weitem sah der Loisl ein junges Madel auf dem Hügel, der an dem Feldweg lag, sitzen.
Er kniff die Augen zusammen und blinzelte gegen die Sonne. Wer war dieses Madel? Er hatte es noch nie gesehen.
Jetzt war er schon ganz dicht bei ihr angekommen und sagte höflich: „Grüß Gott!“
Sie hatte sich fluchtbereit erhoben und starrte ihn aus misstrauischen Augen an wie ein sicherndes Wild. Aber dann beruhigte sie sich sichtlich. Der junge Mann sah nicht aus, als ob er etwas Böses im Schilde führte.
„Grüß Gott!“, nickte sie und sah an ihm vorbei.
„Das ist aber gefährlich, so allein“, begann er und drehte seinen Jankerknopf vor Verlegenheit zwischen den Fingern.
„Ich fürcht mich net“, wehrte die Marei ab. „Außerdem geh ich gleich wieder nach Haus.“
Sie sprach schroffer, als es nötig gewesen wäre.
„Wo ist denn dein Zuhause?“
Ihr Blick traf den Knopf, den er unablässig drehte. Ein kleines Lächeln blühte um ihre abwehrend gepressten Lippen. Jessas, der war ja mindestens so unsicher und hilflos wie sie selbst!
„In Karchenwald“, gab sie zurück.
„Dahin geh ich zum Tanz, in den Karchenkrug“, erklärte er.
Und dann nahm er einen neuen Anlauf und brachte mutig hervor: „Darf ich dich nach Karchenwald zurückbringen?“
Sie maß ihn abwägend von Kopf bis Fuß.
„Der Weg hat Platz für uns beide“, sagte sie schnippisch.
Das Madel ist aber kratzbürstig!, dachte der Loisl beeindruckt und wagte nichts mehr zu sagen.
Er setzte sich in Bewegung und sie ebenfalls. So marschierten sie in kurzem Abstand auf das Wäldchen zu.
Den einzigen Beweis dafür, dass ihre Sympathie auf den ersten Blick gegenseitig war, bildete die Tatsache, dass sie beide sehr langsam, auffällig langsam gingen und es gar nicht so eilig hatten, nach Karchenwald zu kommen; und jedes Mal, wenn er ein wenig den Schritt verlangsamte, passte sie sich diesem Tempo an. Sie hätte ihn ja überholen und an ihm vorbeigehen können. Aber das tat sie nicht.
„Wo wohnst du denn in Karchenwald?“, fragte er schüchtern und sah sich halb zu ihr um.
„Auf dem Schranz-Hof“, sagte sie, und der Blick ihrer blauen Augen war freundlich.
„Auf dem Schranz-Hof? Bist du aus der Familie? Vielleicht die Marei?“
Er war ein Kind der Gegend und wusste von einer Tochter dieses Namens, die die ganze Wirtschaft führte.
„Die bin ich“, sagte sie. „Warum? Weißt du was von mir?“
„Ich bin der Windegger-Loisl aus Feldenwang“, stellte er sich vor. „Mir gehört der Windegger-Hof, weißt? Es ist ein schöner großer Hof.“ Er wollte ihr gern imponieren.
„Hm“, machte sie. „Das hab ich net gewusst, Loisl! Man kann ja net wissen, wer alles draußen herumläuft. Und du siehst so städtisch aus.“
„Macht nix, Marei! Und der Anzug ist nur wegen der Tanzerei im Karchenkrug.“
Sie blieben stehen und reichten sich die Hände. Dabei sahen sie sich länger in die Augen, als es für die Vorstellung nötig war.
„Und warum bist du so allein?“, wollte er wissen.
Es tat gut, ihn so besorgt zu sehen.
„Ach“, lächelte sie, „es war das erste Mal. Sonst geh ich nie aus dem Haus. Ich hab so viel zu tun. Der große Hof, die kleinen Geschwister, und meine Mutter ist schon mehr als ein Jahr tot.“
„Ich weiß“, nickte er. „Du bist ein tüchtiges Madel.“
„Und heut‘“, fuhr sie seltsam aufgeschlossen fort, ,,hatte ich solche Sehnsucht nach der Freiheit, da musst‘ ich hinaus. Ich hörte die Musik, und dann sah ich eine Schulfreundin zum Tanz gehn …“
Ihre Stimme brach zaghaft ab. Hatte sie etwa geklagt? Das wollte sie nicht.
„Gehst du net hin?“, drängte er sanft.
„Nein“, lächelte sie, „ich kann gar net tanzen, net einen Schritt! Ich würd‘ auch gar net dahin passen.“
Was ist sie für ein hübsches Madel!, dachte er.
Er hat gute, treue Augen!, dachte sie vertrauensvoll. Er ist sicher ein netter Mensch.
Nun waren sie mitten im Wäldchen. Von Weitem sah man die Tannen vom Schranz-Hof. Er bekam Angst, dass sie ihm entschlüpfen könnte.
„Wenn du gern wieder mal spazierengehen möchtest“, sagte er ungeschickt, „dann möcht‘ ich mit dir gehn und aufpassen, dass dir nix zustößt.“
„Wirklich?“, wunderte sie sich. „Ich will nur hoffen, dass du net allen Madeln solche Vorschläge machst.“
Dann waren sie aus dem Wald heraus und auf der Straße.
„Wo denkst du hin?“, verwahrte er sich. „Das denkst doch net wirklich von mir? Mein Mutterl ist ganz unglücklich, dass ich so schüchtern bin. Bis mir ein Madel richtig gefallt, hat‘s mir schon ein anderer weggeschnappt.“
„Jessas, dann schickt dich wohl deine Mutter zum Tanz, wie?“, lachte Marei fröhlich.
„Du hast‘s erraten“, nickte er ernsthaft. „Mein Vater ist tot, die Geschwister sind aus dem Haus, und meine Mutter ist krank und alt. Ich bin der Jüngste und der Hoferbe, und sie möcht‘ eine tüchtige Schwiegertochter haben.“
Über Mareis schönes Gesicht zog ein Schatten. Eine Schwiegertochter! Sie war mit dem Schranz-Hof verheiratet. Für sie durfte es nichts anderes geben.
Nun standen sie neben dem Weg, der zum Tor führte.
„Pfüet di‘ Gott, Marei!“, lachte der Loisl mit strahlendem Gesicht. „Und eigentlich, hm, eigentlich könnt‘ ich jetzt umkehren. Was soll ich beim Tanz, wenn du net dort bist?“
Sie zog errötend ihre Hand aus der seinen und eilte auf das Haus zu. Sie schaute sich nicht einmal um, lief an der Großmagd vorbei und in ihre Kammer.
Dass sie dann heimlich durch das Fenster spähte, ob er tatsächlich umkehrte, konnte er nicht wissen.
Er kehrte aber wirklich um und pfiff zufrieden vor sich hin, während er zurückwanderte. Er machte sich nichts aus der Tanzerei, und ein Madel nach seinem Geschmack hatte er ebenfalls gefunden. Was wollte seine Mutter noch mehr?
Die Marei aber drückte die Hand auf das wild klopfende Herz.
Was ist das?, fragte sie sich. Er gefällt mir so gut! Aber es darf doch net sein!
7
Aber schon war sie mittendrin in einem Abenteuer, der ersten Erschütterung ihres Herzens.
Als sie sich an diesem Abend schlafen legte, stieg Loisls Bild vor ihr auf. Sie sah ihn die Strähne seines dunklen Haares aus seiner sonnengebräunten Stirn streichen. Sie sah seine guten braunen Augen lächeln.
Loisl, dachte sie voller Scham und heimlichem Schauer, er will auf mich warten im Wald! Es wartet jemand auf mich! Ich bin net mehr ganz allein!
Sie schlief in dieser Nacht unruhiger als sonst. Am Morgen fand sie alles unglaubhaft und töricht.
Ich werd‘ niemals hingehen!, nahm sie sich vor.
Doch je näher der Abend kam, desto unruhiger wurde sie. Ihre Gedanken stahlen sich zum Waldrand.
Ob er wirklich wartet? Oder war es nur ein Spaß? Aber er ist gestern auch net mehr zum Tanz gegangen. Vielleicht, vielleicht …
Um acht Uhr, als Xaver und Gustl in ihren Betten lagen, schlich sie hinaus. Niemand sollte wissen, dass sie fortging.
„Mir ist net wohl, ich geh schon zu Bett“, sagte sie zu der Magd.
Oh, diese Flucht aus dem Hausflur auf den Zehenspitzen! Dieser hastige Lauf an der Hecke entlang, geduckt, um nicht gesehen zu werden! Und dann der Umweg zum Wald!
Wahrhaftig, er war da! Er wartete wirklich, wie versprochen. Diesmal hatte er ein kariertes Sporthemd an, das an seinem starken, braunen Hals offenstand. Er saß auf dem Rad, hielt sich am Stamm einer Kiefer fest und hielt nach ihr Ausschau.
Am liebsten wäre sie jetzt umgekehrt. Was sollte er von ihrer allzu großen Bereitschaft denken?
Aber er hatte sie schon gesehen.
„Oh“, rief er leise, „schön, dass du gekommen bist! Ich bin sehr froh, denn ich hab seit gestern nur an dich gedacht.“
Sie sagte gar nichts, stand vor ihm und reichte ihm die Hand, und er sprang vom Rad, ergriff ihre Hand mit beiden Händen und drückte sie an $eine Brust. Es war eine große Zärtlichkeit in dieser Bewegung.
So trafen sie sich nun jeden Abend im Mai, und wenn die Marei wirklich einmal nicht fort konnte, dann glaubte sie, die Welt ginge unter, denn sie liebte den Loisl.
Eines Abends küsste er sie stürmischer als sonst.
„Wir kennen uns jetzt lang genug, Marei“, drängte er. „Wir sind uns gut, unsere Verhältnisse passen zueinander – es wird Zeit, dass ich mit deinem Vater sprech‘!“
„Ich hab Angst“, flüsterte sie und barg ihr Gesicht an seiner Brust.
„Angst, wovor?“, lachte er zärtlich mit der Kraft der Glücklichen, die noch nie enttäuscht wurden. „Es ist schon alles richtig mit uns zwei. Und du weißt, meine Mutter wartet auf eine Schwiegertochter!“
Ja, sie wusste es! Sie wusste aber auch, dass der Vater sie nicht gehen lassen würde. Aber in einem Winkel ihres Herzens hoffte sie doch, dass etwas von ihrem Glück übrigbleiben möge. Es war eine törichte Hoffnung. Sie hätte niemals mit Loisl reden, niemals zu ihm in den Wald gehen sollen; aber sie war doch ein junger Mensch – jung und voller Sehnsucht.
Am nächsten Tag sagte die Bäuerin vom Windegger-Hof zu ihrem Sohn: „Hast du schon mit der Marei gesprochen, Bub? Wann willst du endlich zum Schranz-Bauern gehn und um ihre Hand anhalten? Mir wird die Arbeit wirklich zu viel.“
„Ja, ich werd‘ gehn, Mutterl“, nickte der Loisl. „Die Marei ist einverstanden, nur hat sie Angst.“
„Angst? Wovor? Das versteh‘ ich net.“
Aus scharfen, dunklen Augen musterte die Windeggerin ihren Sohn.
„G‘wiss davor, dass der Schranz-Bauer sie net gehn lässt! Die Marei vertritt doch auf dem Hof die Mutter und Hausfrau. Da möcht‘ er sie net gern hergeben.“
Loisl setzte sich an den Tisch und begann zu essen.
„Er verliert eine gute Hausfrau, und du kriegst eine gute, das ist der Welt Lauf“, sagte die Bäuerin und setzte sich ebenfalls. „Er wird ja wissen, dass er die Marei net für immer auf dem Hof festhalten kann. Dann muss er sich halt eine Haushälterin suchen.“
„Du kennst die Marei net“, murmelte der Loisl. „Die nimmt ihre Aufgabe sehr ernst. Schließlich hat sie‘s der Mutter auf dem Sterbebett versprochen, sich um die kleineren Geschwister zu kümmern. Und der Jüngste, der Gustl, ist ja erst sieben!“
„Das Madel ist zuverlässig, das gefällt mir! Aber sie hat auch ein Recht auf ein eigenes Leben“, wandte die Windeggerin ein. „Das Beste ist, du gehst gleich heut‘ Nachmittag und redest mit dem Schranz-Bauern.“
„Heut‘ schon?“
Der Loisl sah erschrocken auf. „Mutter, das wird der Marei net recht sein! Sie muss ihn erst ein bissel vorbereiten.“
„Glaubst du, der Schranz-Bauer ist blind? Der wird längst was gemerkt haben. Nein, heut‘ Nachmittag, sag ich! Wir wollen ihm keine Gelegenheit geben, sich was auszudenken, mit dem er sich rausreden kann!“
„Hm!“
Loisl wusste, dass es keinen Zweck hatte, seiner Mutter zu widersprechen.
„Also denn“, seufzte er gottergeben und aß stumm weiter. Er gehörte dem Temperament nach zu den Menschen, die alles auf die lange Bank schieben.
Die Marei erschrak nicht schlecht, als sie ihn am Nachmittag kommen sah. Er trug seinen guten Anzug, und das konnte nur eines bedeuten: Er wollte bei dem Vater um ihre Hand anhalten!
Sie ging ihm im Hausflur entgegen.
Ihr kleines, zartes Gesicht war blass.
„Ja, es muss endlich Klarheit herrschen!“, behauptete der Loisl mit einer Entschlossenheit, die zum größten Teil auf das Konto seiner Mutter kam. „Sag deinem Vater, dass ich da bin.“
Und ganz schnell streichelte er mit dem Handrücken ihre Wange, um sie ein bissel zu beruhigen.
Die Marei ging zum Vater in die Schreibstube. Dort saß der Bauer am Tisch und rechnete, wie meist, wenn er sich in diesem Raum aufhielt.
„Vater, es ist jemand draußen, der dich sprechen möcht“‘, sagte die Marei hinter seinem Rücken.
Langsam, ganz langsam drehte er sich um und maß sie mit einem misstrauischen Blick. Seine Lippen waren verkniffen wie immer, die Mundwinkel mürrisch gesenkt.
„Wer ist‘s?“, wollte er wissen.
„Der Windegger-Loisl ist‘s, der Besitzer vom Windegger-Hof aus Feldenwang“, teilte sie ihm mit, und es gelang ihr, den zitternden Klang der Stimme zu verbergen.
„Hm. Was will er denn? Weißt du, was er von uns will?“
Immer noch dieser misstrauische Blick! Aber das hatte nichts zu bedeuten, denn seit der Toni sich mit dem Vater überworfen und das Haus verlassen hatte, sah der Schranz-Bauer alle Menschen so an.
Angesichts dieses grauen, zerfurchten Antlitzes voll geheimer Qual und Einsamkeit, dieser trübseligen Lippen und dieser misstrauischen Augen verlor sie allen Mut.
„Nein“, stotterte sie, „das – das muss er dir halt selber sagen, Vater!“
Das war nicht ganz und gar gelogen. Und wie der Wind war sie draußen.
Der Schranz-Bauer starrte ihr nach. Sie wird doch net …, dachte er.
Bisher war er wirklich blind gewesen. Und jetzt stand der Loisl auf der Türschwelle.
Alles, was der Bauer nicht war, das war er: jung, zuversichtlich, vertrauensvoll und lebensfroh! Er ging mit seiner einzigen Waffe, die er hatte, in den ungleichen Kampf: mit seiner ehrlichen Liebe zu der Marei!
„Grüß Gott, Schranz-Bauer!“, sagte er und neigte den dunklen Kopf. „Hast ein bissel Zeit für mich?“
„Das kommt drauf an“, antwortete der Alte vorsichtig. „Du bist der Windegger-Loisl aus Feldenwang? Deinen Vater hab ich gut gekannt. Aber er ist ja schon lang tot!“
Er hing seinen Gedanken nach.
Der Loisl stand noch immer mitten im Zimmer, da ihm der Bauer keinen Platz angeboten hatte.
„Ja“, sagte er, „Vater ist seit zwölf Jahren tot. Ich war ein Bub von elf Jahren, als er starb. Aber Mutter ist auch schon alt und krank. Es wird ihr zu viel mit der Wirtschaft, denn alle anderen sind schon aus dem Haus.“
„Bei euch erbt der Jüngste?“, fragte der Schranz-Bauer.
„Ja, der Jüngste! Und das bin ich. Und ich muss jetzt daran denken“, steuerte er auf sein Ziel zu, „dass eine junge Frau auf den Hof kommt.“
„Aha“, brummte der Bauer grimmig, „und die suchst wohl hier, wie?“
Das ärgerte den Loisl ein wenig, aber er beherrschte sich.
„Warum net auf dem Schranz-Hof?“, gab er zurück. „Die Leut‘ vom Schranz-Hof sind eine angesehene Familie. Man kann stolz darauf sein, wenn man eine von ihnen zur Frau kriegt.“
Aber diese lobenden Worte hatten nicht die gewünschte Wirkung.
„Und ihr Geld dazu!“, lachte der Bauer boshaft. „Eine Schranz kriegt eine anständige Mitgift.“
„Die braucht der Windegger-Hof net!“, sagte der Loisl und richtete sich hoch auf. „Wir kommen gut zurecht und sind net arm, obwohl alle Geschwister ausgezahlt sind. Wir brauchen eine junge gesunde Frau auf dem Hof.“
Wir – damit meinte er sich selbst und seine Mutter.
„Und das soll wohl meine Marei werden, net wahr?“
Der Alte drängte den jungen Bauern in die Verteidigung.
„Du hast also ein Gspusi mit meiner Marei? Kruzitürken, diese G‘schichten passen mir net, ganz und gar net!“
Er wurde schon ziemlich laut.
Jessas, dachte der Loisl, mit dem Bauern vom Schranz-Hof ist net gut Kirschen essen! Und laut sagte er: „Die Marei und ich, wir haben uns gern. Da ist doch nix Unrechtes dabei!“
„Das will ich hoffen!“, schrie der Alte und hieb mit der Faust, die die Pfeife umklammert hielt, auf die Stuhllehne.
„Solche Heimlichkeiten gehören sich net! Wie lang geht das schon hinter meinem Rücken?“
„Du bist ungerecht, Bauer!“, verteidigte sich Loisl ruhig. „Dein Madel solltest kennen – die tut nix Unrechtes. Ich sag dir ja, wir haben uns gern und wollen heiraten.“
„Ha, heiraten! Was Besseres fällt dir wohl net ein?“
Dann stand der Bauer auf und wanderte aufgeregt in der Stube auf und ab. Die alten Dielen knarrten unter seinen Schritten. Sein Gesicht zuckte nervös.
„Ich glaub net, dass es was Besseres gibt“, entgegnete der Loisl. „Wenn alles in Ehren seinen Gang gehen soll, dann muss man wohl heiraten!“
Er stand noch immer mitten in der Stube und wusste nicht recht, wohin er schauen sollte. Es war doch sehr viel schwieriger, mit dem Schranz-Bauern zu reden, als er es sich vorgestellt hatte. Und zu einer richtigen Brautwerbung war er bei diesem wütenden Alten noch gar nicht gekommen.
„Und ich sag dir, es wird net geheiratet!“, donnerte Anton Schranz, dass die Marei draußen im Flur zusammenzuckte. Sie konnte jedes Wort verstehen und litt um Loisls willen bittere Qualen.
„Du kriegst meine Tochter net, keiner kriegt sie, denn ihr Platz ist auf dem Hof! Sie führt die Wirtschaft, erzieht die Buben! Glaubst du, ich lass mir meine Tochter von irgendeinem wegholen? – Keiner kriegt sie! Basta!“
Er stampfte zur Bekräftigung mit dem Fuß auf.
„Schranz-Bauer“, widersprach der Loisl jetzt schon weniger ruhig, „ich kann ja verstehen, was das Madel für den Hof bedeutet, aber sie hat ein Recht auf ein eigenes Leben! Für deinen Hof kannst eine Haushälterin bekommen. Die Marei ist erwachsen, braucht einen Mann, Kinder und ein eigenes Heim.“
Der Alte kam ganz dicht an den Loisl heran und sah ihm höhnisch in die treuherzigen Augen.
„So, erwachsen ist sie? Erst wenn sie großjährig ist, kann sie tun, was sie will! Aber so lang bleibt sie auf dem Hof! Hast verstanden?“
„Schranz-Bauer, du gehst zu weit!“
In Loisls Stimme bebte mühsam zurückgehaltene Erregung. So etwas war ihm noch nie passiert, und er hatte es wirklich nicht verdient.
„Das ist dein Jähzorn, von dem die ganze Gegend spricht! Beruhig‘ dich und lass uns als Männer über die Sach‘ sprechen!“
„Als Männer!“, keifte der Alte los. „Du Grünschnabel nennst dich einen Mann! Geh zurück nach Feldenwang! Hier hast du nix zu suchen. Meine Tochter kriegst du net. Das ist mein letztes Wort.“
„Das ist zu viel!“, schrie der Loisl, rot vor Zorn im Gesicht. „Ich bin anständig gekommen, und du schickst mich fort wie einen Hund! Wenn du net der Vater von der Marei wärest …“
„Was dann? Willst du mir drohen? Einen feinen Burschen hat sich meine Tochter da ausgesucht!“
Da ging die Tür auf. Mit kalkweißem Gesicht stand die Marei auf der Schwelle.
„Vater!“
„Was willst du?“
Er machte eine zornige Handbewegung, kehrte sich ab, warf die ausgebrannte Pfeife auf den Tisch und bohrte die Hände in die Hosentasche.
„Vater, das nimmst zurück! Der Loisl ist ein anständiger Mensch!“
Ihre Zähne schlugen aufeinander vor Erregung.
„Ich nahm‘ nix zurück!“
Störrisch bäumte sich sein Nacken. Er sagte warnend: „Denk‘ an den Toni! Denk‘ meinetwegen, was du willst!“
Dann trat er ans Fenster, sah hinaus und kehrte den beiden den Rücken.
Die Marei hatte die Tür hinter sich geschlossen und trat an Loisls Seite. Sie standen nun beide mitten im Raum. Das Madel sah klein und zerbrechlich neben dem breitschultrigen jungen Mann aus.
„Vater“, sagte die Marei leise und tapfer, „ich hab den Loisl gern. Ich möcht‘ seine Frau werden. Ist dir das ganz gleichgültig?“
„Gleichgültig? Mein Gott!“
Er fuhr mit den Schultern herum, ohne sich vom Fenster zu rühren, und sah sie an.
„Es muss mir gleichgültig sein, Madel. Der Hof braucht dich, und ich kann‘s net zulassen, dass du davonläufst. Hast du vergessen, was du mir versprochen hast?“
„Nein!“
Ganz leise kam es. Sie senkte das Kinn auf die Brust.
Der Bauer fühlte sofort, dass er Oberwasser hatte. Langsam kam er auf sie zu und blieb vor ihr stehen, den jungen Mann gar nicht beachtend.
„Marei, Madel! Die Buben brauchen dich! Wenn sie nix Rechtes werden, so wird‘s deine Schuld sein! Bedenke, was du der Mutter versprochen hast – auf ihrem Sterbebett! Und jetzt willst du eines Burschen wegen deinen Posten verlassen! Was soll denn aus uns werden?“
„Ich weiß net, Vater“, schluchzte sie auf und schlug die Hände vor das Gesicht, um seine bohrenden Blicke nicht sehen zu müssen.
„Du weißt‘s net, aber ich weiß es. Ich kann‘s dir genau sagen. Gustl und Xaver werden verwildern. Es wird niemand mehr da sein, der das Gute in ihnen pflegt und der sie beten lehrt. Und wenn sie krank sind, wer wacht an ihren Betten? Und eine fremde Frau wird die Schlüssel vom Schranz-Hof in Händen halten und Gut und Geld verschleudern, dessen bin ich sicher. Und zu mir kommt eine Fremde und bringt mir das Essen und nimmt mir die letzte Freud‘, die ich hab, die Freud‘ an meiner Tochter.“
Der Loisl biss sich auf die Lippen und sah Marei an, die Ströme von Tränen weinte. Bei ihr lag jetzt die Entscheidung.
„Ich kann net“, flüsterte das junge Madel zitternd und schluchzend, „ich kann net fort von euch! Der Mutter hab ich‘s versprochen, dir hab ich mein Wort gegeben, das ist alles wahr. Nie hätt‘ ich mich mit Loisl treffen dürfen!“
Der junge Bauer sah sein Lebensglück dahinschwinden. Er umfasste sanft ihre Hände.
„Sprich net so, Marei! Du hast mich doch lieb! Das ist doch nix Schlechtes, sondern was Natürliches.“
„Verzeih mir!“, stöhnte sie. „Verzeih mir alles, aber ich gehör‘ hierher! Ich hab‘s immer gewusst, ich bin nur mal schwach geworden.“
„Du gibst mich auf?“
Seine Hände fielen herab. Er starrte sie entsetzt an.
„Ich muss hierbleiben“, nickte sie und blickte unverwandt auf die Dielen herab.
Um die schmalen Lippen des Alten zuckte der Triumph.
„Also, Windegger-Loisl, was haben wir uns noch zu sagen?“
„Nix!“, sagte der junge Bauer, drehte sich auf dem Absatz um und ging mit harten Schritten zur Tür.
Ein „Grüß Gott“ brachte er nicht zustande. Er riss die Tür mit wildem Griff auf und warf sie hinter sich ins Schloss.
Im Flur verklangen seine raschen Schritte.
Marei stand schluchzend mitten in der Stube und lauschte ihnen nach.
8
Sommer war‘s auf dem Land.
Der Windegger-Loisl arbeitete mit verbissener Energie. Erstens war Arbeit immer gut, sie schaffte etwas und gewährte Befriedigung, und zweitens schenkte sie eine ungeheure Müdigkeit und ein Vergessen, das er suchte.
Alle Mägde waren draußen beim Dreschen. Die Bäuerin musste mit dem Kochen allein fertig werden. Und jetzt fehlte ihr Milch für die Suppe, die sie nun selbst aus dem Stall holen musste. Eine von den Kühen war im Stall geblieben, alle anderen blieben über Nacht draußen.
Die alte Frau eilte in den Stall. Doch die schwarz-weiße Kuh war von der Hitze, dem Staub und dem Angebundensein gereizt. Sie trat aus und traf die Bäuerin. Die alte Frau fiel ins Stroh.
Die Greisin versuchte sich aufzuraffen. Es wollte nicht gehen. Etwas in der linken Seite stach furchtbar. Sich durch Schreien bemerkbar zu machen, hatte keinen Zweck, denn bei dem Höllenlärm der Maschine hörte sie doch niemand.
Nun brennt noch das Essen an!, dachte sie bekümmert.
Es dauerte lange, bis man ihr Fehlen in der Küche bemerkte. Der Loisl selbst war es, der etwas trinken wollte und die Küche leer fand.
„Mutter?“
Aber sie war nicht da. Die Tür zum Stall stand offen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2022
- ISBN (ePUB)
- 9783738966374
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (Oktober)
- Schlagworte
- bergliebe heimatroman doppelband