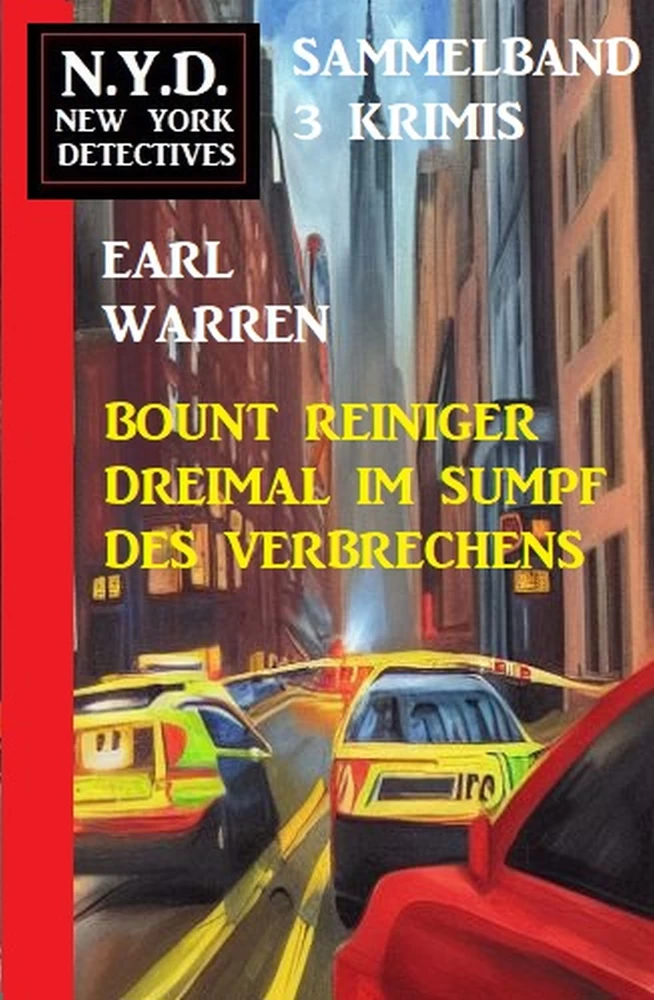Zusammenfassung
In der Rechten hielt der Bursche ein Kampfmesser mit geschliffener Klinge und Sägezacken an der Rückseite. Bount stand waffenlos in dem Lagerhaus vor ihm und hielt die Hände im Genick verschränkt, wie man es ihm befohlen hatte. Rechts und links hinter sich wusste er je einen bewaffneten Schlagetot.
Der Gangster links hielt einen klobigen Revolver. Der Mann grinste stereotyp. Sein Komplize rechts hinter Bount hatte eine 16schüssige Beretta. Er kaute Chewinggum und sah manchmal nervös auf die Uhr, als sei er in dieser Nacht noch verabredet – vielleicht zu einem Stelldichein. Er wollte Bount möglichst schnell beseitigt haben. »Mach schon, Mac«, sagte er ...
Der Weißblonde wandte sich ihm zu.
»Klappe! Noch ein Wort, und du liegst neben ihm. Stör mich nicht. Nun, Bount Reiniger, haben Sie mir noch etwas zu sagen? Vielleicht kann ich es der Nachwelt überliefern. Letzte Worte berühmter Männer sind immer gefragt.«
Nichts als Hohn klang aus diesen Worten. Bount behielt die Nerven. Es galt, Zeit zu gewinnen. Zeit, um sich eine Möglichkeit zu überlegen, doch noch der tödlichen Falle zu entrinnen.
Dieser Band enthält folgende Krimis
von Earl Warren:
Bount Reiniger und die Killer in Kanada
Bount Reiniger oder Töte keine Porno-Queen
Bount Reiniger oder Keine Leiche, keine Mörder
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Bount Reiniger dreimal im Sumpf des Verbrechens: N.Y.D. New York Detectives Sammelband 3 Krimis
Earl Warren
»Leider sehe ich mich gezwungen, Sie zu killen, Mister Reiniger.« Der Gangster in Jeans und Turnschuhen tänzelte auf Bount zu. Er trug ein T-Shirt, das sich über einem muskulösen Oberkörper spannte, und, hatte weißblondes, kurz geschnittenes Haar und glasblaue Augen. Seine Pupillen waren verengt, der Blick starr wie der eines Süchtigen nach einer hohen Dosis.
In der Rechten hielt der Bursche ein Kampfmesser mit geschliffener Klinge und Sägezacken an der Rückseite. Bount stand waffenlos in dem Lagerhaus vor ihm und hielt die Hände im Genick verschränkt, wie man es ihm befohlen hatte. Rechts und links hinter sich wusste er je einen bewaffneten Schlagetot.
Der Gangster links hielt einen klobigen Revolver. Der Mann grinste stereotyp. Sein Komplize rechts hinter Bount hatte eine 16schüssige Beretta. Er kaute Chewinggum und sah manchmal nervös auf die Uhr, als sei er in dieser Nacht noch verabredet – vielleicht zu einem Stelldichein. Er wollte Bount möglichst schnell beseitigt haben. »Mach schon, Mac«, sagte er ...
Der Weißblonde wandte sich ihm zu.
»Klappe! Noch ein Wort, und du liegst neben ihm. Stör mich nicht. Nun, Bount Reiniger, haben Sie mir noch etwas zu sagen? Vielleicht kann ich es der Nachwelt überliefern. Letzte Worte berühmter Männer sind immer gefragt.«
Nichts als Hohn klang aus diesen Worten. Bount behielt die Nerven. Es galt, Zeit zu gewinnen. Zeit, um sich eine Möglichkeit zu überlegen, doch noch der tödlichen Falle zu entrinnen.
Dieser Band enthält folgende Krimis
von Earl Warren:
Bount Reiniger und die Killer in Kanada
Bount Reiniger oder Töte keine Porno-Queen
Bount Reiniger oder Keine Leiche, keine Mörder
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
COVER: A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
Bount Reiniger und die Killer in Kanada
Bount Reiniger liegt auf der Intensivstation – doch seine Genesung steht in Frage
von Earl Warren
1.
»Mister Reiniger«, sagte der Chairman von Science & Technical Incorporated, »Im Namen meines Konzerns weise ich strikt zurück, dass es bei uns irgendwelche Unregelmäßigkeiten geben könnte. Wir haben alles im Griff. Sie können gleich wieder nach New York City zurückfliegen.«
In dem Moment flog die Tür des Konferenzzimmers in der Innenstadt von Montreal auf. Mit Schaum vor dem Mund stürmte ein dickköpfiger Mann in weißem Kittel herein. Er schleppte zwei Konzernguards, die sich an ihn klammerten, regelrecht mit. Es waren schwergewichtige, handfeste Männer. Der Kahlköpfige entwickelte eine Riesenkraft.
»Doktor Addams!«, rief der Chairman und erhob sich am runden Tisch. »Was ist in Sie gefahren? – Mein Gott!«
Addams, ein Wissenschaftler, gab tierische Laute von sich. Er schüttelte die beiden Guards ab. Wie Äpfel von einem Ast flogen sie gegen die Wand, dass es krachte. Dr. Addams aber raste wie von einem Katapult abgeschossen, die Hände gekrümmt zum Würgen vorgestreckt, auf den schmächtigen Chairman im Nadelstreifenanzug los.
Die Damen und die zwei Herren, die mit Bount und dem Chairman am runden Tisch saßen, flüchteten. Sie hatten zu den Ausführungen des Firmensprechers und Aufsichtsratsvorsitzenden brav mit dem Kopf genickt. Jetzt verging ihnen das Kopfnicken.
Bount federte hoch und knallte dem anstürmenden Dr. Addams die Faust voll auf den Punkt. Der Privatdetektiv führte den Schlag mit aller Härte und legte sein ganzes Gewicht hinein. Er hätte selbst den Boxweltmeister für lange Zeit auf die Bretter geschickt.
Dr. Addams schüttelte bloß den Kopf, fegte Bount zur Seite und schnappte sich den Chairman. Der schrie gellend um Hilfe, bis seine Schreie in einem Gurgeln erstarben.
Bount musste rasch handeln, sonst brach der Rasende dem Firmensprecher das Genick oder zerdrückte ihm die Gurgel. Bount säbelte Addams, der auf dem Chairman Antoine du Martier kniete, die Handkante ins Genick. Der Wahnsinnige spürte den Schlag überhaupt nicht. Er war total schmerzunempfindlich, seine Nervenleitbahnen blockiert.
Die Guards zogen ihre Pistolen.
»Nicht schießen!«, schrie Bount, packte einen Konferenzsessel und warf ihn mit voller Wucht gegen Dr. Addams.
Der Sessel fegte den verrückt gewordenen Wissenschaftler von seinem Opfer weg, das unter den Tisch kroch. Addams sprang auf und stürzte sich auf die Guards. Sie zögerten, abzudrücken. Immerhin hatte der Angreifer keine Waffe und war als führender Wissenschaftler aus den STI-Labors – STI lautete das Kürzel für den Konzern – bisher noch nie negativ aufgefallen.
Einen Akademiker und Spitzenwissenschaftler erschoss man nicht einfach wie einen tollen Hund. Der Rasende nutzte die Chance. Ehe Bount es verhindern konnte, entriss er dem einen uniformierten Guard die Beretta und schoss den Entwaffneten nieder. Jetzt hatte der zweite Konzern-Sicherheitsdienstler keine Wahl mehr.
Für ihn hieß es schießen oder erschossen zu werden.
Er feuerte.
Dr. Addams zuckte zusammen. Blut strömte ihm übers Gesicht. Abrupt brach er zusammen, zuckte noch einmal und blieb in verkrümmter Haltung liegen.
Pulverdampf zog durch das Konferenzzimmer, in dem jetzt nur noch das Schluchzen der einen Minikonferenzteilnehmerin zu hören war. Der Chairman rieb sich ächzend den Hals. Die beiden anderen Männer aus der oberen Geschäftsetage verhielten sich ruhig.
»Ich konnte nicht anders«, sagte der Guard, der die rauchende Pistole in der Hand hielt. »Er hat William erschossen. Er hätte auch mich abgeknallt. – Mein Gott, dabei war Doktor Addams immer ein so umgänglicher, freundlicher Mann. Er muss verrückt geworden sein.«
»Oder er ist mit Drogen voll gepumpt, die ihn in einen Amokläufer verwandelten«, sagte Bount. Er fühlte Dr. Addams und dem von ihm niedergeschossenen Guard den Puls. »Tot, alle beide.« Bount wandte sich an den Chairman. »Nun, Mister Martier, glauben Sie immer noch. dass Sie in Ihrem Konzern kein Problem und alles im Griff haben?«
Antoine du Martier blieb Bount die Antwort schuldig. Eins der drei Telefone am Tisch – reine Schau, eins hätte genügt – klingelte anhaltend. Martiers Assistent nahm ab und meldete sich. Ungehalten fragte er, was denn los sei. Hier wäre eine Katastrophe geschehen und auch wichtige Geschäftsnachrichten müssten jetzt warten Der Assistent erbleichte. »Die nächste Katastrophe bahnt sich bereits an!«, stieß er hervor. »Melly Purcell, Doktor Addams' engste Mitarbeiterin, steht auf dem Dach und will sich hinunterstürzen. Sie ist von Sinnen. Sie behauptet, sie wäre ein Schmetterling.«
»Auf welchem Dach ist sie?«, fragte Bount. »Ich muss sofort hin. – Verständigen Sie die Mordkommission. Hier bleibt alles unverändert. Ruft einen Arzt für Mister du Martier. Sein Hals scheint verletzt zu sein.«
Der Chairman konnte nicht sprechen. Der Assistent, ein schon fast zu smarter junger Mann, erklärte Bount, wie er aufs Dach konnte. Bount Reiniger fegte los. Er befand sich im 38. Stock des STI-Buildings an der Place Bonaventure. Es handelte sich um einen Wolkenkratzer, der sich nach oben hin verjüngte und mit Aluplatten verkleidet war. Sie gaben ihm sein charakteristisches Aussehen.
Bount rannte die Treppe hoch. Für die restlichen vier Stockwerke lohnte es nicht, auf einen Lift zu warten. Der Privatdetektiv drängte sich durch einen am Aufstieg zum Dach wartende Gruppe von Managern und Sekretärinnen, die aufgeregt durcheinander redeten.
Er stieg die schmale Treppe hoch, sagte mehrmals »Pardon« und gelangte aufs Dach.
Es war eiskalt draußen. In Montreal herrschte sechs Monate Winter mit grimmigem Frost. Schnee bedeckte das flache oberste Dach mit den Plexiglaskuppeln, die für Lichteinfall sorgten, und den Aufbauten für Liftmaschinen und Klima- und Sprinkleranlage. Eine hohe Funk- und Parabolantenne ragten am Dach auf.
Eisiger Wind pfiff über den zugefrorenen breiten St.-Lawrence-Strom.
Montreal mit seinen 2,9 Millionen Einwohnern – mit Vororten und allem Drum und Dran – war hauptsächlich auf einer Flussinsel erbaut, mit einer Wolkenkratzer-Skyline, die bizarr aus der wie von Eisringen geschaffenen Winterlandschaft ragte.
Mehrere dick vermummte Männer und Frauen standen am Dach, geduckt gegen den Wind gestemmt. Oder sie hielten sich fest oder gaben sich gegenseitig Halt.
Der eisige Wind – die Temperatur betrug hier oben fünfzehn Grad unter Null – schnitt durch Bounts Lederjacke. Jemand reichte ihm einen Pelzmantel, in den er hineinschlüpfte. Der Privatdetektiv zog die Kapuze über und band die Schnüre zusammen.
Der Wind blies Schneeflocken und Eisgraupel übers Dach. Bount Reiniger zog die Handschuhe aus den Manteltaschen und streifte sie über.
Eine blonde junge Frau im orangefarbenen, innen mit Pelz gefütterten Parka stand am Dachrand in einer Haltung wie beim Ballett. Ihr Körper war in der Schräge. Sie stand auf einem Bein. Das andere war gestreckt, die Arme nach vorn gereckt.
Zerbrechlich und graziös zugleich sah die Brünette aus. Sie spürte die Kälte nicht, obwohl ihr Gesicht ungeschützt dem Frost ausgesetzt war. Sie lauschte auf eine Musik, die nur sie hörte, und sah Dinge, die außer ihr niemand wahrnehmen konnte.
Ein älterer Mann mit randloser Brille war ihr am nächsten. Er streckte die behandschuhte Rechte aus und redete beschwörend auf die Brünette ein.
»Melly, bitte, gehen Sie da weg! Kommen Sie zu mir. Ich meine es gut mit Ihnen. Lassen Sie uns hinunter ins Haus gehen. Hier oben ist es viel zu kalt für uns alle.«
Der Wind wurde zum heulenden, fauchenden Sturm. 42 Stockwerke bedeuteten eine Höhe von gut 150 Metern. Es war ein Wahnsinn, bei dem Wetter aufs Dach des Wolkenkratzers zu steigen und sich der eisigen Kälte auszusetzen.
»Melly!«, rief der ältere Mann wieder.
Der Wind riss ihm die Worte vom Mund. Die junge Frau hätte sie ohnehin nicht verstanden. Der ältere Mann näherte sich ihr zwei Schritte mehr.
»Melly, ich bitte dich, ich, dein Vater! Nimm Vernunft an! Bitte, komm zu mir! Nimm meine Hand!«
Ein untersetzter, kräftiger Mann schob sich an Bount Reiniger vorbei. Melly Purcell bog sich zur Seite, als ihr Vater, der um sie Todesängste ausstand, sich ihr noch mehr näherte. Er war noch sechs Schritte von der hübschen Brünetten entfernt. Er wich wieder zurück. Der untersetzte Mann zischte: »Reden Sie weiter mit ihr, Sir! Lenken Sie sie ab. Ich will versuchen, sie von hinten zu packen und von der Dachkante wegzureißen.«
»Ja«, sagte Winfred Purcell, der Forschungsleiter von STI.
Er redete weiter auf seine Tochter ein. Der Untersetzte schlug einen Bogen, um aus ihrem Blickfeld zu gelangen. Bount Reiniger schloss sich ihm an. Die übrigen Menschen am Dach bibberten trotz ihrer dicken Kleidung und schauten gespannt und entsetzt zu, was geschah.
»Wer sind Sie, was wollen Sie?«, fragte der untersetzte Mann Bount. Er trug einen orangefarbenen Parka und die Uniformhose sowie Stiefel eines Mitglieds der STI-Security Guard.
»Bount Reiniger, der Privatdetektiv, den der US-Pharmaverband geschickt hat.«
»Ach, der. Wir müssen die Kleine packen. – Jetzt!«
Bount und der Untersetzte sprangen vor. Im gleichen Moment drehte Melly Purcell eine Pirouette und wandte sich ihnen zu. Die Männer fassten nach ihr. Melly lachte silberhell.
»Ich bin ein Schmetterling!«, rief sie auf Französisch. »Keiner rührt einen Schmetterling an!«
Sie tanzte vor Bount und dem Untersetzten weg, entglitt ihnen biegsam und gewandt wie der Fisch den zupackenden Händen des Fängers. Melly wich aus, schnell und geschmeidig. Sie tanzte ein Todesballett in über 150 Meter Höhe.
Bount und der Untersetzte schauten sich an. Professor Purcell rief beschwörend:
»Geht weg da! Bringt sie nicht in Panik! Sie ist high oder in Trance. Wenn sie einen klaren Moment hat und ihre Lage erkennt, stürzt sie vor lauter Schreck todsicher in den Abgrund!«
Im Augenblick bewegte sich Melly Purcell, die von der Gefahr nichts wusste, sicher wie auf einem breiten, bequemen Boulevard.
Bount und der Untersetzte hielten inne. Sie lauerten auf ihre Chance. Doch momentan war es verkehrt, sich zu bewegen.
Melly tanzte im Schneegestöber und heulendem Sturm. Sie war zweifellos eine trainierte Ballerina, was ihr Hobby und Ausgleichssport sein mochte. Sie tanzte in ihren Turnschuhen auf der Spitze, die Hände über den Kopf erhoben.
Ein Ausdruck überirdischer Glückseligkeit zeichnete ihr Gesicht.
Dann knickte sie plötzlich ein, verlor den Halt und stürzte ab. Bount sprang vor, griff zu, streifte aber nur noch Melly Purcells eiskalte Finger. Nie würde er ihren Blick vergessen. Nie den entsetzten, klagenden Aufschrei ihres Vaters und den der übrigen Zuschauer.
Wie ein Vogel mit gebrochenen Schwingen stürzte Melly vom Dach des Wolkenkratzers und schlug auf den Sockel eines der an vier Seiten an den obersten Stockwerken hochgezogenen sich verjüngenden Aufbaus. Ihr Körper wurde von der Wucht des Aufpralls hochgeschleudert und stürzte weiter, schlug gegen die Betonmauer und fiel in die Tiefe.
Melly gab keinen Laut von sich. Als Bount sich auf alle viere niederließ und über die Dachkante schaute, sah er sie unten liegen.
Aus der Höhe sah die junge Frau puppenhaft klein aus. Auf dem Dach schwiegen alle. Nur der Wind heulte und pfiff.
Dann fiel Professor Winfred Purcell auf die Knie, reckte die Fäuste gen Himmel und schrie mit schrecklichem Schmerz in der Stimme: »Mellyyyyyyy!«
Der STI-Forschungsleiter konnte noch nicht fassen, was er gerade miterlebt hatte. Melly, sein einziges Kind, die nie Drogen genommen hatte oder anderweitig aufgefallen wäre, hatte sich gerade vor seinen Augen, scheinbar sinnlos und ohne Grund, zu Tode gestürzt.
*
Jetzt wollte keiner mehr Bount Reiniger nach Hause schicken. Drei Tote innerhalb weniger Minuten – Dr. Addams, seine Assistentin, die Pharmatechnikerin Melly Purcell, und ein Wachmann – waren der klare Beweis, dass hier etwas nicht stimmte. Im STI-Building ruhte die Arbeit. Die Mordkommission traf ein, angeführt von einem hageren Captain, der wortkarg und Frankokanadier war.
Er unterhielt sich mit seinem Untergebenen in Joual, der Umgangssprache oder dem Arbeiterdialekt. Mit diesem kanadischen Französisch der Provinz Quebec hatte Bount, der an sich Französisch konnte, Schwierigkeiten. Es hatte sich aus dem 17. Jahrhundert gesprochenen Französisch entwickelt und war kräftig vom US-amerikanischen Nachbarn beeinflusst. Zudem kamen eigene Wortschöpfungen hinzu. Zahlreiche Wörter hatten auch eine andere Bedeutung als im Französischen, wie es die Franzosen sprachen.
Doch da in Kanada offiziell zwei Sprachen gesprochen wurden. Englisch und Französisch, klappte für Bount die Verständigung an sich. Die meisten sprachen sowieso Englisch, und wenn es radebrechend war oder nur ein paar Brocken. Und sollte wirklich mal einer nur Joual beherrschen, ließ sich ein Dolmetscher finden oder mit Händen und Füßen reden.
Der wortkarge Captain ließ die Spurensicherung vornehmen und verhörte alle, die zu den Todesfällen einen Bezug hatten. Die Vernehmungen führten der Leiter der Mordkommission Montreal I und seine Mitarbeiter durch. Bount Reiniger musste den Beamten genauso Rede und Antwort stehen wie andere vom STI-Konzern.
Der Captain hörte mit mäßigem Interesse, dass Bount Reiniger seine Hilfe bei der Aufklärung der Todesfälle anbot. Die Leichen wurden abtransportiert, nachdem der Polizeifotograf seine Aufnahmen geschossen hatte.
In einem Konferenzzimmer erklärte Bount dem Leiter der Mordkommission, was ihn nach Montreal geführt hatte. Bount Reiniger war am späten Vormittag, mit der Frühmaschine aus New York kommend, auf dem Montreal International Airport gelandet und im Hotel »Ritz Carlton« in der eleganten Sherbrooke Street mit ihren Nobelgeschäften und Restaurants abgestiegen. Unverzüglich war Bount dann im Taxi zum STI-Building gefahren, wo er schon angekündigt war.
»Der US-Pharmaverband schickt Sie also«, sagte der Captain in jetzt gehobenerem Französisch.
Eine Dolmetscherin übersetzte zwischen ihm und Bount Reiniger. Captain Leclerc gehörte zu den wenigen Quebecern – die Provinz, in der sich Montreal befand, war Quebec – in höheren Positionen, die kein Englisch konnten.
Das sprach für seine Tüchtigkeit. Andernfalls hätte er es mit seinem Sprachmanko nicht zum Leiter der Mordkommission gebracht.
»Wozu sind Sie nach Kanada gesandt worden?«, wollte der Captain weiter wissen.
»Wegen der neuen Drogengeneration, den Designer-Drogen, von denen Sie bestimmt gehört haben, Captain«, antwortete Bount. Es handelte sich dabei um ausschließlich künstliche Drogen, die in der Herstellung billig und in der Wirkung variabel waren. »In den USA tauchen immer größere Mengen am Markt auf. Ein harter Konkurrenzkampf ist um die Absatzmärkte entbrannt. Mitgliedsfirmen des US-Pharmaverbands gerieten in den Verdacht, Rohstoffe für die Herstellung von Ecstasy und anderen Drogen zu liefern. Es gibt jedoch Hinweise, dass die Grundsubstanzen aus Kanada kommen.«
»Ach«, sagte der Captain. »Bei uns in Montreal ist das Drogenproblem wesentlich geringer als zum Beispiel in New York City.«
Bount glaubte das nicht, wollte mit dem Captain jedoch nicht über den Punkt diskutieren. Drogensüchtige gab es mittlerweile in jeder Großstadt der westlichen Hemisphäre in größerer Anzahl.
»Das mag sein, wie es will«, entgegnete Bount Reiniger. »Wegen der einschneidenden Maßnahmen der US-Fahndungsbehörden lassen die Drogengangster sich immer neue Tricks einfallen, wie sie ihr Teufelszeug möglichst unverfänglich herstellen und lagern können. Eine der neuesten und die derzeit beste Methode ist die Verwendung von Grundsubstanzen, die für sich allein unverdächtig sind. Die Grundsubstanzen werden in Labors mit aufwendigen und hochtechnisierten Mitteln verändert. Aus einfachen Verbindungen werden komplizierte organisch-chemische. Durch Molekülveränderungen bei den Grundsubstanzen, die in einem bestimmten Mischungsverhältnis zusammengebracht werden, entstehen Suchtkontrollate – Designer-, also künstlich und mit ausschließlich künstlichen Mitteln geschaffene, Drogen. Magnetrührer und Rückflusskühler sowie Zentrifugen und moderne Labormittel werden eingesetzt.«
»Hier bei STI, um Drogen herzustellen?«, erkundigte Captain Leclerc sich skeptisch. »Science & Technical Incorporated ist ein riesiger Pharmakonzern, der von den staatlichen Aufsichtsbehörden ständig streng kontrolliert und überwacht wird. Das betrifft sowohl die Produktion als auch die Forschung.«
Das erstere glaubte Bount mehr als das zweite.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass der STI-Konzern Drogen herstellt und vertreibt«, fuhr Leclerc fort. »Genauso könnten Sie General Electric oder General Food verdächtigen. Verbrecherringe zu sein.«
»Hier ist aber Verschiedenes im Argen«, erwiderte Bount. »Die drei Todesfälle sprechen eine klare und deutliche Sprache. Natürlich ist nicht der gesamte Konzern von Gangstern unterwandert. Doch von hier, davon bin ich überzeugt, kommen Rohstoffe zur Drogenherstellung. Ob und inwieweit bei STI Drogen hergestellt oder auch nur forschungsweise entwickelt werden, sei dahingestellt. STI ist ein Großkonzern. Ich könnte mir vorstellen, dass es Mitarbeiter gibt, die im trüben fischen, also verbrecherische Nebengeschäfte abwickeln. Wer will denn nachprüfen, was in den Forschungslabors alles vor sich geht?«
»Die Kollegen der betreffenden Chemiker zum Beispiel«, erwiderte Leclerc prompt. »Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In so einem Betrieb ist es doch so, dass einer dem anderen auf die Finger schaut.«
»Vielleicht nicht genau genug, oder vielleicht ist es nicht möglich.«
Leclerc sagte verächtlich: »Ich muss mit Fakten arbeiten. Wenn ich mit »vielleicht« und »eventuell« vor ihn hintrete, lacht mich der Staatsanwalt aus. Ich halte Ihren Hinweis für unsinnig, Mister Reiniger, ehrlich gesagt.«
»Der US-Pharmaverband sieht das anders. Deshalb wurde ich von dort angeworben.«
Captain Leclerc zuckte nur die Achseln. Bount konnte seine Meinung nicht ändern. Der Captain wollte mit ihm in Verbindung bleiben. Viel Unterstützung, wenn überhaupt welche, konnte Bount von ihm nicht erwarten. Doch dafür war er Detektiv, dass er seine Fälle überall auf der Welt löste, ohne sich dazu von einheimischen Behörden auf die Sprünge helfen zu lassen.
Sonst hätte er gleich einpacken können. Die Beretta S 76, eine 16-schüssige, flache Waffe, drückte Bount in der Achsel. Er hatte sie dank einer diplomatischen Sondererlaubnis, die ihm der US-Pharmakonzern zugeschanzt hatte, ins Flugzeug mitnehmen und in Kanada einführen dürfen.
»Gehen Sie auf Ihre Weise vor, Captain Leclerc«, sagte Bount Reiniger abschließend. »Ich auf die meine. – Kann ich jetzt gehen?«
Leclerc nickte. Bount tat sich im STI-Building weiter um. Der multinationale Pharmakonzern erzielte einen Großteil seines Umsatzes in den USA. Er war ursprünglich in den USA gegründet worden, 1821 von einem schwindsüchtigen Chemiker, der sich niemals hätte träumen lassen, dass aus seiner Firma mal ein multinationales Unternehmen hervorgehen würde. Schon wegen der Verknüpfung mit STI USA und dem dortigen Markt unterstützte STI Kanada Bounts Ermittlungsarbeit.
Während es draußen wieder mal schneite – in Montreal schneite es von Ende Oktober bis Mitte June, oft auch noch im Mai –, erkundigte sich Bount im STI Building, was Dr. Addams und seine Assistentin, die ebenso hübsche wie tüchtige 27-jährige Pharmatechnikerin Melly Purcell, an dem Tag getrieben hatten. Wie Bount rasch erfuhr, befanden sich in den unteren Etagen des STI-Wolkenkratzers unter anderem auch Labors, die der Forschung und Produktkontrolle dienten.
Hauptsächlich war hier die Verwaltung für STI Kanada untergebracht, wo der Pharmakonzern insgesamt neuntausend Leute beschäftigte. Fünftausend davon arbeiteten in Montreal im dortigen großen Werk im Stadtteil Montreal Nord und im STI-Wolkenkratzer. Der Rest war auf die Werke in Toronto, Ottawa und auf kleinere Dependancen verteilt. Bount bereitete es Kopfzerbrechen, die gesamten Verästelungen des STI-Konzerns zu erfassen. Die komplizierte Struktur war für Verbrecher, die sie ausnutzten, von Vorteil.
Dr. Addams und Melly Purcell hatten zum allergrößten Teil im Forschungslabor II im STI-Building gearbeitet. In diesem Labor, in dem das Personal über den Tod des Chefs und seiner engen Mitarbeiterin rätselte und deswegen trauerte, sprach Bount mit dem Leiter des Werkschutzes.
Gaston Roudeaux war jener untersetzte, ungemein muskulöse Mann, mit dem zusammen Bount vorhin auf dem Dach versucht hatte, Melly Purcell zu retten. Roudeaux hatte kurzgeschorenes, eisgraues Haar und ein wettergegerbtes, gebräuntes Gesicht, das den passionierten Sportler und Freiluftmenschen verriet. Er setzte sich lässig auf einen Labortisch und erklärte Bount, er würde wegen des Verhaltens von Dr. Addams und Melly vor einem Rätsel stehen.
»Beide waren bei ihren Mitarbeitern und Vorgesetzten gleichermaßen beliebt«, sagte der Frankokanadier. »Trenton Addams ging ganz in seiner Arbeit auf. Miss Purcell galt als ausgeglichen und äußerst tüchtig. – Hoffentlich bringt die Obduktion uns die gewünschten Aufschlüsse, was ihr Benehmen verursachte.«
»Drogen«, sagte Bount. »Was sonst? Sie haben mit einer Bewusstseinsspaltung reagiert. Die Frage ist, ob sie drogensüchtig waren, eventuell einen Selbstversuch mit einer neuen Substanz vornahmen oder ob das Suchtmittel ihnen ohne ihr Wissen und Einverständnis beigebracht wurde.«
»Wie sollte das letztere wohl geschehen?«, fragte der ausgezeichnet englisch sprechende Werksschutzleiter Bount Reiniger.
Bount zuckte die Achseln.
»Es kommt auf das Mittel an. Das heimliche Unterschieben sehe ich nicht als problematisch an.«
Bount verhörte, von Roudeaux unterstützt, die Mitarbeiter des Dr. Addams. Er schaute in den Schreibtisch und den Spind, schon einen größeren Kleiderschrank, des Doktors in zwei Fächern, nämlich Chemie und Pharmazie. Zudem sah er sich Dr. Addams' Arbeitsunterlagen an, von denen er allerdings wenig verstand.
Der STI-Konzern hatte eine breite Produktpalette. Dazu gehörten verschreibungspflichtige wie frei verkäufliche Medikamente sowie Kosmetika, Farben, Lacke und weitere Chemieprodukte. Im Werk Montreal wurden hauptsächlich Pharmazeutika hergestellt. Die Forschungsabteilung, von der ein Teil im STI-Building untergebracht war, arbeitete größtenteils an der Verbesserung von Medikamenten, die sich bereits am Markt befanden, und der Entwicklung neuer Tierversuchslabors gab es im STI-Building nicht. Anderswo existieren jedoch welche, denn ohne die umstrittenen Tierversuche kam kein Pharmaunternehmen aus. Im Dienst der Leidenden und Kranken mussten Medikamente erst mal an Tieren erprobt werden, woran kein Weg vorbeiführte.
Das Telefon auf Dr. Addams' Schreibtisch klingelte. Bount Reiniger hob ab und meldete sich in der Meinung, der Anrufer wolle ihn erreichen oder es sei eine Nachricht für die Abteilung.
»Reiniger.«
»Hier spricht Wildlife Power«, sagte ein Anrufer mit verstellter Stimme. »Wir haben die Tierquäler Addams und Purcell ihre eigene Medizin schmecken lassen. Sie ist ihnen schlecht bekommen. Das soll eine Warnung für die Konzernspitze sein, weiterhin Tierversuche vornehmen zu lassen. – Es wird weitere Todesopfer geben, wenn das nicht aufhört.«
Der Anrufer legte auf. Das Gespräch musste aus dem Haus geführt worden sein, wo über tausend Angestellte arbeiteten, hauptsächlich in der Verwaltung, im Vertrieb und beim Marketing. Bount rief sofort Roudeaux herbei, der vergeblich versuchte festzustellen zu lassen, von welchem Hausapparat aus der Anruf erfolgt war.
Auch die zwanzig Beamten der Mordkommission ermittelten – mit dem gleichen negativen Ergebnis.
»Wildlife Power«, sagte Roudeaux zu Bount Reiniger, der sich eine Zigarette anzündete und seine Pokermiene aufsetzte. »Ob wildgewordene Tierschützer hinter dem Amoklauf von Doktor Addams und dem Tod seiner Assistentin stecken? Verrückte, die sich so in den Gedanken des Tierschutzes hineingesteigert haben, dass sie in der Anwendung ihrer Protestmittel jedes Maß und Ziel verloren?«
Bount gab keinen Kommentar dazu ab. Er hatte schon die tollsten Dinge erlebt. Er rechnete jedoch mit einem Ablenkungsmanöver. Methodisch genau stellte er fest, was Dr. Addams und Melly Purcell an jenem Tag getan hatten.
Sie hatten wie üblich um 8.30 Uhr mit ihrer Arbeit begonnen. Am Mittag, als sie in der Kantine aßen, hatten sie sich mit anderen STI-Mitarbeitern unterhalten, ohne im Geringsten aufzufallen. Dr. Addams hatte sich lediglich darüber beschwert, dass Steak in der Kantine wäre zu zäh, und er möge den konservierten Ahornsirup nicht, der nur im Frühjahr frisch hergestellt gut sei.
Nach dem Mittagessen hatten Dr. Addams und Melly Purcell Daten einer komplizierten Versuchsreihe über die Molekülveränderung von Methyl-Ethymalin-Hydroxylamin-Verbindungen in den Computer eingegeben. Die rechnerische Auswertung des Großversuchs hätte noch eine Weile in Anspruch genommen.
Bount notierte sich Stichworte und Informationen in sein elektronisches Taschenmemory. Die komplizierten Worte und Sachverhalte hätte er unmöglich im Kopf behalten können. Während der Comuptereingabe und Rechenauswertung musste etwas vorgefallen sein, dass die beiden Forscher ausrasten ließ.
In dem vollklimatisierten Büroraum, in dem sie gesessen hatten, waren zwei Kaffeetassen und eine Kanne von der Polizei sichergestellt worden. Das Obduktionsergebnis der beiden Toten Addams und Purcell lag noch nicht vor. Die Leichen, auch die des von dem rasenden Dr. Addams erschossenen Wachmanns, waren in die Pathologie der McGill-Universität gebracht worden, deren medizinische Fakultät internationales Ansehen genoss.
Kriminalpathologen arbeiteten dort mit Hochdruck in einem speziell ihnen zur Verfügung stehenden Raum, um bald mit Ergebnissen aufwarten zu können. Die Todesursache war klar. Mit Blut- und Urinuntersuchungen und anderen Tests musste jedoch festgestellt werden, ob und welche Drogen Dr. Addams und seine Assistentin im Körper gehabt hatten, dass sie so hatten durchdrehen können.
Zuerst hörte Bount von Captain Leclercs Stellvertreter, einem Lieutenant des Morddezernats Montreal I, dass die chemische Untersuchung der Reste des von Dr. Addams und seiner Assistentin genossenen Kaffees keine Anhaltspunkte auf eine Drogenbeimengung ergeben habe.
»Das war harmloser Kaffee«, sagte der Kriminalbeamte. »Soll ich Ihnen die Marke sagen und ob mit Zucker oder Süßstoff gesüßt wurde?«
»Danke, nein.«
Bount schwirrte allmählich der Kopf von den pharmazeutischen High-Tech-Daten, mit denen er sich hier befassen musste. Er fragte sich, weshalb ausgerechnet Dr. Addams und Melly Purcell ein so schreckliches Ende gefunden hatten. Wenn er das wusste, soviel war ihm klar, würde er der Lösung seines Falls ein gutes Stück näher sein. Zurzeit war Bount Reiniger davon noch weit entfernt. Und er ahnte schon oder wusste ziemlich sicher, dass die Gegenseite, nämlich Gangster, alles versuchen würden, um ihn von seinen Nachforschungen abzubringen.
2.
Der Anruf erreichte Bount Reiniger im »Ritz Carlton«, nachdem er müde dorthin zurückgekehrt war. An der für Bounts Geschmack zu pompös eingerichteten Bar des First-class-Hotels nahm der Privatdetektiv einen Schlummertrunk. Ein Hotelpage trug eine Tafel durch die geräumige, gutbesetzte Bar mit den größtenteils leger gekleideten Gästen.
»Telefon für Mr. Reiniger«, stand in Englisch und Französisch darauf. Bount wandte sich an einen Barkeeper, der ihn in eine Telefonzelle verwies. Bount Reiniger meldete sich.
»Kann ich Sie sofort treffen?«, fragte die Stimme einer jüngeren Frau in kanadischem Englisch, das für einen US-Bürger gut verständlich war. »Es handelt sich um Ihren Auftrag in Montreal. Ich bin Agentin des kanadischen Drug Enforcements.«
Das war eine speziell gegen die Drogenkriminalität eingesetzte Polizeiorganisation.
»Okay. Wollen Sie herkommen?«
»Nein. Ich habe meine Gründe dafür. Können Sie mich beim Chalet treffen?«
»Wo ist dieses Landhaus?«
»Le Chalet de la Montagne steht auf dem Hügel westlich über der Stadt, dem Mont Royal, la Montagne, wie wir ihn nennen. Sie fahren zum Parkplatz Chemin Remembrance und steigen dann den Fußweg hinauf. Ich warte bei der Aussichtsplattform. Achten Sie einfach auf die Wegweiser. Sie können den Weg nicht verfehlen. Dort sind wir ungestört.«
»Es ist verdammt kalt«, sagte Bount.
»Dann ziehen Sie sich warm an. Sie haben doch einen Wagen?«
»Ich nehme ein Taxi.«
Fünf Minuten später, als Bount Reiniger mit dickem Parka, Thermohose und Moonboots, die Mütze im Schoß, im Taxi saß, fragte ihn der farbige Fahrer:
»Was um aller Welt wollen Sie spät abends beim Chalet?«
»Eine Frau treffen.«
»Für ein Rendezvous im Freien müssen Sie im März in Montreal verdammt heißblütig sein. Oder wollen Sie um die Zeit im Park Mont Royal noch Schlittschuh laufen? Gehen Sie lieber in die Suburb, die unterirdische Stadt.«
Der Taxifahrer hatte Bount als Auswärtigen erkannt. Die Suburb waren die 25 Kilometer langen unterirdischen Passagen, ans Metronetz angeschlossen, die sich quer durch die Stadt zogen. Sie fingen an der Place Ville-Marie an, unterquerten den St.-Lorenz-Strom und reichten bis zum Vorort Longueil an dessen Südufer. Es war eine komplette zweite Stadt mit Geschäften, Kinos, Nachtklubs, Restaurants und Bars.
Sie war notwendig, um dem sechs Monate dauernden strengen Winter mit Frost, Schnee und Matsch und Verkehrschaos auf den Straßen zu entfliehen.
Bount missachtete den gut gemeinten Rat des Taxidrivers, der ihn am Parkplatz unterhalb des »Bergs« absetzte, wie die Einwohner von Montreal den Hügel mit der ihnen eigenen Ironie nannten. Bount stieg die gewundene Treppe hoch und achtete darauf, dass er schnell an seine Automatic heran konnte.
Er hatte die Pistole in die Tasche des Parkas gesteckt, trug allerdings Handschuhe, die er im Fall einer plötzlichen Gefahr erst mal abstreifen musste. Der Privatdetektiv war sich klar darüber, dass er in eine Falle gelockt werden konnte.
Andererseits gehörte das Risiko bei seinem Job mit dazu. Er mochte nicht abwarten, bis die City Police von Montreal Ergebnisse erzielte, die er dann an den Pharmaverband in den USA weitermeldete. Oder im STI-Building die Stühle abwetzen, nutzlose Verhöre führen und im vollklimatisierten warmen Zimmer bleiben.
Es hatte aufgehört zu schneien. Der Schnee knirschte unter Bounts Stiefeln. Er fand die Aussichtsplattform vor dem wuchtigen Fachwerkbau Chalet de la Montagne ohne Probleme. Hinter einer Blockhütte mit geschlossenen Läden, einem Kiosk, verborgen, schaute sich Bount erst mal die Umgebung an.
Der Himmel war dunstig und schneeverhangen. Verschwommen leuchteten wenige Sterne und der Vollmond. Ihr Licht und die Lichter von Montreal, das sich zu Füßen des Mont Royal erstreckte, wurden vom Schnee reflektiert, was eine gute Sicht ergab.
Bount pirschte sich durch die verschneiten Büsche zur Aussichtsplattform. Am Geländer, bei einem Münzfernrohr, stand eine Frau mit weißem Wolfsfellmantel und offener Kapuze. Sie war blond, Mitte bis Ende zwanzig und bildschön. Das blonde Haar war stufig geschnitten. Das Profil, das sie Bount zuwandte, makellos.
Wenn sie wirklich zum Canadian Drug Enforcement gehörte, schienen sie ihre Agentinnen dort nach Model-Kriterien auszusuchen. Bount zog den Handschuh von der Rechten, entsicherte die durchgeladene Pistole und trat aus dem verschneiten Gebüsch.
Die Schöne wandte sich ihm zu. Kein Mensch war außer den beiden in der Nähe zu sehen. Tiefblaue Augen strahlten Bount Reiniger an. Aus der Nähe sah er, dass die Blondine eine kleine Narbe am linken Mundwinkel hatte. Sie setzte die Kapuze auf, die ihr Gesicht umrahmte.
Die Blonde trug helle Lederhandschuhe. Lächelnd zeigte sie Bount makellose Zähne.
»Mister Reiniger?«
»Der bin ich.«
»Ann Jepsen. Hier ist mein Ausweis.« Sie zeigte Bount eine in Plastik eingeschweißte ID-Card, die sie als Specialagent des Canadian Drug Enforcements auswies. »Ich schätze, wir ziehen am gleichen Strang.«
»Weshalb sind Sie nicht offen an mich herangetreten oder haben mich zu Ihrer Behörde bestellt?«
Bount war immer noch auf der Hut.
»In diesen Fall sind maßgebliche Persönlichkeiten verwickelt. Korruption bei den Fahndungsbehörden kann nicht ausgeschlossen werden. Wir müssen auf der Hut sein. Sie schickt der US-Pharmaverband. – Warum?«
»Es wird vermutet, dass Chemiedrogen oder deren Grundstoffe in großen Mengen beim STI-Konzern abgezweigt und in die USA gebracht werden«, antwortete Bount. Damit verriet er nichts Neues. »Vielleicht auch noch auf andere Märkte. Doch hier geht es in erster Linie um die USA und die Auswirkungen dort. Dieser Drogenexport muss unterbunden, die dafür Verantwortlichen müssen bestraft werden.«
»Ein multinationaler Konzern wie STI setzt doch nicht ein internationales Renommee aufs Spiel, in dem er Rauschgift herstellt«, bemerkte Ann Jepsen. »Das ist unlogisch. STI Kanada setzt Milliarden um. Wenn der Konzern in Rauschgiftgeschäfte verwickelt würde, wäre das eine geschäftliche Katastrophe.«
»Niemand behauptete, dass der STI-Aufsichtsrat und die Konzernführung insgesamt kriminell sind«, sagte Bount. »Ich vermute, es handelt sich um verbrecherische Machenschaften von Mitarbeitern, die STI-Produktionsanlagen und Laborausrüstungen missbrauchen.«
»Also Laboranten, die heimlich LSD oder Crack oder Ecstasy herstellen und vertreiben, grob gesagt?«, fragte Anne Jepsen.
Entweder sie stellte sich dumm, oder sie war es.
»Hier handelt es sich nicht um Kleinkram, dass sich ein Laborant ein LSD-Süppchen kocht, sondern um riesige Dimensionen«, erwiderte Bount. »Ganze Lastwagenkonvois oder Güterzüge mit Suchtmitteln gehen in die USA, illegal natürlich.«
»Das würde auf eine durchorganisierte, clevere kriminelle Vereinigung mit erstklassigem Knowhow und besten Verbindungen schließen lassen«, sagte die Blondine. Sie war also nicht dumm. »Doch wie soll das stattlinden? Meine Behörde rätselt auch. Kein Gangster kann einen Güterwaggon verbotener Aufputschtabletten einfach als Aspirin deklarieren und über die Grenze bringen. Zudem müssten die Aufputschmittel, wenn das gelänge, in den USA weitervertrieben werden. Wie soll das Verteilernetz aussehen?«
»Über Groß- und Zwischenhändler, wie sonst?«, fragte Bount.
»Dann ist da noch ein unklarer Punkt. Nämlich die Produktion bei der STI. Designerdrogen heimlich im Labor zu kreieren, ist möglich und nicht mal besonders schwierig. Doch die Massenproduktion in einem Werk wie dem der STI kann nicht so einfach verschleiert werden. Daran müssten Hunderte von Facharbeitern, Kontrolleuren und Chemikern und Pharmazeuten beteiligt sein, also Mitarbeiter der mittleren und oberen Führungsriege. Der Verkauf und die Buchhaltung müssten dabei mitmachen. Das halte ich schlichtweg für ausgeschlossen. Die an der Produktion Beteiligten und die Kontrolleure sind nicht so dumm, dass man ihnen vormachen kann, da würde Hustensaft abgefüllt, und in Wirklichkeit ist es Rauschgift. Oder denen man Ecstasy oder eine andere Chemiedroge als Penicillin verkaufen kann. Oder als Breitband-Antibiotikum.«
»Die Arbeiter in der Produktion nehmen die Medikamente nicht ein«, sagte Bount, um Ann Jepsens Kenntnisse zu testen.
Sie erwiesen sich als hieb- und stichfest.
Die Blondine sagte: »Ja, aber es werden jeweils genaue Aufzeichnungen vorgenommen. Die Medikamentenherstellung unterliegt strengster Kontrolle. Schließlich sollen diese Arzneimittel von Menschen eingenommen werden. Bereits geringe Abweichungen in der Produktion können ein Medikament untauglich oder sogar zu einer akuten Gesundheitsgefährdung werden lassen. Um bei STI Rauschgift in größerem Umfang zu produzieren, das wiederhole ich, müsste ein Großteil der Konzernmitarbeiter kriminell sein. Zudem ließe sich das bei einem größeren Personenkreis nicht geheim halten. Der STI-Konzern ist aber nun einmal keine kriminelle Organisation.«
»Das habe ich auch nicht behauptet.«
»Was wollen Sie dann dort feststellen? Was erwarten Sie, Mister Reiniger?«
Bount wollte sich nicht aushorchen lassen und antwortete ausweichend. Sein Gedankengang war, dass jemand an sich unverfängliche Stoffe in großem Umfang bei STI kaufte und sie dann selber zu Drogen mixte. Ob in Kanada oder in den USA, musste Bount noch herausfinden. Auf ihn wartete eine Riesenarbeit, zu der außer chemischen und pharmazeutischen Fachkenntnissen auch die eines Buchprüfers gehörten.
Auch Organisationen wie das amerikanische FBI und kanadische Polizeibehörden waren mit Stäben und Kommissionen tätig. Bount war es gewöhnt, zu improvisieren und sich durchzufinden. Irgendwen fand er immer, der ihm weiterhalf, wenn sein Fachwissen versagte.
Vom Mont Royal aus hatte er einen weiten Blick über die Stadt, an der vorbei der St.-Lorenz-Strom, um die Jahreszeit dick zugefroren, vom Lake Ontario in den Atlantik floss. Die Lichter der Stadt schimmerten. Am Hafen standen die niedrigen Häuser der Altstadt, der Vieux Montreal. Wegen der strengen Winter mit viel Schnee waren sie massiv und mit steilen Dächern erbaut. Enge Straßen schlängelten sich da hindurch. Die City mit ihren Hochhäusern aus Beton, Glas und Stahl sowie modernen Wolkenkratzern gruppierte sich um dem Boulevard Levesque, der Montreal in einen westlichen und einen östlichen Teil trennte.
Dort, wo der St.-Lorenz-Strom mit dem Ottawa zusammenfloss, erstreckte sich die Metropole hauptsächlich auf Montreal Island, wobei es noch die westliche gelegene Jesusinsel gab, die Flussarme umfassten, sowie kleinere Inselchen in dem gewaltigen Strom.
Ein Netz von Stadtautobahnen, Eisenbahn und die Metro zogen sich durch. Auto- und Fußgängerbrücken stellten die Verbindung zwischen den Inseln her. Ein buntes Völkergemisch hatte sich hier angesiedelt – es gab ein Chinesenviertel, ein Little Italy rund um den Jean-Talon-Markt, und zirka fünfzigtausend Griechen um die Avenue du Parc im Osten der Stadt.
Montreal hatte zwei Flughäfen, hatte 1967 die Weltausstellung Expo 67 ausgerichtet, 76 die Olympischen Spiele, war nach Toronto die zweitgrößte Stadt Kanadas und eine Weltstadt sowie ein bedeutendes Industriezentrum. Der lange und schneereiche kanadische Winter prägte Montreal genauso wie sein Inselcharakter im Strom, waldreiche Umgebung und auch Geschichte und Völkergemisch. Die Stadt, in der er sich jeweils aufhielt, spielte eine wesentliche Rolle bei Bounts Ermittlungen.
In Montreal war er fremd. Den Heimvorteil hatten die Gangster.
»Ich habe das Gefühl, wir kommen bei unserem Gespräch nicht weiter«, sagte Ann Jepsen. »Das ist schade, denn Sie gefallen mir gut.«
Sie strahlte Bount an. Den Privatdetektiv reizte es, die Blondine in die Arme zu nehmen. Bount Reiniger war kein Mann, der etwas anbrennen ließ. Das alte Sprichwort »Komm den Frauen zart entgegen, du gewinnst sie, auf mein Wort. Doch bist rasch du und verwegen, kommst du wohl noch besser fort« war ihm da Leitmotiv.
Der hochgewachsene, breitschultrige Privatdetektiv umarmte und küsste Ann Jepsen also. Es war ein filmreifer Kuss, wie selbst Clark Gable, Errol Flynn oder die neueren Spezialisten auf diesem Gebiet ihn nicht besser hingekriegt hätten.
Ann seufzte. Sie löste ihre Lippen von denen Bounts. Ihr Lächeln war eine Verheißung. Doch plötzlich zuckte sie heftig zusammen. Sie verdrehte die Augen. Blut floss ihr aus dem Mund, und sie wurde in Bounts Armen schlaff.
Etwas pfiff an Bounts Ohr vorbei. Bount ließ die Blondine los und rannte mit Zickzacksprüngen in Deckung. Er hörte wieder das Pfeifen eines kleinen, sehr schnellen Projektils, das ihn abermals verfehlte.
Der Privatdetektiv zog seine Pistole und suchte hinter dem Sockel des Jaques-Cartier-Denkmals Deckung. Cartier war der kühne Forscher und Pionier gewesen, der 1535 den St.-Lorenz-Strom hinaufgefahren war und dem Hügel, auf dem Bount jetzt stand, den Namen Mont Royal gegeben hatte.
Bount lugte hinter dem Denkmal hervor. Blitzschnell hatte er festgestellt, woher geschossen worden war, nämlich aus einem der oberen Stockwerke des Chalets, was so viel wie Villa oder Landhaus bedeutete. Der Schütze war nicht zu sehen.
Bount lauerte, die Automatic schussbereit. Der Killer hatte ein Gewehr mit Schalldämpfer benutzt. Auf die Entfernung von gut zweihundert Metern konnte Bount mit seiner Pistole nichts gegen ihn ausrichten. Für ein Gewehr, besonders wenn es mit einem Zielfernrohr versehen war, waren hingegen zweihundert Meter ein Klacks.
Der Privatdetektiv schaute zu Ann Jepsen. Ihr Wolfspelzmantel, das sah er deutlich, wies am Rücken einen Einschuss auf. Das Blut war noch nicht durchgesickert oder wurde von der Kleidung unter dem Mantel aufgesogen.
Die CDE-Canadian Drug Enforcement-Agentin bewegte sich. Flehend, die untere Gesichtshälfte blutbeschmiert, streckte sie Bount die blutige Hand entgegen. Sie schien in die Wirbelsäule getroffen zu sein, denn als sie auf Bount zukroch, musste sie sich mit den Händen voranziehen.
Ab der Hüfte gehorchte ihr Körper ihr nicht.
Bount schaute zum Chalet, dessen beide oberen Geschosse über die unteren vorstanden. Im Schatten des überstehenden Dachs war es düster, was die Fachwerkbalken von der Farbe her verstärkten.
Dennoch erkannte der scharfäugige Detektiv dort den Scharfschützen. Der Mann zielte, was Bount abschätzen konnte, auf die kriechende Agentin. Seine Waffe mit dem Schalldämpfer ragte vor.
Bount sah den dunkel gekleideten, vermummten Killer nur als schwachen Umriss, Gewehrlauf und Schalldämpfer hingegen genauer.
Bount Reiniger zielte sorgfältig, wobei er die Schusshand mit der Linken unterstützte.
Die Automatic krachte. Dem Killer oben pfiffen zweifellos die Kugeln um die Ohren. Doch auf zweihundert Meter bei schlechtem Licht und mit einer normalen Pistole, also keiner Wettkampfwaffe mit verstellbarem Spezialvisier, traf auch ein Kunstschütze nur aus Zufall.
Bounts Schüsse donnerten. Die Mündungsfeuer zuckten. Der Killer musste wieder abgedrückt haben. Bount hörte den Schuss nicht und sah auch sein Mündungsfeuer nicht.
Doch Ann Jepsen fasste sich an den Kopf. Als sie niedersank und ihre Hand wegzog, sah Bount ganz deutlich, dass sie in die Schläfe getroffen war. Und zwar dort, wo ein Schuss tödlich war, nicht zu weit vom, wo er nur zur Blindheit führte, was schon mancher stümperhafte Selbstmörder zu seinem Leidwesen hatte erfahren müssen.
Bount brüllte auf. Ohne sich selbst zu schonen und in Deckung zu bleiben, rannte er los, im Zickzack zum Tor in der Mauer, die das Chalet umgab. Im Laufen wechselte er das Magazin der Automatic.
»Du feiger Hund!«, schrie Bount, und seine Stimme schallte über den Mont Royal über der verschneiten Stadt Montreal. »Du hast eine wehrlose Frau erschossen! Hol dich der Teufel!«
Der Killer zeigte sich nicht mehr. Bount erreichte das Tor, das um die Zeit nach 23 Uhr und sehr kalt – verschlossen war. Der Detektiv fand eine geeignete Stelle, um über die Mauer zu klettern. Er sprang in den Hof, war dabei auf der Hut, damit er nicht abgeschossen wurde, und gelangte zum Haus, einem Wahrzeichen von Montreal.
Die Eingänge waren verschlossen. Bount hämmerte dagegen. Seine Schüsse mussten gehört worden sein. Doch anscheinend kümmerte sich noch niemand darum, oder man wusste nicht, wo genau sie gefallen waren. Jedenfalls näherte sich kein Sirenengeheul, noch zeigte Motorengeräusch das Eingreifen der Polizei an. Nur der Lärm eines Flugzeugs, das den Cartierville Airport im Nordwesten anflog, war zu hören.
Bount fingerte sein Taschenmesser mit Spezialwerkzeugen heraus, das er unter anderem auch als Dietrich zum Knacken einfacher Schlösser einsetzen konnte. Das Schloss der Seitentür vom Chalet war für jemand, der eine Ahnung hatte, ein Kinderspiel.
Das knackt meine Oma mit der Haarnadel, hätte Bounts ebenso hübsche wie tüchtige Assistentin June March in New York gesagt. Dort war sie zurückgeblieben und hielt in der Detektei Reiniger die Stellung.
Bount drang ins Chalet ein. Er pirschte sich durch die Gänge. Nichts war zu sehen oder zu hören.
Der Killer schien das Chalet schon verlassen zu haben. Bount durchsuchte das große dunkle Haus, das mit Möbeln aus dem 18. Jahrhundert eingerichtet war und als Gedenkstätte diente. Die Räume enthielten jeweils Relikte von verschiedenen Epochen und Kulturen.
Der eine Raum war den indianischen Ureinwohnern gewidmet, ein anderer den Inuit, wie sich die Eskimos selber nannten, die im Norden Kanadas ihr Zuhause hatten. Es gab eine Ausstellung über die Pelzhandelskompanien, die im 16. und 17. Jahrhundert wesentlich dazu beigetragen hatten, das Land zu erschließen, indem sie Handelsstationen und Vorposten der Zivilisation errichteten. Die Zeit des Kampfes zwischen den Franzosen und Engländern um die Vorherrschaft in Kanada war dokumentiert, wobei das französische Mutterland seine Interessen in Neufrankreich, wie es damals hieß, ab 1759 nach dem Verlust der Stadt Quebec mehr und mehr aufgegeben hatte.
Trotzdem war der französische Einfluss in Kanada bis heute spürbar, mit rund einem Viertel der 25,8 Millionen Einwohner von frankophiler Abstammung.
Bount schlich durch Räume, in denen Wachsfiguren von Irokesenkriegern standen, mit kahlgeschorenem Schädel, den nur ein Haarstreifen in der Mitte zierte, kriegerisch bemalt. Anderswo waren, gleichfalls aus Wachs und mit historischen Kostümen, Trapper in Lederkleidung und mit geschwänzten Fellmützen in einem Rindenkanu zu sehen. Der Detektiv passte auf, dass nicht irgendwo ein höchst moderner Killer mit einem schallgedämpften AR-16-Gewehr dazwischenstand und auf ihn lauerte.
Nachdem Bounts Überprüfung erfolglos verlaufen war, der Killer war nicht mehr da, rief der Detektiv von einem Münztelefon im Flur über den Notruf die Polizei. Er ließ gleich das Polizeipräsidium verständigen.
Bald trafen Streifenwagen und ein Motorschlitten der City Police ein. Mit erhobenen Händen, damit nicht ein übereifriger Polizist sich bedroht fühlte und aus Versehen den Finger krümmte, trat Bount vor die Tür. Uniformierte Beamte umringten ihn und hielten ihn in Schach.
Bount wies sich aus. Er durfte seine Pistole behalten. Captain Lefevre erschien kurz darauf mit einem Motorschlitten, der jetzt im Winter in den Außenregionen von Montreal durchaus gebräuchlich war. Der hagere, wortkarge Frankokanadier war in Zivil. Er hatte überm Mantel einen langen weißen Schal um den Hals geschlungen und trug eine Pelzmütze.
Bount erklärte ihm, was vorgefallen war. Ein dicker Polizist in Winteruniform trat an den Leiter der Mordkommission heran und redete auf ihn ein. Bount verstand von dem Joual, das wieder mal gesprochen wurde, nur einen Teil.
Er genügte, um ihn zu alarmieren.
»Wo, sagten Sie, liegt die Tote?«, fragte Leclerc in tadellosem Französisch, das er durchaus konnte.
»Auf der Aussichtsplattform beim Münzteleskop«, antwortete Bount.
»Dann kommen Sie bitte mit und zeigen Sie sie mir«, erhielt er von Leclerc zur Antwort.
Die primitive Sprache des Captains am Nachmittag im STI-Building war Tarnung gewesen. Leclerc spielte gern den Simpel, um von Verdächtigen falsch eingeschätzt zu werden.
Bount führte die Beamten um das Chalet herum. Er stutzte, als er um die Ecke bog. Ann Jepsens Leiche war verschwunden. Es gab überhaupt keine Spur, dass hier jemand erschossen worden war – kein Blutstropfen im Schnee, kein Körperabdruck, nichts.
Bount lief zum Münztelefon.
»Hier hat sie gelegen«, sagte er. »Ich bin ganz sicher.«
»Ach.« Leclercs Stimme troff vor Sarkasmus. »Quer durch den Kopf geschossen ist Ann Jepsen dann aufgestanden und davonspaziert. Ihre Spuren verwischte sie auch gleich, damit sie niemanden stören, wie ich vermute.«
»Ich weiß nicht, was hier gespielt wird«, erwiderte Bount. »Aber so viel kapiere ich, dass ich hereingelegt werden soll. Sie müssen überprüfen, ob es beim Drug Enforcement eine Agentin mit Namen Ann Jepsen gibt, die Mitte bis Ende Zwanzig, blond und bildhübsch ist. Besonderes Kennzeichen ist eine kleine Narbe am linken Mundwinkel.«
»Ich kenne Ann Jepsen persönlich«, sagte Leclerc. »Sie sieht so aus, ist allerdings zweiunddreißig, wenn Sie es ganz genau wissen wollen. Das mit der Narbe stimmt auch.«
»Wo hält sie sich auf?«, fragte Bount.
»Ich hätte besser sagen sollen, ich kannte Ann Jepsen«, sagte Leclerc. »Sie ist vor drei Wochen am Fluss bei den Lagerhäusern erdrosselt aufgefunden worden. Es ist schade um sie – sie war eine erstklassige Beamtin und ein vorzüglicher Mensch.« Leclercs Miene verhärtete sich. Er fragte Bount barsch: »Warum erzählen Sie uns diesen Unsinn? Was versprechen Sie sich davon? Oder haben Sie am Ende selbst Drogen genommen? Sie kommen mit ins Präsidium und werden dort eine Urinprobe abliefern. Wehe, wenn wir bei Ihnen Hinweise auf Drogenmissbrauch finden. Dann landen Sie schneller hinter Gittern, wie Sie ›Papp!‹ sagen können. Bis Sie wieder entlassen werden, um in den USA Ihr Unwesen zu treiben, wird in dem Fall längere Zeit vergehen.«
Ein Uniformierter, der hinter dem Captain stand, meinte: »Der US-Schnüffler hat zu viele Hollywood-Filme gesehen – French Connection und dergleichen. Er spinnt uns hier einen vor. – Sollen wir ihm Handschellen anlegen, Captain Leclerc?«
»Nein. Aber nehmt ihm die Pistole weg. Den Spinner können wir nicht bewaffnet herumlaufen lassen.«
Die Worte des Captains waren für Bount wie ein Schlag ins Gesicht. Er war unglaubwürdig geworden. Das würde seine weiteren Ermittlungen erheblich erschweren. Wenn die Rechnung der Drogen-Gangster aufging, würde man ihn mit Schimpf und Schande heimschicken. Das war auch eine Art, einen Privatdetektiv loszuwerden.
*
Outremont auf der Nordseite des Mont Royal war die bevorzugte Wohngegend der frankokanadischen Oberschicht von Montreal. Der frühere Premierminister Pierre Elliott Trudeau hatte hier seinen Familiensitz. Den ebenso schillernden wie politisch tüchtigen Trudeau hatten die Eskapaden seiner Hippie-Gattin ebenso gebeutelt wie staatsmännische Krisen.
An einer Ringstraße bei der unteren Sherbrooke Street, die Montreal längs durchzog und teilte, stand zwischen anderen Villen, zwei Steinwürfe weit von dem Trudeauschen Besitz entfernt. die Villa Alain Blondels. Dort traf, ehe die Streifenwagen von der anderen Seite den Hügel zum Chalet hinauffuhren, ein schallgedämpfter Motorschlitten ein. Ein großer, breitgesichtiger Mann mit tiefem Haaransatz lenkte ihn.
Hinter ihm saß zusammengekauert eine Frau im weißen Wolfsfellmantel. Der Mann stellte den Schlitten in einem Schuppen ab. Die Frau ging inzwischen schon zum Haus. Sie legte den Daumen auf einen Sensor, damit die Alarmanlage nicht anschlug, und sperrte auf.
In der Diele streifte sie den sündteuren Pelzmantel lässig von den Schultern und ließ ihn auf die Dielen fallen. Ihre schicke Umhängetasche nahm die schöne Frau mit. In der Wohnhalle saß ein vornehm aussehender Mann mit graumeliertem Kinnbart. Zu seinen Füßen lagen zwei Dobermänner, die beim Eintreten der schönen jungen Frau den Kopf von den Pfoten hoben.
Die Frau hatte rabenschwarzes, ziemlich kurz geschnittenes Haar und dunkle Augen. Der Mann am Kamin in dem luxuriös und geschmackvoll eingerichteten Raum wachte aus seinem Brüten auf und schaute sie an.
»Wo warst du, Blanche?«, fragte er.
»Aus«, erwiderte sie. »In der Suburb bei einem Liebhaber, einem schwarzen Drummer. Willst du noch mehr wissen?«
Alain Blondel sprang auf und hob die Hand zum Schlag. Blanche, seine Frau, lachte ihn aus.
»Wage es, mich zu schlagen, und Jack Rufus bricht dir die Knochen!«, drohte sie. Jack Rufus war der breitschultrige Schlittenfahrer. »Was willst du? Wir haben uns doch auf eine offene Ehe geeinigt.«
»Wovon ich kaum einen Gebrauch mache.«
»Was kann ich dazu, wenn du impotent bist«, sagte die einssiebzig große, schlanke Schönheit mit beißendem Spott. »Man kann nicht alles haben, Alain – Reichtum, Ansehen, Erfolg, eine schöne Frau wie mich und zudem noch ein glückliches Familienleben.«
Die Hunde knurrten.
»Warum schlägst du nicht zu, Blondel?«, fragte die Frau herausfordernd. »Du hast doch nicht etwa Angst?«
Blondel ließ die Hand sinken.
»Es ist nicht mein Stil, eine Frau zu schlagen. – Warum ärgerst und quälst du mich so? Sag mir, dass du mich nicht betrogen hast.«
»Du sollst mich nicht kontrollieren wollen, Alain. Das kann ich nicht leiden. Reden wir nicht mehr darüber. – Wie geht es Marie-Claire?«
»Meine Tochter hat sich in ihren beiden Zimmern eingeschlossen. Sie will mit niemandem sprechen. Ich fürchte, sie hat wieder dieses Teufelszeug genommen – Ecstasy, diese verdammte Droge. Ich weiß keinen Rat mehr.
Zwei Therapien und eine Entziehungskur schlugen fehl. Sie brach beide ab. Sie lehnt ärztliche Hilfe ab, ist nicht bereit, zu einem Psychologen oder einer Drogenberatungsstelle zu gehen und lässt niemand an sich heran.«
Die dunkelhaarige Frau sagte: »Weshalb soll sie zur Drogenberatung? Sie weiß doch auch so, was sie nehmen soll.« Blondel konnte darüber nicht lachen. »Weißt du, wie sie an das Rauschgift kommt?«, fragte Blanche. »Sie verlässt das Haus doch so gut wie gar nicht mehr. Sie dämmert nur noch in ihren Räumen vor sich hin.«
»Leider. Ich habe keine Ahnung, wie sie an die Droge kommt. Das Personal beobachtet sie in meinem Auftrag. Doch auch von den Bediensteten kann mir keiner diese Frage beantworten. Marie-Claire ist ständig high. Sie feiert einsame Partys unter dem Einfluss ihres Rauschgifts.«
»Du solltest sie rauswerfen, Alain. Du siehst in ihr immer noch dein kleines Prinzesschen und willst alle üblen Einflüsse von ihr fernhalten. Aber das ist Marie-Claire längst nicht mehr. Sie ist süchtig bis ins Knochenmark. Für die Droge würde sie alles tun und sich an jeden verkaufen.«
Blondel zuckte zusammen. Er vergrub das Gesicht in den Händen.
»Sie hat hier nichts mehr verloren«, fuhr Blanche gnadenlos fort. »Wenn du sie schon nicht rauswerfen willst, gib sie wenigstens in eine geschlossene Anstalt, wo man sich um Fälle wie sie kümmert und mit ihnen umzugehen weiß.«
»Sie hat mir mit Selbstmord gedroht, wenn ich das tue«, sagte der graumelierte Mann, ein Endfünfziger, dumpf. Er nahm die Hände vom Gesicht und schaute seine über dreißig Jahre jüngere Frau an. »Ich kann es nicht. Ich hoffe noch immer, dass Marie-Claire sich einmal besinnt. Irgendwann muss sie doch genug kriegen von dem Teufelszeug, dieser Droge. Ich hoffe auf einen lichten Moment von ihr, eine Einsicht. Dann kann man einhaken. Dann nimmt sie Hilfe an. Früher nicht.«
»Sie wird nie genug kriegen. Eher krepiert sie. Du bist viel zu weichherzig, Alain. Sie muss hart angepackt werden.«
»Das kann ich nicht, Blanche. Lass es, wie es ist, vorerst jedenfalls. Ihre Mutter hat sich umgebracht. Marie-Claire ist mein einziges Kind. Ich will sie nicht auch noch verlieren.«
»Du musst es wissen, Alain. Sie ist deine Tochter. Ich will jetzt schlafen. Es ist spät, und ich bin müde.«
Damit wandte die Frau sich ab. Sie verließ die Wohnhalle. Der Mann machte eine Bewegung, als ob er sie zurückhalten wollte. Doch er wusste, dass das zwecklos sein würde. Blanche hatte ihren eigenen Kopf. Sie ließ sich von ihm nichts sagen.
Blanche Blondel stieg die Treppe hoch. Sie hatte es weit gebracht, seit sie im Hafenviertel als das achte Kind eines meist arbeitslosen und dem Alkohol zugetanen Stauers aufgewachsen war. Den Luxus und Reichtum, die sie jetzt genoss, wollte sie sich nie mehr nehmen lassen.
Sie lauschte kurz an der Tür eines der beiden Zimmer, die Marie-Claire bewohnte, und hörte traurige Musik. Blanche zuckte die Achseln. Sie kannte nur sich selbst und ihre Interessen. Mitleid war Schwäche. Für Blanche hieß es fressen oder gefressen zu werden. Wenn notwendig, ging sie über Leichen. Die Philosophie, die sie hatte, war genauso gnadenlos wie das Leben, wie sie es sah.
Blanche betrat ihre Suite. Alain Blondel, ihrem Mann, gewährte sie hier höchst selten Zutritt, und wenn, dann musste er sich vorher anmelden. Blanche kalkulierte scharf und wusste genau, wie sie ihn zu nehmen hatte. Sie schaute in die Umhängetasche, ehe sie sie hinten im Schrank verstaute.
Die Tasche enthielt außer einer 32er Pistole Make-up-Zubehör und allerlei Kram, von Kleenex-Tüchern über Schlüssel bis hin zu Scheckkarten und Kleingeld. Außerdem eine blonde Perücke, Fläschchen mit einer Reinigungslösung und Wattebäusche. Zudem eine Schachtel mit blauäugigen Kontaktlinsen sowie einen Aufkleber, der zuvor an dem weißen Wolfsfellmantel gehaftet hatte.
Der Aufkleber täuschte einen Einschuss vor. Bount Reiniger war davon in die Irre geführt worden. Den Plastikbehälter mit der roten Flüssigkeit, die sie sich in die Haare geschmiert hatte, hatte Blanche unterwegs weggeworfen. Es war eine Hülle in der Größe, wie sie Gratisproben von Duschgel oder Haarwaschmittel enthielten. Blanche versteckte die Tasche. In ihrem Ankleidezimmer drehte sie sich vor den Spiegelschränken, die das gesamte Zimmer ausfüllten. Die 27jährige war mit sich nicht ganz zufrieden. Sie hätte gern etwas mehr Busen und noch längere Beine gehabt. Aber bekanntlich hatten alle bildschönen Frauen was an sich auszusetzen.
Blanche ging ins Bad, das Tageslichteinfall durch die verglaste Decke mit Schrägfenster hatte und mit schwarzem Naturstein mit in den Boden eingelassener nierenförmiger Wanne ausgestattet war. Farne und ein Holzstamm mit einer Epiphyte, einer in ihrer natürlichen Umgebung auf Bäumen wachsenden Pflanze mit lila leuchtender Blüte, befanden sich hier. Die geschwungenen Bedienungselemente des Bads – als profane Wasserhähne konnte man sie kaum bezeichnen – bestanden aus blankem Silber.
Die dunkelhaarige, nahtlos gebräunte, makellos schöne Frau stellte sich unter die Massagedusche. Sie genoss die prickelnden Strahlen, die abwechselnd stärker und schwächer, dünner und dicker waren, heiß und kalt. Blanche Blondel dehnte ihren Luxuskörper unter den Wasserstrahlen.
Sie stellte sich Bount Reinigers Gesicht vor, als die »Leiche« spurlos von der Aussichtsplattform verschwunden war, und lachte hellauf.
3.
Im Polizeipräsidium sah Bount Reiniger ein Foto der ermordeten Drug-Enforcement-Agentin Ann Jepsen und staunte über die Ähnlichkeit zwischen ihr und der Frau, die er in dieser Nacht beim Chalet getroffen hatte. Es musste jemand gewesen sein, der über ausgezeichnete Fähigkeiten als Maskenbildner verfügte oder einen Fachmann zur Hand hatte. Die Narbe, die Frisur, alles stimmte bis aufs I-Tüpfelchen überein.
Hätte Bount nicht von Captain Leclerc und anderen Beamten glaubhaft versichert bekommen, dass Ann Jepsen nicht mehr lebte, wäre er völlig sicher gewesen, sie getroffen zu haben. Die nächste Frage, die bei ihm auftauchte, war, ob die Frau, die ihn als Ann Jepsen hergerichtet zum Chalet gelockt hatte, erschossen worden war oder nicht.
Bount glaubte es nicht. Es war ein Bluff gewesen. Die Frau hatte ihm zunächst ihre Verwundung und dann ihren Tod glaubhaft vorgetäuscht, ebenfalls mit maskenbildnerischen Mitteln.
Es war eine filmreife Leistung gewesen.
Das Ganze, das spurlose Verschwinden der am Boden Liegenden, hätte sonst keinen Sinn ergeben. Es war ein klarer Versuch, ihn bei den Behörden in Montreal, besonders der Mordkommission, unglaubwürdig zu machen, ja, als einen Spinner hinzustellen.
Bount lieferte im Präsidium brav seine Urinprobe ab. Der Polizeiarzt untersuchte seine Reflexe und leuchtete ihm mit einem Lämpchen in die Pupillen. Der Doc schwieg sich zum Ergebnis seiner Untersuchungen aus. Bount durfte in sein Hotel zurückkehren. Es war schwierig, nachts um halb drei in Montreal ein Taxi zu erwischen. Mit der Subway wollte Bount Reiniger nicht fahren. Um die Zeit verkehrten kaum Züge. Das Warten auf der Station hätte Bount Reiniger zu lange gedauert.
Todmüde langte er im »Ritz Carlton« an. Der Flug von New York nach Montreal und alles Folgende hatten Bount geschafft. Er schloss die Tür des Hotelzimmers ab, stellte vorsichtshalber noch einen Stuhl gekippt so dagegen, dass er umfallen und ihn wecken musste, sollte die Tür mit einem Nachschlüssel heimlich geöffnet werden, und legte sich ins Bett.
Mit der Pistole unterm Kopfkissen schlief Bount ein. Am anderen Tag musste er um elf Uhr im Präsidium sein. Captain Leclercs Stellvertreter, der Lieutenant, teilte ihm mit eisiger Miene mit, seine Urinprobe wäre negativ ausgefallen, hätte also keine Hinweise auf Medikamenten- oder Drogeneinnahme ergeben. Im Gegensatz dazu war durch die Labortests bei Dr. Addams und Melly Purcell festgestellt worden, dass sie eine kritische Drogenmenge im Blut gehabt hatten, als sie durchdrehten.
Lieutenant Benson ließ durchblicken, dass die Mordkommission Bount Reiniger mit Misstrauen betrachtete. Die Story von Ann Jepsens Doppelgängerin, die ihm beim Chalet einen bühnenreifen Tod vorgespielt hatte, wurde ihm nicht geglaubt. Aus den dort gesicherten Spuren ging nur hervor, dass Bount um sich geschossen hatte.
»Sie scheinen mich hier nicht zu brauchen?«, fragte Bount den Lieutenant im Behördenhochhaus an der Mansfield Avenue.
»Ehrlich gesagt, nein«, erhielt er von der Frostmiene Benson zur Antwort. »Es hat drei Todesfälle gegeben, und es mag eine Drogenaffäre größeren Ausmaßes vorliegen. Doch diese ineinander verwickelten Kriminalfälle zu klären, bedarf es keines Privatdetektivs aus New York. Das schaffen die kanadischen Polizeibehörden in Zusammenarbeit mit denen der USA sehr gut allein.«
»Beim US-Pharmaverband ist man anderer Meinung«, erwiderte Bount. Benson zuckte die Achseln. »Die Pharmahersteller haben zu viel Geld. Deshalb stellen Sie auch protzige, himmelstrebende Hochhauspaläste hin. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gelungen ist, den Auftrag vom Pharma verband zu ergattern. Nach meiner Ansicht ist das für Ihren Einsatz ausgegebene Geld eine Fehlinvestition.«
»Meinem guten Namen und meinen nachweisbaren Erfolgen verdanke ich es, dass ich engagiert worden bin. Als fähiger Privatdetektiv kann ich unkonventioneller arbeiten als eine Behörde wie ihre.«
»Wir verfügen über ganz andere Mittel und einen Fahndungsapparat, von dem Sie nur träumen können«, erwiderte Benson von oben herab. »Wir haben internationale Verbindungen, können Interpol einschalten, jederzeit überall um Amtshilfe ersuchen ...«
»... und Sie sind eingeengt, müssen sich immer an den Instanzenweg halten und zig Formulare ausfüllen, wenn Sie mal wegen Ermittlungen ins Ausland müssen. Oder auch nur in eine andere Stadt verreisen. Ich habe eine Menge schwierige Fälle gelöst. Ich kläre seit Jahren Kapitalverbrechen auf, bin international tätig und habe schon harte Nüsse geknackt, an denen sich Polizeibehörden die Zähne ausbissen. – In den USA arbeite ich gern eng mit den Behörden zusammen. Ich kenne zahlreiche höhere Beamte und bin mit einigen davon befreundet. Mein bester Freund zum Beispiel ist Captain Rogers, der Leiter der Mordkommission Manhattan Süd.«
»Wir sind hier in Montreal.«
Bensons Miene blieb eisig. Bount verabschiedete sich. Von der örtlichen Polizei hatte er keine Unterstützung zu erhoffen. Es würde auch ohne gehen. Bount fuhr, wieder im Taxi, zum STI-Building im Zentrum. Der Chairman-Sprecher und Aufsichtsratsvorsitzender des Pharmakonzerns –, Antoine du Martier, war kooperativer.
Der zierliche Frankokanadier, ein Männchen mit Piepsstimme, das auf den ersten Blick lächerlich wirkte, jedoch eine fachliche Kapazität ersten Ranges war, hatte am Vortag einen Schock erlitten. Drei Tote in seinem Haus waren eine Katastrophe. Die Medien hatten sich auf den Fall gestürzt.
Du Martier, dank Beruhigungstropfen und der ihm eigenen Selbstdisziplin Herr seiner selbst, teilte Bount mit, dass Wildlife Power sich mit einem Bekennerbrief an den »Montreal Star« gewandt hatte. Die ominöse Gruppe behauptete darin wieder, für das Durchdrehen von Dr. Addams und seiner engsten Mitarbeiterin verantwortlich zu sein. Wildlife Power hatte zuvor noch nie von sich hören lassen.
Bount hielt den Anruf und den Brief nach wie vor für ein Ablenkungsmanöver.
»Professor Winfred Purcell, Mellys Vater und ein enger Freund von Doktor Addams, erlitt gestern noch einen Nervenzusammenbruch«, teilte du Martier Bount Reiniger in der Chefetage mit. »Sie haben recht, Mister Reiniger, und ich sah das falsch. Wir haben ganz gewaltige Probleme, die wir allein nicht lösen können.«
Du Martier bat Bount um ein Gespräch unter vier Augen. Der Spitzenmanager, von Haus aus Chemiker und Pharmazeut, schickte die beiden Aufsichtsratsmitglieder hinaus, die noch zugegen waren. Angespannt, niedergedrückt von der Last der Verantwortung, saß du Martier am Acrylglasschreibtisch mit Computerbord und modernsten Kommunikationsmitteln.
»Sie müssen sich mittlerweile einen Überblick verschafft haben, Mister Reiniger«, sagte er zu Bount. »Waren Doktor Addams und die Pharmatechnikerin Melly Purcell rauschgiftsüchtig? Hatten sie private Probleme? Ein Verhältnis miteinander? Was haben Ihre Recherchen ergeben?«
»Ich bin erst einen Tag da«, sagte Bount. »Das müssten Sie eigentlich besser wissen.«
»Ich bin Topmanager, kein Beichtvater und kein Psychiater. Ich weiß es eben nicht, obwohl ich den Firmenpsychologen und andere fragte. Auch Gaston Roudeaux, der Leiter des Werksschutzes und Sicherheitsdienstes, konnte mir nichts Konkretes sagen.«
Roudeaux hatte, wie Bount inzwischen wusste, ein umfangreiches Aufgabengebiet. Auch die Abwehr von Werksspionage gehörte dazu.
»Auf all das, was Sie erwähnten, weist bei Doktor Addams und Melly Purcell bisher nichts hin«, erwiderte Bount. »Ich kann noch mit ihren Angehörigen und Freunden sprechen, glaube aber nicht, dass das etwas ändert.«
»Soweit die Geheimnistuer von der Mordkommission etwas verlauten lassen, höre ich da das gleiche«, sagte der Chairman. »Aber Doktor Addams und Melly Purcell standen einwandfrei unter Drogeneinfluss. Leichtsinnig und als Selbsttest haben sie bestimmt nichts geschluckt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde bedeuten, dass ihnen die Droge heimtückisch beigebracht worden ist, ohne dass sie es wussten. – Aber wie und von wem? Der Kaffee, den sie zuletzt tranken, enthielt einwandfrei keine gefährlichen Zusätze.«
Bount hatte eine Idee. Es sei denn, dachte er, die Kanne und die Tassen wären vertauscht worden. Der Kaffee wäre die ideale Möglichkeit gewesen, dem Forscher und seiner Assistentin die Droge beizubringen. Damit wären die beiden einwandfrei ermordet worden.
Bount erwähnte seinen Gedankengang nicht. Du Martier konnte sich nicht verplappern und nichts verraten, wenn er nichts wusste.
»Ich halte den Tod der beiden für Mord«, sagte Bount Reiniger. »Doktor Addams war nicht zurechnungsfähig, als er den Wachmann niederschoss. Genauso wenig wie Melly Purcell, als sie vom Dach sprang.«
»Die arme Melly«, sagte du Martier. »Es ist eine Tragödie. Sie war noch so jung. Sie ist verlobt gewesen und wollte bald heiraten. Doktor Addams hinterlässt Frau und zwei Kinder.«
Er bot Bount eine Prämie vom STI-Konzern, wenn er den Fall löste und den oder die Mörder fand. Bount erwähnte, er würde seine Arbeit auf jeden Fall bestmöglich leisten, ob mit Prämie oder ohne. Er vereinbarte mit du Martier, dass die gesamte Produktion von STI überprüft werden sollte.
Genauso war festzustellen, an wen Lieferungen gingen, aus denen Suchtmittel erstellt werden sollten. Der Topmanager hörte sich alles an.
»Das kann ich erledigen lassen«, sagte er. »Doch wer garantiert, dass die betreffenden Grundstoffe nicht an verschiedene Stellen gehen, dann womöglich noch mehrmals verschoben und nach mehreren Stationen zusammengebracht werden? Es wäre besser, das Labor zu finden – oder die Labors –, in dem die Suchtderivate erzeugt werden. Es muss mit hochmodernen Geräten ausgerüstet sein, vielleicht sogar Ionenschleudern, Rückflusskühlern und Hochgeschwindigkeits-Magnetrührern.«
Bount schüttelte den Kopf.
»Um ein ordentlich ausgerüstetes Labor muss es sich schon handeln. Doch so hochtechnisiert, wie Sie meinen, Sir, muss es nicht unbedingt sein. Es kann, aber es muss nicht. Kokain zum Beispiel wird oft in primitivsten Buschlabors fabriziert. Oder in Kellerküchen, in denen die Kakerlaken an den Wänden Parade laufen und am Ende noch in den Koks fallen.«
»Ich werde Gaston Roudeaux mit der Überprüfung beauftragen«, sagte du Martier.
»Lassen Sie das lieber von anderen erledigen, Sir.«
»Aber er ist der Werkschutzleiter.«
»Trotzdem. Ich habe meine Gründe dafür.«
»Sie misstrauen ihm?«
Bount äußerte sich nicht dazu. Er bat du Martier nur nochmals, seinen Vorschlag zu befolgen. Sehr nachdenklich sah der Aufsichtsratsvorsitzende ihn weggehen.
*
Wie Bount hörte, war Roudeaux in dem Labor gewesen, in dem Dr. Addams und Melly Purcell ihren letzten Kaffee getrunken hatten. Er hätte Gelegenheit gehabt, sowohl die Droge in den Kaffee zu geben als auch später den verräterischen Inhalt der Kanne und der Tassen auszutauschen. Roudeaux bemerkte, dass Bount ihm misstraute. Er stellte den Privatdetektiv jedoch nicht zur Rede.
Bount merkte, wie Roudeaux ihn belauerte. Bount Reiniger trank und aß bei STI nichts. Er misstraute sogar der Luft, die er atmete. Er stellte eine Gefahr für die Drogengangster dar, die alles daran setzen würden, ihn zu beseitigen.
Doch als Bount wieder mal mit dem Expresslift vom Erdgeschoss des STI-Buildings in den 42. Stock hinauffuhr. schnappte die Falle zu. Der Detektiv stand allein in der Kabine. Ein Zischen warnte ihn. Durch einen Belüftungsschlitz wurde Gas in die Kabine geblasen. Die Zündung des Druckzylinders musste durch ein Funksignal oder ferngelenkt ausgelöst worden sein, wobei derjenige, der das erledigte, Bount beim Betreten des Fahrstuhls beobachtet hatte.
Der Privatdetektiv hielt die Luft an. Er zog die aus dünner Folie bestehende Gasmaske aus der Jackettasche, die er sich besorgt hatte, und streifte sie über. Zwei Patronen im Filter reinigten die vergaste Luft.
Doch damit hatte Bount Reiniger es noch nicht geschafft. Der Lift erwies sich nicht nur in einer Hinsicht als Todesfalle. Er war mit einem Lautsprecher versehen, für Durchsagen, und wies zudem eine versteckte Kamera auf, wie Bount erst jetzt feststellte. Die Kamera war in die Deckenbeleuchtung eingebaut.
Bount sah das Objekt.
Der Lift stoppte zwischen zwei Etagen. Er war von außerhalb gestoppt worden. Jemand hatte in die Fahrstuhlmaschinerie eingegriffen.
»Die Gasmaske nützt dir nichts, Bount Reiniger«, drang eine höhnische Stimme aus dem Lautsprecher. »Das Gas dringt durch die Poren in deinen Körper ein und bringt dich um. Eine halbe Minute, und du bist eine Leiche.
Nichts kann dich retten. Wir haben unsere Mittel und Wege, mit Schnüfflern wie dir fertig zu werden.«
Höhnisch lachte der Sprecher auf. Bount bezweifelte nicht, dass er die Wahrheit sprach. Er musste raus aus der Todesfalle oder die Zufuhr des Mordgases stoppen, bei dem es sich um eine Weiterentwicklung des im Zweiten Weltkrieg entwickelten Zyklon B handeln konnte.
Bount musste den Lift wieder in Gang setzen oder ihm schleunigst entrinnen. Der Lift hatte jedoch keinen Notausstieg, wie die älteren Modelle. Wer damit stecken blieb, konnte nur die Notrufklingel bedienen und warten, bis er durch Außensteuerung oder als letzte Möglichkeit übers Handrad an der Liftmaschine am Dach zum nächsten Stockwerk geholt wurde.
Bount schien verloren. Er legte den Nothalt-Schalter vor und zurück und drückte die Knöpfe. Tatsächlich setzte der Fahrstuhl sich wieder in Bewegung. Die Falle war nicht so perfekt, wie sie gewirkt hatte.
Bei der schnellen Einrichtung war zumindest ein Fehler unterlaufen. Doch aufatmen konnte Bount Reiniger noch nicht. Der Lift ruckte und stoppte wieder, als jemand von außerhalb eingriff. Bount wiederholte die Aktion von vorhin. Ein wüster Fluch in Joual drang aus dem Lautsprecher.
Der Lift ruckte wieder an. Bount Reiniger verlangte es nach drastischeren Aktionen. Am liebsten hätte er die Automatic gezogen und um sich geschossen. Doch auf welches Ziel? In den Tableau, also die Bedienungselemente, zu schießen, war sinnlos. Dann gab es höchstens einen Kurzschluss, und der Fahrstuhl steckte erst recht.
Auf die Gaspatrone oder den Zylinder konnte Bount auch nicht feuern. Denn bei einem Einschuss wäre das Gas erst recht aus der unter Druck stehenden Patrone geströmt. Den Lüftungsschlitz verstopfen oder sein Jackett davorhalten, konnte der Detektiv ebenfalls nicht. Dann kam er nicht mehr an den Tableau heran, und der Lift stand. Als Gassperre eignete ein Jackett sich schlecht.
Diesmal stoppte der Lift so, dass Bount durch die Türscheibe die Außentür sah. Ein Meter fehlte, und Bount hätte aussteigen können. Seine Haut brannte und prickelte. Das konnte vom Giftgas hervorgerufen, aber auch psychologisch bedingt sein.
Bei Hautkontaktgasen setzte der Tod meist unter Krämpfen ein. Er fand durch Ersticken statt, weil die Lungenbläschen sich auflösten und das Lungengewebe zerstört wurde.
Noch konnte Bount atmen. Abermals brachte er den Lift in Gang. Der Detektiv war schweißgebadet. Der Lift gelangte auf das Niveau der Außentür. Bount hatte die Nummerntasten für das Stockwerk gedrückt, das korrekt als Digitalanzeige aufleuchtete. Doch die Tür ging nicht auf.
Stattdessen erfolgte wieder das nervenzerfetzende Lachen aus dem Lautsprecher. Der Killer, der Bount Reiniger Bemühungen über die im Lift eingebaute Kamera verfolgte, bemühte sich, ihn zu entnerven.
»Die Tür ist blockiert! Wirf dich dagegen! Schieß! Es nutzt alles nichts mehr! Dein letztes Stündchen hat geschlagen!«
Bount befolgte die Aufforderung nicht. Sie war dazu gedacht, ihn in Panik zu versetzen und ihm die letzte Chance zu rauben. Die Nerven zu behalten, war hier angesagt.
Abermals legte Bount den Nothalt-Schalter vor und zurück und drückte nochmals die Taste mit der Drei und die mit der Zwei, also 32. Stock. Der Fahrstuhl bewegte sich noch um drei Zentimeter. Damit hatte er die richtige Position.
Die Tür glitt auf. Bount öffnete die Außentür und verließ fluchtartig die Todeskabine. Eine Gruppe japanischer Gäste des STI-Konzerns kam den Korridor entlang. Abrupt blieben die Japaner beim Anblick des Mannes mit der Gasmaske stehen.
Bount winkte ihnen zu und schrie dumpf durch die Maske, sie sollten stehen bleiben. Niemand durfte den zur Gaskammer umgebauten Fahrstuhl ohne Schutzanzug betreten. Die Frage war, ob Bount den Gasangriff überleben würde. Seine Haut brannte, als ob er nackt durch ein Brennnesselfeld gelaufen wäre.
Rein psychologisch ließ sich das nicht erklären. Bount Reiniger hatte eine Portion des Gases und Hautkontaktgifts erwischt. Solche mörderischen C-Waffen waren geächtet, jedoch in den Waffenarsenalen nicht nur der Großmächte zu finden. Sie zählten zu den schlimmsten und gemeinsten Kampfmitteln, die es gab.
Das Brennen verstärkte sich. Bounts Haut wurde feuerrot. Er fing an zu husten. Entsetzt wichen die Japaner zurück, als der Mann mit der Gasmaske in die Knie sank, sich an den Hals fasste und keuchte. Ein Japaner rief nach einem Arzt. Türen öffneten sich, und STI-Angestellte schauten auf die Szene im Etagenflur.
Bount Reiniger machte sich aufs Sterben gefasst. Er hatte immer gewusst, dass er bei seinem gefährlichen Job mal an diesem Punkt stehen konnte, und sich schon lange damit abgefunden. Doch jetzt, da ihn der Tod auf der Schippe hatte, wollte der Detektiv nur noch leben.
Er röchelte nach einem Arzt. Selbst Sekunden dehnten sich endlos lange für Bount Reiniger. Das Sterben schien sich Ewigkeiten hinzuziehen. Bount hatte gehört, kurz vorm Tod könne das gesamte Leben eines Menschen innerhalb Sekunden noch mal vor ihm abrollen. Bei ihm war das nicht der Fall.
Da waren nur Schmerz, Todesangst, Bitterkeit und Zorn darüber, dass er den Drogengangstern trotz aller Vorsicht doch in die Falle gegangen war – und der verzweifelte Wille zu leben.
*
Etwas musste geschehen. Ein Mittel gegen das Giftgas war nicht in Sicht. Bis ärztliche Hilfe eintraf und die Helfer mitkriegten, was Bount Reiniger fehlte, würde es längst zu spät sein. Doch Hautkontaktgifte ließen sich teils abwaschen. Eine Dusche half oft, selbst gegen radioaktiv verseuchten Staub.
Bount taumelte zum Waschraum und WC.
»Der Lift ist vergast!«, röchelte er den Japanern zu und öffnete die Tür zum Lavatory.
Es gab eine Dusche. Bount drehte sie auf, streifte schleunigst die Kleider ab, in denen das Giftgas hängen musste, und warf auch die Gasmaske zu ihnen in den Nebenraum. Der Detektiv stellte sich unter die Dusche. Er hatte die kalte erwischt, was seine Lebensgeister jedoch auch nicht auffrischte.
Bount wurde es schwarz vor Augen. Seine Sinne schwanden. Er spürte nicht mehr, wie er am Boden aufschlug.
Als er wieder erwachte, fand er sich in der Krankenstation des STI-Buildings wieder. Um Bount drängten sich Gestalten in unförmigen weißen ABC-Schutzanzügen, mit Visierhelmen, Atemgeräten und Handschuhen. Bount erhielt ein Mittel gespritzt. Er hing am Tropf und fühlte sich elend wie selten zuvor in seinem ganzen Leben.
Jeder Atemzug schmerzte und war mühsam. Zwei Werksärzte und eine Krankenschwester rollten ihn mit dem Bett, über das zeltähnlich an einer an einem aufragenden Stab befestigten Strebe eine Folie gebreitet wurde, zu den Fahrstühlen. Bount bäumte sich auf. Ein Arzt beruhigte ihn.
»Wir sind hier in einem anderen Teil des STI-Wolkenkratzers. Bei dem Fahrstuhl, mit dem wir Sie hinabbefördern, damit Sie mit der Ambulanz ins Hospital gebracht werden können, besteht keine Gefahr.«
»Ist das auch ganz sicher?«, fragte Bount.
»Natürlich.«
Die Fahrt abwärts verlief ohne Zwischenfälle. Die Ambulanz wartete schon. Sanitäter in weißen Schutzanzügen legten Bount im geräumten Foyer auf die Trage und verfrachteten ihn in die wartende Ambulanz. Mit Rotlicht und Sirenengeheul ging es zum McGill Medical Center, das der gleichnamigen Universität angeschlossen war. Dort wurde Bount auf der Intensivstation behandelt und danach in ein Zwei-Bett-Zimmer gebracht, das ihm jedoch allein zur Verfügung stand.
Jetzt hatte er zunächst einmal Ruhe, die er auch dringend brauchte. Bount fühlte sich sterbenselend. Die Mittel, die ihm gespritzt worden waren, und die Inhalationen und Spülungen, die man bei ihm vorgenommen hatte, setzten ihm zu.
Lange währte die Ruhe nicht. Captain Leclerc erschien, mit einem ABC-Schutzanzug bekleidet. Übers Kehlkopfmikrophon verstärkt, hörte Bount seine Worte.
»Mister Reiniger«, sagte der Leiter der Mordkommission in gut verständlichem Französisch, »jetzt glaube ich Ihnen auch, was Sie von der vergangenen Nacht erzählten. Wir haben es mit raffinierten und skrupellosen Gangstern zu tun.«
Bount krächzte schwer Verständliches. Leclerc beugte sich über ihn.
»Die Todesfalle im Fahrstuhl ist entschärft worden. Sie war so eingerichtet, dass sich das Gas im Lift konzentrierte und rasch verflüchtigte. Es gab einen Gasalarm für das gesamte STI-Building, der jedoch nicht hätte sein müssen. Doch sicher ist sicher. Inzwischen steht fest, dass für niemanden mehr eine Gefahr durch die Gaspatrone am Lift-Lüftungsschlitz besteht. Sie ist entfernt und unschädlich gemacht worden.«
»Warum tragen Sie dann einen ABC-Schutzanzug?«, fragte Bount mühsam.
»Weil wir bei Ihnen noch auf Nummer Sicher gehen müssen. Immerhin handelt es sich um ein Hautkontaktgift.«
Bount wollte noch sagen, man solle ihm eine Wache vor die Tür stellen. Doch ehe er das über die Lippen brachte, schwanden ihm wieder die Sinne.
Diesmal war es Nacht, als er erwachte. Nur die Notbeleuchtung brannte im Zwei-Bett-Zimmer, das durch eine Luftschleuse abgeschlossen und zudem als Quarantänestation eingerichtet war.
Ein Mann im ABC-Schutzanzug trat an sein Bett, eine aufgezogene Spritze in der Hand.
»Keine Sorge, Sie sind bald über den Berg«, sagte er beruhigend in Englisch. »Es besteht keine Lebensgefahr mehr. Ihr Zustand bessert sich zusehends. Ich spritze Ihnen noch ein Mittel, um die Wirkung des heimtückischen Gases abzubauen, von dem Sie zum Glück nur eine schwach konzentrierte Prise erwischten. Dass Sie zudem gleich duschten, hat Sie gerettet.«
Der Mann beugte sich über Bount. Der Detektiv spürte, wie er ihm mit einem alkoholgetränkten Wattebausch die Armbeuge reinigte. Gleich musste der Einstich der Nadel erfolgen.
»Ich bin Doktor Defferidge«, sagte der Mann im ABC-Schutzanzug.
Wie gelähmt sah Bount die Spritze. Er schaute dem angeblichen Arzt in die Augen hinterm schmalen Visier des luftdicht abschließenden Schutzhelms. Die Augen verrieten den Mörder. Sie waren fast farblos, ihr Blick starr. Es waren die Augen von Gaston Roudeaux, dem STI-Werkschutzleiter.
Bount bäumte sich auf. Die Spritze, die ihm zweifellos den Tod gebracht hätte, wäre ihr Inhalt in seine Blutbahn gelangt, ritzte ihm nur die Haut. Im linken Arm hatte Bount die Kanüle vom Tropf, an dem er noch immer hing. Schläuche führten durch seine Nase. Durch sie wurde der Schleim abgesaugt, der durch die Gaswirkung entstand und an dem Bount sonst erstickt wäre.
Der Privatdetektiv versetzte Roudeaux einen Hieb mit der Karatefaust. Der eisenharte STI-Werkschutzleiter zuckte nur unerheblich zusammen. Bount konnte sich kaum bewegen. Die Kanüle im Arm und die Schläuche in der Nase behinderten ihn.
Roudeaux rang ihn nieder. Er prügelte hemmungslos auf den verletzten Privatdetektiv ein. Bount erhielt einen Kinnhaken, der ihm den Kopf brummen ließ. Der Gangster hatte einen Schlag am Leib wie ein Boxmeister.
Während Bount benommen auf dem Bett lag, wollte ihm Roudeaux abermals die tödliche Spritze verpassen. Er hob sie vom Boden auf.
Bount zog sich die Kanüle aus dem Arm und stach zu, durch den weißen Schutzanzug.
Aufschreiend taumelte Roudeaux zurück. Da öffnete sich schmatzend die Luftschleusentür und blieb offen. Captain Leclerc – oder auch Capitaine – stand auf der Schwelle, hinter ihm einer seiner Beamten. Beide hielten den gezogenen Dienstrevolver in der Faust.
Sie trugen Zivilkleidung, also keinen Schutzanzug. Roudeaux erwies sich als Kunstschütze. Urplötzlich hielt er einen 38er Colt Diamondback in der Hand. Die kurzläufige Waffe bellte. Der Gangster schoss dem Captain und seinem Beamten die Schusswaffen aus der Hand.
Bount zog sich die Schläuche aus der Nase – die Kanüle war er schon los – und rollte sich vom Bett. Gerade noch rechtzeitig, denn Roudeaux, der ihn unbedingt erledigen wollte, feuerte auf das Bett. Die Kugeln schlugen in die Matratze, durchbohrten sie und blieben in der Wand stecken.
Einen Moment sah es aus, als ob Roudeaux um das Krankenbett herumlaufen wollte, hinter dem Bount sich mit blutender Nase verkroch. Beim Herausziehen der Absaugschläuche hatte er sich verletzt.
Doch dann ertönten Stimmen im Korridor. Roudeaux wusste nicht, ob nur Pflegepersonal herbeieilte, das er hätte in Schach halten können, oder weitere Kriminalbeamte. Er sprang durchs geschlossene Fenster, in seinem Schutzanzug.
Den Kopf eingezogen, den rechten Arm angewinkelt, flog er durch die zerberstende Scheibe, landete unten in den verschneiten Rotdornbüschen und rollte sich ab. Leclerc und der zweite Beamte hielten sich die geprellte Hand. Sie stürzten ans Fenster, an das auch Bount wankte. Das Blut lief dem Privatdetektiv übers Gesicht.
Bount sah, dass er sich im ersten Stock befand. Roudeaux hatte den Sturz gut überstanden und lief davon. Er hinterließ tiefe Fußstapfen im Schnee und verschwand in der Dunkelheit von Bäumen und Büschen im Krankenhauspark.
Leclerc fluchte auf Joual, dass eine hereinlaufende Krankenschwester errötete. Ein Arzt und ein Pfleger folgten ihr. Der Pfleger hob einen der Revolver auf, die Leclerc den Beamten aus der Hand geschossen hatte. Er reichte ihn dem hochgewachsenen Captain mit dem scharfgeschnittenen Gesicht. Leclerc mit seiner geprellten rechten Hand konnte das Schießeisen nur mit der Linken halten.
Links konnte er nur ganz miserabel schießen. Zudem war der Gangster im ABC-Schutzanzug ohnehin schon verschwunden. Man hörte vom Parkplatz einen Automotor aufbrummen. Dann geisterte Scheinwerferlicht durch die Büsche. Ein niedriger, PS-starker Sportwagen – der Umriss war nur einen Moment zu sehen – jagte davon. Die runden Stopplichter flammten auf, als der Fahrer bei der Ausfahrt auf die Bremse stieg.
Er fuhr sofort auf die Straße.
»Den holen wir nicht mehr ein«, schimpfte Leclerc.
Er schickte seinen Beamten ans Telefon, um sofort die Fahndung zu veranlassen. Bount sagte, der Killer im ABC-Schutzanzug sei Roudeaux gewesen. Leclerc wandte sich an ihn, als der Beamte hinausgelaufen war.
»Sind Sie schwer verletzt, Bount Reiniger?«
»Ich glaube nicht«, antwortete Bount.
Er musste sich in das unbenutzte Bett legen. Der Arzt und die Krankenschwester verarzteten ihn. Sie alle arbeiten ohne ABC-Schutzanzug. Bount wunderte sich.
»Bin ich nicht mehr so giftig?«, fragte er.
»Das Gas, dessen Opfer Sie wurden, wenn auch nicht in vollem Ausmaß, hat sich zersetzt«, klärte ihn der Arzt auf. »In zwei, drei Tagen können Sie schon wieder auf den Beinen sein. Ich glaube, Ihr Gesamtzustand ist recht gut. Aber wir müssen auf Nummer Sicher gehen und Vorsichtsmaßnahmen treffen.«
»Deshalb also der Tropf und die Schleimabsaugung?«
»Die Schleimabsonderung ist positiv, weil ihre Lungen Giftstoffe ausscheiden. Sie erhalten ein von der STI hergestelltes Mittel, das Ihre körpereigene Abwehr gegen das Giftgas stärkt. Wenn Sie hinschauen, werden Sie feststellen, dass die allergische Reizung Ihrer Haut bereits abgeklungen ist.«
Bount war nicht mehr krebsrot, noch brannte seine Haut. Ein Jucken wie von Nesselfieber spürte er noch. Zudem wies seine Haut Pusteln auf. Das Teufelszeug, mit dem er im Lift in Berührung gekommen war, hatte es in sich. Bount konnte sich glücklich schätzen, der Gefahr glimpflich entronnen zu sein. Seine rasche Reaktion und dass die Gangster bei der Einrichtung des Fahrstuhls als Todesfalle nicht die nötige Zeit und Ruhe gehabt hatten, hatte ihn gerettet.
Das Nasenbluten des Privatdetektivs hörte auf. Bount wollte bald wieder auf den Beinen stehen und seinen Fall aktiv weiterverfolgen. Den heimtückischen Anschlag von Roudeaux und Konsorten mit dem Gaskammer-Lift sollten sie ihm büßen.
»Weshalb haben Sie nicht eher eingegriffen?«, fragte Bount Captain Leclerc.
Es war halb drei Uhr früh, wie er auf seiner auf dem Nachttisch liegenden Armbanduhr sah.
»Wir hatten uns auf die Lauer gelegt«, gestand der Captain verlegen. »Doch es blieb alles ruhig. Deshalb sind wir in der Kantine einen Kaffee trinken gegangen.«
Da alles noch einmal glimpflich abgelaufen war, warf Bount den Beamten nichts vor. Dass er sich nicht mit Ruhm bekleckert hatte, wusste Leclerc selbst. Es wurmte ihn, dass ihm der Gangster entronnen war. Vorerst jedenfalls.
4.
Am folgenden Morgen erschien Gaston Roudeaux dreist im STI-Building, als ob nichts gewesen sei. Mitglieder seiner eigenen Sicherheitstruppe, des Werkschutzdienstes, nahmen ihn fest. Er wurde unter strenger Bewachung und mit Handschellen gefesselt ins Police Headquarters gebracht, wo ihn Captain Leclerc verhörte.
Roudeaux bestritt, in der vergangenen Nacht im McGill Medical Center gewesen zu sein. Er schwor Stein und Bein, Bount Reiniger würde ihn zu Unrecht beschuldigen und nannte zwei Zeuginnen, die seine Angaben bestätigen sollten.
Es handelte sich um im Stadtteil St. Laurent wohnende, 25 Jahre alte Zwillingsschwestern. Roudeaux, der geschieden war, gab an, die Nacht mit ihnen bei einem flotten Dreier verbracht zu haben. Die Zwillingsschwestern bestätigten das, als Leclerc sie von einem Streifenwagen ins Präsidium bringen ließ.
Der Leiter der Mordkommission Montreal I zog ein langes Gesicht. Der Killer hatte im Krankenzimmer Bount Reinigers keine Fingerabdrücke oder ähnlichen Spuren hinterlassen, durch die er hätte überführt werden können. Dass Bount Reiniger den Gangster mit der Kanüle angepiekt hatte, war kein Beweis. Roudeaux hatte zwar einen Einstich am Brustbein, doch er behauptete, er habe sich hier neulich mit einer Nähnadel selbst verletzt, als er über die Teppichkante gestolpert und hingefallen sei.
Die Tiefe des feinen Einstichs ließ sich nicht feststellen.
Leclerc betrachtete den STI-Werkschutzleiter mit schräggelegtem Kopf.
»Soll das ein Witz sein? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Sie behaupten allen Ernstes, Sie wären beim Sockenstopfen ausgerutscht und hätten sich mit der Nadel gestochen?«
»Ja«, log ihm Roudeaux frech ins Gesicht. »Das Telefon klingelte, und ich wollte rasch abheben. – Was schauen Sie so? Es sind schon Leute auf Bananenschalen ausgerutscht und haben sich tödlich verletzt.«
Leclerc bewahrte mühsam die Ruhe. Dank seines Alibis und der Erklärung für den Einstich zog sich Roudeaux aus der Affäre. Die Beweise reichten nicht, um ihn weiterhin festzuhalten. Der Captain musste ihn wohl oder übel auf freien Fuß setzen, was er mit undurchdringlicher Miene erledigte.
Roudeaux fuhr sofort mit der Metro zum STI-Wolkenkratzer. Du Martier bestellte ihn zu sich. Der grauhaarige, knochenharte Werksschutzleiter log auch ihm vor, dass er unschuldig sei und alles daran setzen wollte, die bei der STI geschehenen Verbrechen aufzuklären.
»Geben Sie mir die Chance, Sir«, bat der einsachtzig große, bärenstarke Sicherheitschef und Werkschutzleiter. »Seit zehn Jahren arbeite ich in meiner Position mit besten Ergebnissen für den Konzern. – Haben Sie jemals Grund gehabt, sich über mich zu beklagen?«
»Das nicht«, sagte du Martier im Konferenzzimmer, in dem außer ihm noch vier weitere STI-Mitarbeiter und Security Guards anwesend waren. »Aber Bount Reiniger behauptete, Sie seien es gewesen, der in der vergangenen Nacht versucht hätte, ihn umzubringen.«
»Ich bin von der Mordkommission auf freien Fuß gesetzt worden. Reiniger wurde, wie ich dort erfuhr, von einem Mann im ABC-Schutzanzug mit geschlossenem Helm angegriffen. Nur an meinen Augen, die er angeblich durchs schmale Helmvisier sah, will er mich erkannt haben. Er irrt sich, oder er ist verrückt. Captain Leclerc, der den betreffenden Killer ebenfalls sah, konnte mich nicht als diesen identifizieren. Kein Wunder, denn ich bin es nicht gewesen. – Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort.«
Der Aufsichtsratsvorsitzende senkte den Kopf. Roudeaux spürte, dass er nachgeben würde.
»Gut. Reiniger mag sich geirrt haben. Doch die Tatsache bleibt bestehen, dass es in Ihrem Aufgabenbereich, dem Sicherheitsdienst und Werksschutz, ganz erhebliche Pannen gab. Sie führten zum Tod dreier Menschen, nämlich Doktor Addams, Melly Purcell und einem Wachmann. Außerdem wurde ein Fahrstuhl zu einer Todesfalle umgebaut, was Sie und Ihre Leute nicht verhindern konnten, ja. erst bemerkten, als diese Falle schon zuschnappte. Das verursachte eine Menge Aufregung im Haus, gab einen Gasalarm und eine Räumung des gesamten STI-Buildings von allen Mitarbeitern, soweit sie keine Schutzanzüge und Gasmasken trugen. – Jemand in Ihrer Position, der auf so krasse Weise versagt, können wir uns nicht leisten.«
Roudeaux stand stramm, wie er es beim Militär gelernt hatte, wo er jahrelang Berufssoldat gewesen war. Von seinem Offiziersrang war er nach zwanzigjähriger Dienstzeit – er hatte sich schon mit achtzehn zur Armee gemeldet – als Sicherheitschef zur STI übergewechselt.
»Sir, hier sind äußerst raffinierte und gefährliche Gangster am Werk. Gerade deshalb brauchen Sie mich. Sonst ist hier alles verloren. Geben Sie mir die Chance, die Verbrecher zu entlarven, die sich frech bei der STI eingeschlichen haben. Ich betrachte das, was geschehen ist, als eine persönliche Herausforderung. Wenn ich meine Aufgabe erfolgreich gelöst habe, können Sie mich entlassen, oder wir trennen uns in beiderseitigem Einvernehmen. Doch die Schande, dass sich in meinem Ressort trotz größter Sorgfalt solche Verbrechen ereignen konnten, kann ich nicht auf mir sitzen lassen. – Bitte, Sir. Sie schaden sich selbst und dem Konzern, wenn Sie mich entfernen.«
Roudeaux brachte das so überzeugend vor, dass du Martier sagte: »Also gut. Sie sollen die Möglichkeit haben, Ihre Fehler und Versäumnisse, soweit Sie Ihnen anzulasten sind, wiedergutzumachen. Ob wir Sie danach weiter behalten können, kann ich Ihnen jetzt noch nicht versprechen.«
Der Chairman war unsicher. Bount Reiniger, gesundheitlich angeschlagen, konnte sich bei der Identifizierung durchaus getäuscht haben. Roudeaux bedankte sich für die ihm eingeräumte Chance. Er würde sie auf seine Weise nutzen ...
*
Als er hörte, dass der Verbrecher Roudeaux frei herumlief und nicht einmal seines Postens als STI-Werkschutzleiter enthoben war, hielt es Bount nicht länger im Krankenbett. Auf eigene Verantwortung verließ er das Medical Center. Die Ärzte gaben ihm eine Menge Empfehlungen und Warnungen mit auf den Weg. Selbst eine Erkältung oder ein Schnupfen könnten für ihn schon äußerst gefährlich sein und zu einer Lungenentzündung führen, hörte Bount.
Er durfte nicht rauchen und sollte verräucherte Räume sowie verschmutzte Luft meiden. Einmal am Tag sollte er Sauerstoff inhalieren, wozu es einen Inhalator gab, zudem bestimmte Essenzen. Bount merkte sich alles. Mit dem Inhalator, Arzneien und Sauerstoffpatronen in der Tasche fuhr er zum »Ritz Carlton Hotel«. Dort fand er vollständig vor, was er mit nach Kanada gebracht hatte – seine 38er Automatic, den Koffer mit der Detektivausrüstung, die von Luminalspray zum Entdecken von Blutspuren bis hin zu einem Set zur Sicherung von Fingerabdrücken alles enthielt. Bount inhalierte erst mal und fuhr dann per Taxi zum STI-Building. Er traf Roudeaux bei Vernehmungen der Haustechniker an, die auch für die Fahrstühle zuständig waren.
Der Sicherheitschef verzog keine Miene, als er den Privatdetektiv erblickte.
»Geht's Ihnen wieder gut, Mister Reiniger?«, fragte er scheinheilig. »Scheußliche Geschichte, die Ihnen da passiert ist.«
»Ja«, erwiderte Bount. »Scheußliche Geschichte und scheußliche Leute. Wie geht's Ihnen, Monsieur Roudeaux?«
»Mittelprächtig. Kann ich Sie einen Moment allein sprechen?«
»Wenn Sie nicht wieder versuchen, mir eine Giftspritze zu verpassen.«
»Aber ich bitte Sie, Mister Reiniger. Sie haben jemand mit mir verwechselt. Ich verfüge über ein erstklassiges Alibi.«
»Natürlich. Zwei Nutten, die jedermann kaufen kann, haben es Ihnen gegeben.«
Roudeaux' linkes Lid zuckte. Im obersten Stock des STI-Wolkenkratzers, bei den Maschinen und Versorgungsanlagen, wo die Techniker zu tun hatten, nahm Roudeaux Bount Reiniger zur Seite. Er musterte den Privatdetektiv feindselig. Als niemand mehr zuhörte, ließ er die Maske fallen.
»Du bist zweimal davongekommen, Reiniger. Beim dritten Mal schaffst du es nicht. Dann bist du fällig, es sei denn, du lässt es erst gar nicht dazu kommen.«
Die Exhaustoren, Entlüfter, die zur Klimaanlage gehörten, brummten. Zahlreiche Schaltkästen waren in Reihe und Glied auf dieser Versorgungsetage angeordnet. Boden und Wände bestanden aus nacktem Beton, im Gegensatz zu den daruntergelegenen Stockwerken mit den Direktionsetagen, Büros und Labors.
»Ich soll verschwinden, wie?«, fragte Bount.
»Ja«, sagte Roudeaux. »Geh hin, wo du hergekommen bist. Oder der Teufel wird dich holen. Gegen uns kommst du sowieso nicht an. Die Ecstasy Connection ist stärker als du.«
»Weshalb habt ihr Doktor Addams und Melly Purcell umgebracht? Du hast ihnen die Droge in der kritischen Dosis in den Kaffee geschüttet.«
Roudeaux legte jedoch kein detailliertes Geständnis ab.
»Sie waren fällig«, sagte er nur. »Genauso, wie du fällig bist, wenn du bleibst.«
»Wer ist die Frau, die mich als Ann Jepsen verkleidet an der Nase herumführte? Und wer hat die echte Ann Jepsen ermordet? Sie ermittelte wegen der Drogengeschichte und hatte eine heiße Spur.«
»Für jemand, der sich kaum auf den Beinen halten kann, stellst du verdammt viele Fragen.«
Roudeaux boxte Bount spielerisch gegen die Brust. Bount Reiniger, von dem Gas noch geschwächt, taumelte gegen einen Exhaustor. Der Sicherheitschef lachte ihn aus. Bount zog seine Pistole und zielte auf ihn. Abrupt blieb Roudeaux stehen.
»Du wirst nicht abdrücken«, sagte er. »Das wäre Mord.«
»Du wolltest mich auch ermorden«, erwiderte Bount. »Du bist ein Gangster. Wen hast du schon alles auf deinem Gewissen?« Er senkte die Waffe. »Wenn du mich noch mal anfasst, bist du ein toter Mann. Ich bleibe, Roudeaux, und ich kriege dich. Du fliegst mit der gesamten Ecstasy Connection auf. Ein seltsamer Name ist das für eine Verbrecherorganisation.«
»Uns ist er gut genug. Wem nicht zu raten ist, ist nicht zu helfen. Ich werde dir einen Kranz stiften, Reiniger.«
Die beiden Männer wussten, was sie voneinander zu halten hatten. Bount behielt die Pistole schussbereit, bis Roudeaux sich entfernt hatte. Bount Reiniger achtete strikt darauf, dass ihm der Sicherheitschef nicht zu nahe auf den Leib rückte. Er traute Roudeaux alles zu, auch, dass er ihn selbst vor Zeugen mit einem Giftdorn oder einem mit Curare präparierten Messer oder auf andere raffinierte Weise killte. Roudeaux hatte Komplizen im STI-Building und wohl auch noch im Werk in Montreal Nord.
Bount versuchte, die Gangster zu entlarven, die den Lift, mit dem er fuhr, in eine Todesfalle verwandelt hatten. Es mussten welche von den Haustechnikern sein, was auch die Mordkommission wusste, die jedoch noch niemand hatte entlarven können.
Es gab insgesamt 36 Fahrstühle im Haus. Die Frage war, wie die Gangster hatten wissen können, in welchen Bount einsteigen würde. Bount Reiniger hatte jeweils verschiedene Fahrstühle benutzt, nicht absichtlich, indem er strikt darauf achtete, den Fahrstuhl zu wechseln, sondern wie es sich eben ergab.
Bount dachte nach und kam darauf, dass er zwei Fahrstühle besonders oft benutzt hatte, der Einfachheit halber und weil er, wie alle Menschen, irgendwo doch ein Gewohnheitstier war. Gezielt erkundigte er sich und stieß auf den Techniker Dobie, einen dicken, jovialen Mann. Diesen Dobie stellte er im Werkstattraum neben den Versorgungsanlagen im Keller, wo Dobie gerade an einer Drehbank ein Zahnrad zurechtschliff.
In einem Wolkenkratzer wie dem STI-Building gab es etliche Maschinen und Geräte – Gebläse für die Fernheizung, eine Umwälzanlage, Klima- und Sprinkleranlage, Aufzugsmotoren und so fort. Zudem die Leitungen und Anschlüsse für die Vernetzung der Kommunikationsgeräte und Rechner, die bis auf wenige PCs alle an einem Zentralrechner hingen.
Das STI-Building mit seinen zahlreichen Leitungen, Lüftungsschächten und so weiter war sozusagen auch eine riesige Wohn- und Arbeitsmaschine. Sie musste gewartet und instand gehalten werden.
Dobie grinste Bount entgegen.
»Hey, Mister Reiniger, haben Sie endlich die Mörder gefunden? Diejenigen, die dem armen Doktor Addams und Melly Purcell die Droge in den Kaffee mischten?«
»Woher wissen Sie das?«
»Ich bitte Sie, hier bleibt nichts geheim. Wie bekommt Ihnen das Fahrstuhlfahren? Es verschlägt einem den Atem, wie?«
Dobie lachte laut heraus und wollte Bount auf die Schulter schlagen. Obwohl er noch körperlich mitgenommen war, wich der Detektiv aus und verdrehte dem Techniker im Overall mit dem STI-Emblem auf der Brust den Arm. Dobie stürzte zu Boden und rieb sich die Schulter. Prüfend bewegte er seinen Arm.
»Sind Sie des Teufels? Ich habe ja nur einen Witz gemacht.«
»Ihr Pech«, sagte Bount Reiniger. »Ich bin ein sehr ernster Mensch. Spaß kann ich nicht vertragen. Mein besonderes Hobby ist es, zu Beerdigungen zu gehen. Auf den New Yorker Friedhöfen könnte ich mich tagelang aufhalten.«
Dobie wusste nicht, ob er auf den Arm genommen wurde oder nicht. Er stand wieder auf.
»Lassen Sie die Sprüche. Was wollen Sie von mir wissen?«
»Sie sind für die Wartung der Fahrstühle E vier und fünf zuständig?«
»Ja, unter anderem. In dem E vier wären Sie fast ums Leben gekommen.« E stand für Express, also einen Elevator, der nur alle zehn Etagen hielt. »Ich hatte den Fahrstuhl am Vortag noch überprüft. Da war er okay.«
»Bei der Überprüfung haben Sie ihn in eine tödliche Falle verwandelt. Sogar eine Filmkamera wurde installiert, zweifellos weil gewisse Leute sehen wollten, wie ich starb. Und natürlich um festzustellen, dass auch der Richtige, nämlich ich, und möglichst allein in dem Fahrstuhl ist.« Dobie stutzte. »Das können Sie nicht beweisen.« »Außer Ihnen hatte keiner Gelegenheit dazu.« »Das ist nicht wahr.« »Doch. Kommen Sie mit. Sie sind verhaltet.« Bount zog seine Pistole. »Nur wenn Sie als Kronzeuge auspacken, können Sie noch davonkommen. Roudeaux hat Ihnen den Auftrag gegeben.«
Der Techniker zögerte. Er war sichtlich erschrocken. Dann schaute er über Bounts Schulter weg. Seine verkrampfte Miene lockerte sich auf.
»Da steht einer hinter Ihnen und hat den Finger am Drücker, Reiniger«, sagte er in Englisch wie zuvor.
»Haha«, sagte Bount zu dem Witzbold.
»Nix haha«, hörte er die Stimme eines jungen Manns hinter sich. »Lass die Knarre fallen«, sagte er mit Montrealer Akzent, aber im Chicagoer Slang. »Oder du bist eine Leiche.«
Bount warf einen Blick über die Schulter. Hinter ihm stand ein langaufgeschossener junger Mann mit einem Viertel Indianerblut in den Adern. Auch er trug den Technikeroverall, konnte jedoch in seinem Beruf kaum ausgelernt haben. Im Umgang mit der Waffe hatte er es. Er hielt genügend Abstand, dass Bount nicht herumwirbeln und ihm sein Schießeisen mit einer raschen Bewegung aus der Hand fegen konnte.
»Wenn du schießt, seid ihr dran«, sagte Bount zu dem Jüngling. »Der Schuss wird gehört, meine Leiche gefunden. Wie wollt ihr euch da herausreden?«
»Gar nicht.« Dobie lachte. Er hatte wieder Oberwasser. »Wir verschwinden.«
»Wirfst du jetzt endlich das Schießeisen weg?«, fragte der Bewaffnete Bount.
Der Detektiv musste gehorchen. So hatte er immerhin noch eine Gnadenfrist. Andernfalls hätte er sofort eine Kugel in den Rücken erhalten. Bount Reiniger hob die Hände.
»Was fangen wir mit ihm an, George?«, fragte der Viertelindianer Dobie.
»Wir bringen ihn rüber zur Warmwasseraufbereitung. Da wird er so schnell nicht gefunden.«
Dobie befahl Bount, zur Seite zu gehen, und hob seine Pistole auf. Von zwei Schusswaffen bedroht, musste Bount vor den beiden Gangstern her durch die Werkstatt gehen. Er hatte zwei Feuerschutztüren zu öffnen und gelangte in den Raum mit den Heißwasserkesseln. Durchlauferhitzer waren hier nicht gefragt. Das heiße Wasser zirkulierte jeweils durch ein Rohrsystem durch die Stockwerke und konnte abgezapft werden.
Umwälzanlagen und Aggregate lieferten die Geräuschkulisse.
»Da rüber an die Wand!«, schrie Dobie, damit Bount ihn verstand.
Bount sah Rohrleitungen mit Ventilen vor sich. Er drückte sich um einen Heißwasserkessel herum, der sich nach oben verjüngte und von dem ein Kupferrohr in die Decke führte.
Der Detektiv schaute über die Schulter und las den beiden Verbrechern in Monteuroveralls von den Lippen ab.
»Sollen wir Gaston verständigen?«, fragte der junge Mann.
»Wozu?«, fragte Dobie. »Ich schlage dem Schnüffler den Schädel ein, und wir legen ihn dort hinter die Kessel. So schnell findet ihn keiner.«
Er nahm eine lange, schwere Rohrzange aus einer Werkzeugkiste und näherte sich Bount, der mit erhobenen Händen dastand. Dobie hatte die Pistole in den Hosenbund gesteckt. Er hielt die Rohrzange mit beiden Händen und holte weit aus.
Der Viertelindianer hielt Bount nach wie vor mit der Waffe in Schach.
Bount ergriff einen roten Hebel. Vorsicht, Heißdampf, steht unter Druck! stand auf dem Schild daran.
Alles geschah blitzschnell. Bounts Hand am Hebel war durch die Rohre verdeckt. Der Hebel war durch einen dünnen Draht mit einer Plombe gesichert, damit keiner aus Versehen damit spielte.
Bount Reiniger riss den Hebel herum. Dampf schoss fauchend aus dem Druckentlüfterventil. Der Detektiv tauchte unter dem Heißdampf weg, gerade als Dobie mit aller Wucht zuschlug. Die Rohrzange klirrte gegen die Rohre.
Dobie schrie auf. Sein Gesicht sah aus wie ein gesottener Krebs. Der Verbrecher ließ die Rohrzange fallen, hielt sich die Hände vor die Augen und stöhnte und wimmerte. Bount packte die Rohrzange. Der Viertelindianer war überrascht und geschockt. Der Dampf verhüllte Bount, der die Rohrzange warf.
Sie traf den Viertelindianer voll am Kopf. Bount sprang hinter dem Kessel vor, entriss dem Gangster die Pistole und schlug dem ohnehin Angeknockten ihren Griff über den Schädel. Dann zog er Dobie, der wimmernd am Boden kauerte, von den Dampfwolken weg.
Der Techniker war zweifellos schwer verletzt. Bount schüttelte Dobie.
»Roudeaux war dein Auftraggeber für die Giftgasfalle. Gesteh es. Du hast zwei Fahrstühle zu Gaskammern und Todesfallen umgebaut, mich über die Kamera beobachtet, als ich den Lift betrat, den Lift gestoppt und das Gas ausströmen lassen. – Sag die Wahrheit!«
»Ja, ja, oh, ja!« Dobie gab Schmerzenslaute von sich. »Oh, Jesus, das schmerzt! Ich bin blind! Meine Augen!«
Bount nahm ihm für alle Fälle die Pistole weg, überzeugte sich, dass sein jugendlicher Komplize so schnell nicht aufstehen würde und führte Dobie zu einem Kaltwasserhahn. Dort sollte der Gangster seine Verbrühungen kühlen. Bount lief aus dem Kellertrakt hoch und alarmierte Arzt, Sanitäter und Polizei. Dann machte er sich auf die Suche nach Gaston Roudeaux.
Über das Walkie-Talkie, das ihm ein Beamter der Mordkommission in die Hand gedrückt hatte, erreichte ihn eine Meldung.
»Roudeaux hat du Martier als Geisel genommen und verlangt einen Hubschrauber zur Flucht! Er ist oben am Dachausstieg.«
Diesmal konnte er nicht so schnell hoch aufs Dach wie am Vortag, als Melly Purcell oben auf der Kante gestanden hatte. Bounts angegriffener Zustand behinderte ihn. Seine Lungen schmerzten und pfiffen. Trotzdem gelangte er rasch zu dem Ort, wo sich der STI-Sicherheitsleiter mit seiner Geisel, dem Chairman, aufhielt.
*
Ein Scharfschütze war nicht einsetzbar. Roudeaux setzte seinen Willen durch. Ein Werkshubschrauber des Science & Technical Incorporated-Konzerns brummte aus dem dichten Schneetreiben herbei. Der Werkspilot in dem Zweisitzer landete auf dem Dach, stieg aus, stellte sich an den Rand und hob die Hände. In seiner gefütterten Thermokombination mit Kapuze und Schneebrille sah er aus wie ein Eskimo.
Roudeaux hielt den kleinen Chairman im Nadelstreifenanzug als Kugelschutz vor sich. Geduckt lief er übers Dach und zwang du Martier, zuerst einzusteigen. Der Chairman musste auf dem Pilotensitz Platz nehmen, der dem Ausstieg zugewandt war. Der Werksschutzleiter klemmte sich auf den Copilotensitz.
Bount spähte, die Pistole in der Faust, aus der Tür.
Captain Leclerc stand neben ihm und schimpfte, was in Joual wie im klassischen Französisch die gleiche Bedeutung hatte: »Merde!«
»Kann du Martier einen Hubschrauber fliegen?«, fragte Bount den Leiter der Mordkommission Montreal I.
»Soweit ich weiß, nein! Roudeaux wird ihn vom Copilotensitz aus steuern, der alle Bedienungselemente komplett hat. Doch weit werden die beiden nicht kommen. Die Tankanzeige steht zwar auf voll. Doch der Copter hat nur Sprit für ein paar Meilen.«
»Was geschieht dann?«
»Die Anzeige fällt abrupt zurück, und Roudeaux muss landen. So leicht entkommt er uns nicht.«
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2022
- ISBN (ePUB)
- 9783738966312
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (Oktober)
- Schlagworte
- bount reiniger sumpf verbrechens york detectives sammelband krimis