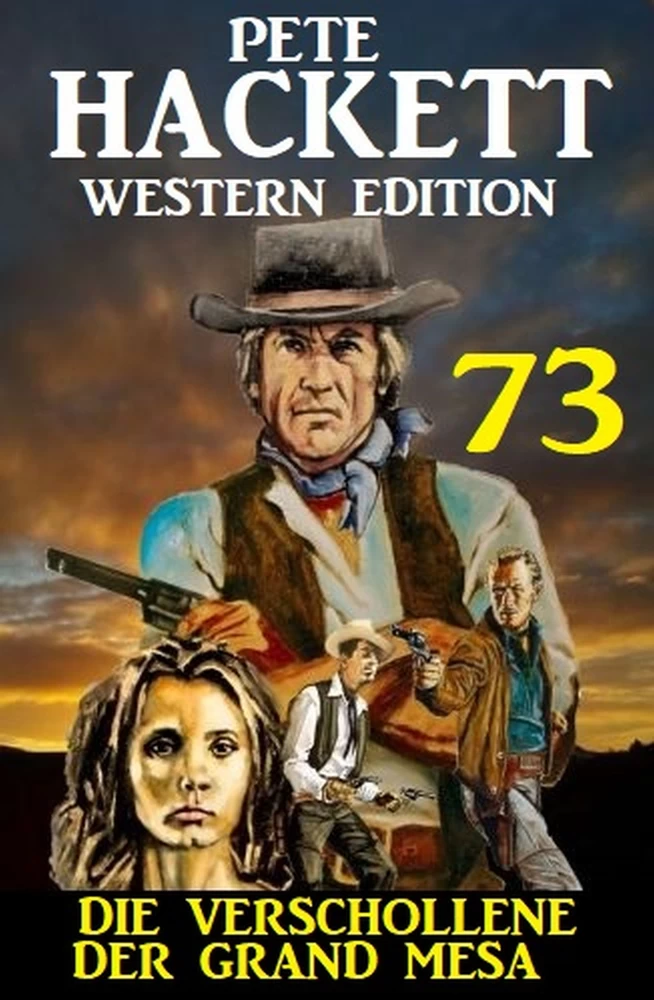Zusammenfassung
Zwei der Reiter sprangen von den Pferden und hetzten zum Eingang der Bank. Einer von ihnen trug leere Satteltaschen. Der andere klinkte die Tür auf, und dann verschwanden die beiden im Schalterraum. Der Kassierer saß wie erstarrt hinter seinem Tresen, seine Augen waren schreckensweit. Ein Kunde hob automatisch die Hände.
„Das ist ein Überfall!", brüllte einer der beiden Eindringlinge scharf und fuchtelte wild mit dem Colt herum. Der andere schleuderte die Satteltaschen auf den Tresen und schnarrte: „Alles einpacken! Auch das Hartgeld!"
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
Die Verschollene der Grand Mesa: Pete Hackett Western Edition 73
Western von Pete Hackett
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war - eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung."
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress.
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author www.Haberl-Peter.de
© der Digitalausgabe 2013 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Der hämmernde Hufschlag rollte dem Reiterpulk voraus wie ein Gruß aus der Hölle. Auf den Gehsteigen blieben die Passanten stehen und richteten ihre Blicke nach Süden. Über dem westlichen Horizont glühte der Himmel im Abendrot. Die Reiter tauchten auf. Es waren fünf. Die Hufe ihrer Pferde wirbelten eine dichte Staubwolke auf. Trotzdem war zu sehen, dass in ihren Fäusten die Revolver lagen. In wilder Karriere stoben sie die Main Street hinunter und feuerten nach allen Seiten. Dann rissen sie vor der Bank ihre Pferde zurück. Die Menschen auf den Gehsteigen ergriffen die Flucht. Ein furchtbares Drama hatte seinen Anfang genommen ...
Zwei der Reiter sprangen von den Pferden und hetzten zum Eingang der Bank. Einer von ihnen trug leere Satteltaschen. Der andere klinkte die Tür auf, und dann verschwanden die beiden im Schalterraum. Der Kassierer saß wie erstarrt hinter seinem Tresen, seine Augen waren schreckensweit. Ein Kunde hob automatisch die Hände.
„Das ist ein Überfall!", brüllte einer der beiden Eindringlinge scharf und fuchtelte wild mit dem Colt herum. Der andere schleuderte die Satteltaschen auf den Tresen und schnarrte: „Alles einpacken! Auch das Hartgeld!"
Die drei anderen Outlaws trieben auf der Straße ihre Pferde hin und her. Wachsame Blicke tasteten über die Fassaden der Häuser, bohrten sich in Gassen und Seitenstraßen, schnellten die Straße hinauf und hinunter. Wie hineingeschmiedet lagen in ihren sehnigen Fäusten die Colts. Die Pferdehufe rissen Staubfontänen in die noch immer heiße Luft. Die Fahrbahn war wie leer gefegt. Den Bürgern von Conejos saß die Angst wie eine Klammer im Nacken.
In der Bank flog die Tür zum Office des Bankiers auf. Der große, schwergewichtige Mann erschien bleich und mit einer Shotgun bewaffnet im Rechteck. Der Mut der Verzweiflung trieb ihn.
Ein Schuss krachte, der Bau schien in seinen Fundamenten zu erbeben. Pulverdampf wallte auseinander. Der Bankier erhielt einen grausamen Schlag gegen die Brust, wurde zurückgestoßen und brach zusammen.
Der Bandit, der die Satteltaschen getragen hatte, trieb den Kassierer zur Eile. Mit fliegenden Fingern und in kalten Angstschweiß gebadet stopfte der Mann die Noten in die Taschen. Hartgeld klimperte.
„Verschwinden wir!", rief der Bursche, der eiskalt geschossen hatte, drängend. Sein Colt war auf den Bankkunden gerichtet. Der Mann zitterte wie Espenlaub, in seinen Zügen zuckten die Muskeln, in seinen Augen flackerte die grenzenlose Todesangst.
Der andere Bandit riss dem Kassierer die Satteltaschen aus der Hand und warnte: „Wer seine Nase zur Tür hinausstreckt, wird erschossen."
Die beiden Kerle stürzten aus der Bank, warfen sich auf ihre Pferde, und wieder krachten die Colts. Fensterscheiben klirrten, Holz splitterte. Die Pferde streckten sich. In Richtung Norden stob die Bande aus der Stadt. Bald markierte nur noch der aufgewirbelte Staub ihren Weg. Der Hufschlag verklang.
Keine fünf Minuten hatte der Überfall gedauert. Das Verhängnis hatte die friedliche, ruhige Stadt im Süden Colorados heimgesucht. In der Bank lag ein Toter. Die Menschen waren vor Furcht wie gelähmt ...
Als es fast dunkel war, kehrte Sheriff Hank McLowry in die Stadt zurück. Er hatte sich in Antonito befunden, einer kleinen Stadt weiter östlich, die zu seinem Distrikt gehörte und in der er nach dem Rechten sah.
Er legte den Augenzeugen des Überfalls die Steckbriefe vor, die seit langem in seiner Schreibtischschublade vergilbten. Und wenig später wusste er, dass es sich um John Prewitts Bande gehandelt hatte, die seiner Stadt einen höllischen Besuch abgestattet hatte.
John Prewitt und seine Banditen wurden in allen Staaten des Südwestens gesucht. Sie hatten eine blutige Fährte durch New Mexiko, Arizona, Nevada und sogar Westtexas gezogen. Überfälle und Morde gingen auf ihr Konto. Und jetzt schien es, dass sie ihren Wirkungsbereich nach Colorado verlegt hatten.
Der Sheriff stellte eine Posse auf die Beine. Ein Dutzend ergrimmter Männer ritten auf der Fährte der Bande.
*
Als der Morgen graute, hatte die Bande vierzig Meilen zurückgelegt. Sie befand sich östlich von Monte Vista. Ihre Pferde röchelten und röhrten, die Flanken der Tiere zitterten. Sie waren völlig verausgabt und am Ende. Schaum tropfte von ihren geblähten Nüstern.
Das Rudel verharrte am Rande einer Senke. Vor ihnen lagen die dunklen Gebäude einer kleinen Ranch. Über dem kleinen Fluss in der Nähe hingen Nebelfetzen. Ein sachter Wind raschelte im Blattwerk der Büsche und Bäume. Eine heisere Stimme rasselte: „Da können wir sicher unsere abgetriebenen Gäule gegen frische auswechseln. Also reiten wir hin."
Sie verhielten zwischen den Hügeln, die die Ebene säumten. Von den Ranchgebäuden waren nur die Konturen durch die sich lichtende Dunkelheit wahrzunehmen. Die Menschen, die dort lebten, waren ahnungslos.
„Adelante!", stieß einer der Kerle mit hartem Akzent hervor, "Worauf warten wir?"
Sie zogen wie auf ein geheimes Kommando ihre Colts. Dumpf pochte der Hufschlag, als sie sich der Ranch näherten. Plötzlich schlug der Hofhund an. Eine Kette klirrte. Der Hund bellte wie verrückt, weithin hallten die Laute. Unwillkürlich parierten die Banditen. Ihre Pferde wurden nervös, prusteten und tänzelten auf der Stelle.
Das Kläffen des Hundes wurde immer wütender. Das Tier zerrte an der Kette. Die Tür des Ranchhauses flog auf. Eine schlaftrunkene Stimme schrie: „Zum Satan mit dir, Silver, willst du wohl ..."
Eines der Banditenpferde wieherte. Und jetzt sah der Mann auf der Ranch die Reiterschemen. Er brüllte, als er seinen Schreck überwunden hatte: "Vater, Lance - Reiter!" Er wollte sich herumwerfen, um ins Haus zu gelangen.
Schüsse peitschten. Die Wucht der Geschosse schleuderte den Mann gegen den Türstock, an dem er sterbend zu Boden rutschte. Eine zweite Salve aus den Colts der Outlaws ließ den Hund verstummen. Bei zwei Fenstern flogen die Blendläden auf. Gewehre peitschten, einer der Banditengäule brach zusammen. Der Reiter konnte gerade noch die Steigbügel von den Füßen schütteln und sich mit einem mächtigen Sprung vor den keilenden Hufen des Tieres retten.
Die Banditen hatten ihre Pferde auseinandergetrieben. Eiskalt feuerten sie auf die züngelnden Mundungsblitze in den beiden Fenstern. Ein gellender, jäh ersterbender Aufschrei vermischte sich mit dem Hämmern der Schüsse. Und plötzlich zuckte kein Mündungsfeuer mehr aus den Fenstern. Die geisterhaften Lichtreflexe, die über die Wände und den Hof gehuscht waren, erloschen. Wogender Pulverqualm trieb nebelhaft im Morgenwind davon.
Einer der Banditen knirschte: „Mich hat es am Arm erwischt. O verdammt ..."
„Schling dein Halstuch um die Wunde", riet ihm ein anderer und saß, dem Beispiel seiner Kumpane folgend, ab. Mit schussbereiten Waffen näherten sie sich in auseinander gezogener Linie dem Haupthaus. Im Pferdestall krachte und polterte es, als die Hufe der erschreckten Tiere gegen Stall- und Boxenwände donnerten.
Im Haus blieb es still. Bei dem Toten unter der Tür riss einer der Outlaws ein Streichholz an und leuchtete in das erstarrte Gesicht. Die kleine Flamme erlosch, der Bandit stieg über den Leichnam hinweg und tastete sich durch einen dunklen Korridor. Zwei seiner Gefährten folgten, während die beiden anderen draußen aufpassten. Wieder flammte ein Streichholz auf. Hinter einer Tür ertönte ein jämmerliches Schluchzen. Der Bandit, der ihr am nächsten stand, stieß sie auf, sprang sofort zur Seite und schmiegte sich an die Wand.
Der Schuss blieb aus. Nur das Schluchzen oder Weinen wurde deutlicher. Der Bursche glitt in den Raum. Hier war die Dunkelheit nicht so dicht, denn durch das zerschossene Fenster fiel das Morgengrau. Am Boden lag lang ausgestreckt ein Mann. Eine Frau kniete bei ihm und hatte seinen Kopf in ihren Schoß gebettet. Sie strich ihm unablässig über das Haar und ließ ihrem Schmerz, ihrer inneren Qual, freien Lauf.
„Sieh in dem anderen Raum nach, Carlos!", sagte der Bandit und riss ein drittes Streichholz an, in dessen vagem Licht er eine Lampe auf einer Anrichte ausmachte, die er anzündete. Der Lichtschein kroch in die Ecken, umriss die Gestalten auf dem Boden, ließ das blonde Haar der Frau wie reifen Weizen leuchten, und warf riesige, verzerrte Schatten über das Mobiliar und gegen die Wände.
Aus tränennassen Augen schaute die Frau dem Banditen ins Gesicht. Sie war hübsch. Jetzt aber prägte das namenlose Grauen ihre Züge. Ihre Lippen zitterten, ihre Nasenflügel bebten.
Der dritte Bandit war neben der Tür stehen geblieben. Seine Augen glommen gierig beim Anblick der hübschen Frau, die höchstens Mitte Zwanzig war. Für den Mann, der wie tot auf den groben Dielen lag, hatte er keinen Blick übrig.
Carlos, der Mexikaner, kam herein. „Drüben liegt ein älterer Hombre", erklärte er ungerührt. „Er ist tot."
Der Bandit mit der Laterne trat vor die Frau hin. „Gibt es noch mehr Männer auf der Ranch?", fragte er drohend.
Verstört, als hätte sie seine Frage nicht begriffen, starrte sie ihn an. Erschütterung, Schreck, Schmerz und Angst verschlossen ihr die zuckenden Lippen.
Der Bandit zerrte sie in die Höhe. Sein heißer Atem streifte ihr Gesicht. Sie wollte in jäher Panik zurückweichen, aber er hielt sie mit stählernem Griff fest. Sein Gesicht war ganz dicht vor dem ihren. „Gibt es außer den dreien sonst noch Männer auf dieser Ranch?", schnappte er ungeduldig.
„Nein", löste es sich von ihren Lippen. Sie flüsterte mit brüchiger Stimme: „Nur meinen Mann, seinen Vater und seinen Bruder. Ihr - habt - sie - ermordet."
Plötzlich verlor sie die Besinnung. Das alles war zu viel für sie, überstieg ihr Begriffsvermögen und drohte ihr den Verstand zu rauben. Hart fiel sie auf den Boden.
Der Bandit mit der Laterne sagte heiser: „Wir nehmen sie mit. Sie gefällt mir. Ich werde ihr helfen, über den schmerzlichen Verlust hinwegzukommen." Zuletzt klang seine Stimme wie von einer wilden Vorfreude erfüllt. Der Zynismus des Banditen war nicht zu überbieten. „Sattelt frische Gäule. Und dann sehen wir zu, dass wir weiterkommen."
*
Als das Aufgebot aus Conejos die Ranch erreichte, war es heller Vormittag. Im Ranchhof lagen ein totes Pferd und ein toter Schäferhund. Vier verstaubte Pferde standen am Flussufer und weideten. Vor der Tür des Haupthauses lag ein blutüberströmter Mann. Er war höchstens Anfang Zwanzig. Seine Augen waren noch im Tod schreckensweit aufgerissen.
Die Männer des Aufgebotes schluckten trocken. Mit Hilfe von Fackeln waren sie der Fährte der Bande gefolgt.
„Sicher versorgten sie sich hier mit frischen Pferden", gab Sheriff Hank McLowry rau zu verstehen. „Sehen wir mal nach. Wahrscheinlich ..."
Er brach ab, denn seine Stimmbänder versagten bei dem Bild, das sich ihm bot.
Drei Männer saßen ab und liefen ins Haupthaus. Gleich darauf rief einer aus dem Fenster: „Da liegen noch zwei. Einer ist tot. Der andere aber lebt noch."
Der Sheriff und noch ein paar andere Männer drängten ins Haus. McLowry untersuchte den Bewusstlosen. Eine Kugel steckte in seiner rechten Brustseite. Eine andere hatte seinen linken Oberarm durchschlagen. Ein Streifschuss auf seiner Wange war bereits verharscht.
„Er ist dem Tod näher als dem Leben", murmelte Hank McLowry. „Diese Bastarde!" So brach es nach einigen keuchenden Atemzügen aus ihm heraus. „Sie sind schlimmer als wilde Tiere."
„Wir müssen ihn nach Monte Vista schaffen", sagte einer der Männer. „Dort gibt es einen Doc. Allerdings muss er ein Meister seines Fachs sein, wenn er diesen armen Teufel wieder auf die Beine bringen will."
„Yeah", murmelte der Sheriff bedrückt. „Bauen wir eine Schleppbahre. Wir nehmen auch die Toten mit nach Monte Vista. Und dann ..." Er zuckte hilflos mit den Achseln. „Wir werden wohl nach Hause zurückkehren müssen. Für einen längeren Ritt sind wir nicht ausgerüstet. Für das erste sind die Höllenhunde uns entkommen. Ich werde die Hauptstadt benachrichtigen, und man wird die verdammten Verbrecher bald auch in Colorado hetzen wie tollwütige Hunde."
*
Als Lance Flannagan das erste Mal richtig aus seiner Ohnmacht erwachte, waren fast zwei Wochen vergangen. Er fand sich nicht zurecht. Sein zerrissenes Bewusstsein zeigte tiefe Spalten. Denkvorgänge fielen aus, Zusammenhänge kamen nicht zustande, die Erinnerung wollte nicht einsetzen. Er hatte das Gefühl, in dichten Nebeln dahinzutreiben. Für einen Augenblick schloss er wieder die Augen, als ihn Schwindel erfasste und erneut hinwegzuspülen drohte. Nur langsam begann er zu begreifen.
Er lag in einem Bett, jemand hatte ihm die Zudecke bis zum Kinn gezogen. Über seinem verschleierten Blick spannte sich eine weißgekalkte Zimmerdecke. Lance bewegte sich etwas. Stechender Schmerz pulsierte durch seinen ganzen Körper und brach sich Bahn aus seinem Mund in einem erstickten Röcheln. Schweiß trat auf Lances Stirn. Lance entspannte sich.
Ja, er begann sich wieder zu erinnern. Lucy! Der stumme Aufschrei fuhr wie eine glühende Klinge durch sein Gemüt. Der Gedanke an seine Frau riss Lance vollends aus seiner Betäubung. Eine kalte Hand griff nach ihm. Schreckliche Bilder spulten sich vor seinem geistigen Auge ab wie ein Alptraum.
Da war das zornige Hundegebell, dann Joeys Schrei, und dann die schmetternden Schüsse. Er war aus dem Bett gesprungen, hatte sich mit der Winchester am Fenster postiert und hörte es im Schlafraum seines Vaters bereits donnern, als dieser das Feuer auf die Outlaws eröffnete ...
Plötzlich riss der Film.
Lance wurde nur noch von Angst und Sorge beherrscht. Seine Empfindungen drohten ihn zu überwältigen. Impulsiv wollte er hoch. Aber da war die verdammte Schwäche, war die dumpfe Benommenheit, waren die Übelkeit erregenden Schmerzen, die nicht zuließen, dass er sich bewegte. Weshalb tauchte niemand auf, der ihm Antwort auf all seine verzehrenden Fragen geben konnte?
In Lances vom Blutverlust gezeichneten, eingefallenen und bleichen Gesicht zuckte es. Fiebrig glühten seine Augen. Wie Visionen des Schreckens fluteten die schlimmsten Ahnungen und Befürchtungen durch seinen schmerzenden Verstand.
Das leise Knarren der Tür erreichte den Rand seines Bewusstseins. Ein kühler Luftzug streifte sein heißes Gesicht. Fußbodendielen ächzten, dann beugte sich jemand über Lance. Es war der Doc, und Lance wusste, dass er sich in Monte Vista befand.
„Doc ...", krächzte er mit schwacher, mitgenommener Stimme, und sogar dieses eine Wort strengte ihn an.
„Ja, Flannagan, ich bin es. Doc Masters. Du hattest mehr Glück als Verstand, mein Junge. Die Schufte haben dich ziemlich übel zusammengeschossen, und es grenzt schon fast an ein Wunder, dass du noch lebst."
Der Doc schlug die Decke zurück und prüfte Lances Verbände, die sich um seine Brust und seinen Oberarm wanden. Seine Hand tastete über Lances Stirn. Er brummelte: „Du bist fast fieberfrei. Ho, Flannagan, du bist der zäheste Bursche, der je unter meinem Messer lag. So ziemlich jeden anderen Mann hätte die Kugel in der Brust umgebracht."
Er deckte Lance wieder zu.
„Was ist aus Lucy geworden, Doc, aus Dad und ..."
Sein tonloses Flüstern klang losgelöst, rasselnd und dennoch auf besondere Art drängend und erwartungsvoll.
„Ich werde dir eine kräftige Mahlzeit bereiten lassen, Flannagan", erwiderte der Arzt ausweichend und wollte sich abwenden. „Alles, was du brauchst, ist Ruhe. Bewege dich nicht allzu viel, sonst besteht die Gefahr, dass die Brustwunde wieder aufplatzt."
Fast flehend kam es von Lance: „Bitte, Doc, sprechen Sie. Die Ungewissheit bringt mich sonst um. Haben die Banditen sie ermordet? Bitte ..."
Der Doc knetete nervös seine Hände. Die Linien und Furchen in seinem Gesicht vertieften sich. Schwer trug er an seiner Unschlüssigkeit. Fieberhaft formulierte er in seinem Kopf eine Ausrede, verwarf sie wieder, sagte sich betrübt, dass sein Patient die Wahrheit früher oder später erfuhr, und hub schwerfällig zu sprechen an: „Ein Aufgebot aus Conejos kam auf eure Ranch und fand euch. Joey und dein Dad sind tot. Lucy ist spurlos verschwunden. Die Schufte haben sie entführt. Eine landesweite Fahndung nach den Banditen brachte bisher keinen Erfolg."
Lances Züge verkrampften sich. Sein Herz raste. Es gelang ihm nicht, das Schreckliche verstandesmäßig zu erfassen.
Wieder erreichte ihn die Stimme des Arztes. Er hörte ihn sagen: „Du hast zehn Tage lang mit dem Tod gerungen, Flannagan. Und wie ich schon sagte, du hattest mächtiges Glück, dass du noch lebst. Du brauchst noch Wochen, um wieder halbwegs gesund zu werden. Mag die Wahrheit noch so grausam sein, versuche sie zu akzeptieren. Dein Wille, wieder gesund zu werden, muss stärker sein als alles andere. Wenn du jetzt resignierst, kann das deiner Genesung nur schaden."
„Gütiger Gott", röchelte Lance, schloss die Augen, und seine Wangen erschlafften. „Warum nur? Warum ..."
Er versuchte, die unerbittliche, grauenhafte Wahrheit zu begreifen. Die Worte des Docs hallten in ihm nach wie Totenglocken. Seine Lider flatterten und hoben sich, sein Blick schien aus der Ferne zurückzukehren. Brüchig fragte er: „Wer, Doc? Wer hat das getan?"
Der Doc, der schon unter der Tür stand, antwortete: „John Prewitt und seine Höllenbande: Carlos Valderon, Cole Vernon, Buster McNelly und Frank Gilmore."
Lance registrierte die Namen. Er hatte von der Mörderbande schon gehört. Die Namen brannten sich unauslöschlich in sein Gedächtnis ein. Und der Hass kam in rasenden, giftigen Wogen - vernichtender, grenzenloser Hass. „Ich werde sie finden", formten seine fiebrigen, rissigen Lippen. „Und dann frage ich sie nach Lucy, nach Dad und nach Joey. Und am Ende meiner Fragen werden eine Reihe Särge stehen ..."
Die Tür klappte hinter dem Doc zu. Lance war wieder allein. Der Hass in ihm erlosch, denn seine Gedanken verweilten wieder bei seinen Angehörigen. Schmerz und Trauer gewannen die Oberhand in seinem Bewusstsein. Er stand vor den Trümmern der Illusion von Ruhe und Frieden, die ihn, seinen Vater, seinen Bruder und Lucy bewogen hatte, die kleine Ranch zu erwerben und sich eine Rinder- und Pferdezucht aufzubauen. Schwermut schlich sich in sein Herz. Und etwas in ihm zerbrach …
*
Fast vier Monate waren vergangen seit jenem schrecklichen Morgen, als die Banditen die Flannagan-Ranch überfielen. Lance hatte Monte Vista verlassen. Er ritt einen schwarzen Wallach. Um seine Hüften lag ein breiter, büffellederner Patronengurt. Im Holster steckte ein schwerer, langläufiger 44er Colt, im Scabbard eine nagelneue Winchester 73, und in seinem Herzen trug Lance Dinge, die tödlicher waren als seine Waffen. Es waren glühender Hass und der dämonische Wille, Rache zu üben. Und er wollte Lucy wiederfinden. Etwas anderes gab es für Lance Flannagan nicht mehr.
Er hatte am Grab seines Vaters und Joeys gestanden. Sein ganzes Denken und Fühlen waren darauf ausgerichtet, den fünf Banditen eine tödliche Rechnung zu präsentieren.
Lance zog eine Zickzack-Fährte durch Colorado, New Mexiko und Arizona, und ein weiteres halbes Jahr verstrich, ohne dass er auf eine Spur der Bande stieß.
Es war Frühling. Die Natur erwachte zu neuem Leben. Auf den Bergen schmolz der Schnee, die Flüsse hatten sich in reißende Ströme verwandelt, die Rinnsale in sprudelnde, gischtende Wildbäche. Lance Flannagan war immer mutloser geworden. Er sah älter aus, als er tatsächlich war. Das Lachen hatte er verlernt. In jede noch so kleine Ansiedlung an seinem Weg ritt er und stellte Erkundigungen an.
Aber die Bande blieb in der Versenkung verschwunden, als hätte sie die Erde verschluckt.
Lance war wieder nach Colorado zurückgekehrt. Er lebte einen Monat auf seiner Ranch und versuchte sich damit abzufinden, dass er aufgeben musste. Aber es hielt ihn nicht an diesem Fleck, an dem das Schicksal ein neues Kapitel in das Buch seines Lebens zu schreiben begonnen hatte. Die Erinnerungen überwältigten ihn immer öfter, alles in ihm bäumte sich dagegen auf, den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen. Die Ranch bedeutete ihm nichts mehr. Er ritt nach Monte Vista und verkaufte sie kurzentschlossen. Und dann trieb es ihn wieder ruhelos durch das Land.
Es war ein regnerischer Tag im April, als Lance sich in der Nähe von Port Vasquez, vierzig Meilen nördlich von Denver, aufhielt. Felsiges Gebiet umgab ihn. Hier und dort schoben sich bewaldete Hügel in die Senken und Täler. Weit vor Lance bohrte sich die alte Postkutschenstraße zwischen zwei rötliche Sandsteinmassive mit steilen Wänden. Es war um die Mittagszeit. Lance ritt langsam. Seit Wochen war er wieder ziel- und planlos unterwegs. Etwas Kaltes, Unnahbares verströmte er. Er war schmutzig und abgerissen. Tagealte Bartstoppeln bedeckten sein Kinn und seine Wangen. Lance vermittelte das Bild eines Satteltramps, eines jener rastlosen Reiter, die immerzu auf der Suche nach dem Glück waren und es niemals fanden.
Lance zügelte den Wallach. Witternd hob er den Kopf. Er hatte sich nicht getäuscht. Der verwehende Klang von Schüssen sickerte an sein Gehör. Dann wurde es still. Nur noch die Geräusche der Natur umgaben Lance.
Die Schüsse waren in südlicher Richtung gefallen. Das nahe liegende für Lance war, dass einige Banditen die Stagecoach überfallen hatten. Er nahm die Winchester aus dem Scabbard, repetierte und ritt weiter, den hellwachen Blick nach vorne gerichtet, ein Bündel angespannter Aufmerksamkeit.
Der Wallach trug ihn zwischen die steil aufragenden Sandsteinmassive. Der pochende Hufschlag prallte auseinander und wurde von den Felsen zurückgeworfen. Übereinandergetürmte Felsbrocken und dorniges Gestrüpp säumten die von Spurrinnen zerfurchte Straße. Der Regen hatte den Staub in knöcheltiefen Morast verwandelt. Wasserpfützen muteten an wie kleine Seen. Der Himmel war grau und wolkenverhangen. Im Canyon herrschte Düsternis.
Die Felsen traten auseinander, und Lances Blick war frei in die Ebene, die sich anschloss. Nur sporadisch wuchteten hier Felsklötze und Findlinge, ähnlich den Seifenblasen auf der Wasserfläche in einem Badezubers. Dafür aber gab es zu beiden Seiten des Weges dichtes, ineinander verfilztes Gebüsch. Die Ebene war gesäumt von Hügeln und Felsen, und an ihrem Ende verschwand die Straße wieder in einem klaffenden Einschnitt zwischen den Erhebungen. In diesen Einschnitt - etwa eine Meile entfernt -, trieben drei Reiter ihre Tiere. Sie schienen es höllisch eilig zu haben. Sogleich erkannte Lance auch den Grund für ihre Hast. Zweihundert Yards vor ihm stand ein Pferd mit hängenden Zügeln mitten auf der Straße. Daneben lag ein Mann auf dem Gesicht. Das Tier hatte den Kopf zu ihm hinuntergebeugt und stupste ihn mit der Nase an, als wollte es ihn dazu bewegen, sich zu erheben und wieder in den Sattel zu klettern.
Aber der Mann gab kein Lebenszeichen von sich.
Lance ritt auf die Stelle zu. Bei dem Reglosen stieg er ab. Das Pferd des Mannes glotzte ihn an, spielte mit den Ohren und trat unruhig auf der Stelle.
Lance drehte den Mann auf den Rücken. Und er zuckte zusammen. Denn an der linken Brustseite des Besinnungslosen funkelte der Orden eines U.S. Deputy Marshals des Staates Colorado.
Der Mann lebte noch. Aber sein Gesicht war bereits vom Tod gezeichnet. Eine Kugel hatte ihn in die Brust getroffen. Neben ihm lag sein Colt. Hemd und Jacke des Deputys waren blutgetränkt. Eine gnädige Ohnmacht hielt ihn umfangen. Er atmete nur noch flach,
Lance holte seine Wasserflasche, schob seine Rechte flach unter den Kopf des Mannes, hob ihn etwas an und setzte ihm mit der Linken die Flasche an die Lippen. Wasser lief über Kinn und Hals des Todgeweihten, aber plötzlich begann er zu schlucken, und seine Lider vibrierten. Ein Gurgeln kämpfte sich in seiner Brust hoch und quoll über seine Lippen, und er öffnete die Augen. Mit leerem Blick starrte er Lance an. Seine Zähne schlugen plötzlich aufeinander wie im Schüttelfrost. Es war die Kälte des Todes, die von innen kam und ihn frieren ließ. Lance gab ihm noch einmal zu trinken, dann ließ er seinen Kopf sachte zurückgleiten.
„Können Sie mich verstehen, Mister?", fragte er sanft und blieb in der Hocke.
Auf der Stirn des Sterbenden perlte Schweiß. Ein Schimmer des Begreifens huschte plötzlich über sein Gesicht, in dem der Schmerz wütete. Die Lippen des Verwundeten sprangen auseinander, er sagte etwas, aber es waren nur unartikulierte, abgerissene und ersterbende Laute, die er produzierte.
Lance band sein Halstuch los, befeuchtete es und kühlte damit die Stirn des Deputys. „Versuchen Sie ruhig zu sprechen, Marshal", murmelte er. Viel Zeit blieb dem Verwundeten nicht mehr. Nach ihm griff bereits der Sensenmann mit knöcherner Klaue.
Die Lebensgeister des Marshals schienen noch einmal zu erwachen. Er tauchte auf aus der dämmrigen Welt der Trance und stammelte: „Drei Mörder ... Tom Sanders, Jeff Doolin, Lopez Montoya ... Ich - ich ritt auf ihrer Fährte. Sie haben es irgendwie herausgefunden. Hier ..." Er brach röchelnd ab, ein Blutfaden rann aus seinem Mundwinkel, blutige Schaumbläschen bildeten sich auf seinen Lippen. Der Marshal bäumte sich auf, verdrehte die Augen und fiel zurück. „Ich ritt hier in ihren Hinterhalt", begann er noch einmal, mit schwankender, zerrinnender Stimme, und es kostete ihm allen Willen und große Anstrengung. „Stranger - den Stern und meine Papiere - bring es Marshal Billings in Denver. Bestelle ihm, dass ich es nicht geschafft habe."
Sein Kopf rollte zur Seite, sein Blick erlosch. Sein Lebensfaden war zerrissen.
Eine Welle von Gemütsbewegungen lief über Lances Züge. Peinigende Erinnerungen stellten sich mit Macht ein. Eisige Hände aus der Vergangenheit griffen nach Lance. Er biss die Zähne zusammen, Hass brach aus seinen Augen. Fast automatisch nahm er dem Toten den Stern ab. Dann suchte er in der Jacke nach seinen Papieren. Er fand sie. Die tödliche Kugel hatte sie durchschlagen.
„Sicher, Amigo, ich bringe den Stern und die Papiere nach Denver. Und ich bringe dem Marshal auch die drei Bastarde, die dich feige aus dem Hinterhalt ermordeten."
Lance versprach es, und er würde alles daransetzen, sein Versprechen einzulösen. Er verstaute den Stern und die Papiere in seiner Satteltasche, dann begrub er den Leichnam. Mit dem Pferd des Marshals an der Longe ritt er weiter. Deutlich war die frische Fährte der Banditen im Schlamm auszumachen.
Nach drei Stunden tauchten die Palisaden und Mauern Fort Luptons vor ihm auf. Das Tor stand weit offen. Zwei Wachposten lungerten herum, Lance hielt bei ihnen an. Sie zeigten mürrische Gesichter, denn bei diesem Hundewetter war es alles andere als ein Spaß, Wache zu schieben. Sie stellten Lance die allgemeinen Fragen, die jedem Ankömmling in einem Fort gestellt werden, und dann war die Reihe an Lance, die Frage loszubringen, die ihm auf der Zunge brannte: „Ich suche drei Männer. Zwei Amerikaner und einen Mex. Sie können vor höchstens einer Stunde hier angekommen sein."
„Ja", erklärte einer der Posten, „die drei sind im Fort. Sehen aus wie verkommene Sattelstrolche. Solche Pilger sehen wir nicht gerne im Fort." Unverhohlen und etwas geringschätzig maß er Lance von oben bis unten und brachte damit zum Ausdruck, dass er Lance auf eine Stufe mit den drei Sattelstrolchen stellte. Er knurrte unfreundlich: „Was haben sie denn ausgefressen?" Er deutete auf das ledige Pferd. „Saß da mal vielleicht einer drauf, einer, den Sie nun rächen wollen?"
„Wo finde ich die drei?" Lance ging nicht auf die Frage des Soldaten ein.
„Wahrscheinlich in der Mannschaftskantine. Dort dürfen auch Zivilisten verkehren." Plötzlich kniff der Posten die Augen zusammen. Hart stieß er hervor: „Der Kommandant von Fort Lupton ist kein Freund von Schießereien zwischen den Palisaden des Forts. Ganz und gar aber hasst er es, wenn Zivilisten ihren Zwist hereintragen. Wenn Sie also Verdruss vom Zaun brechen, kann es passieren, dass Sie sich in der Arrestzelle wiederfinden."
Lance schürzte die Lippen. „Ich habe einem toten U.S. Marshal ein Versprechen gegeben, Soldat. Ich kam zufällig des Wegs, als ich ihn sterbend fand. Die drei haben ihn aus sicherer Entfernung abgeknallt. Es sind niederträchtige Killer, denen der Marshal im Nacken saß. Nun nehme ich seine Stelle ein. Wer sollte mir das verbieten?"
Lance trieb den Wallach wieder an und ritt an den verdutzten Wachsoldaten vorbei. Er nickte dem wachhabenden Offizier zu, der soeben die Wachbaracke verließ und ihn aufmerksam fixierte. Es war ein Lieutenant. Als Lance sich einmal umdrehte und zurückblickte, sah er, dass einer der Posten seinem Vorgesetzten Bericht erstattete. Dabei starrten alle drei hinter ihm her.
*
Lance lenkte das Pferd die Straße hinunter. Links von ihm war der Parade- und Exerzierplatz, rechts erhoben sich Unterkünfte, Stallungen, Scheunen und Magazine. Auf der anderen Seite des Platzes bot sich ein ähnliches Bild. Auf den Wehrgängen rund um das Fort patrouillierten Soldaten. Das Sternenbanner hing schlaff und nass am Mast und bewegte sich kaum im trägen Wind. Der Untergrund war aufgeweicht. Unter den Hufen des Pferdes schmatzte und gurgelte es. Lance passierte die Kommandantur und folgte dem typischen Kneipenlärm aus einem flachen Gebäude am Ende der Straße. Drei abgetriebene Pferde standen mit hängendem Kopf am Hitchrack und peitschten mit den Schweifen, Sie waren bis zu den Bäuchen mit Schlamm bespritzt.
Lance stellte seine beiden Tiere daneben, leinte sie an, rückte seinen Revolvergurt zurecht und lüftete den Sechsschüsser etwas im Holster. Dann betrat er die Kantine.
Einige Soldaten saßen an den Tischen oder lümmelten an der Theke herum. Und am Tresen lehnten auch die drei abgerissenen, heruntergekommenen Banditen. Sie wandten der Tür den Rücken zu. Zigarettenrauch hüllte sie ein.
Die kalte, unerbittliche Strömung, die von Lance ausging, berührte die Soldaten, die ihn musterten, fast körperlich. Nach und nach versickerte das Stimmengemurmel. Die drei Kerle wurden aufmerksam und drehten sich langsam um. Ihre Brauen schoben sich zusammen. Einer von ihnen ließ seine Zigarette einfach zu Boden fallen.
Lance stand vor der Tür. Etwas breitbeinig, in der Mitte leicht eingeknickt. Seine Rechte hing locker neben dem Revolverkolben. Sein Gesicht war wie aus Granit gemeißelt.
Die Banditen starrten ihn an, taxierten ihn und schätzten ihn ein. Sie erinnerten an sprungbereite Raubtiere. Tatsächlich ging von ihnen etwas Animalisches aus. Verkommenheit und ein Leben voller Laster und Sünden hatten ihre Züge geprägt. Ihre Augen blickten hart wie Kieselsteine, aber da waren auch ein tückisches Lauern und die eiskalte Bereitschaft.
Dieser Sorte war ein Menschenleben weniger wert als der Preis für die Kugel, mit der sie es auslöschten.
Lance zeigte geradezu unheimliche Ruhe und Unerschütterlichkeit. Kerle ihres Schlages waren es, die seinen Vater und Joey ermordet und Lucy entführt hatten. Sie verdienten keine Milde, keine Gnade und kein Mitleid.
Die Situation war eindeutig. Die Atmosphäre knisterte geradezu vor Spannung. Einige Soldaten, die zwischen Lance und den Outlaws an den Tischen saßen, erhoben sich schnell und machten die Schussbahn frei. Sie drängten zur Wand und behinderten sich gegenseitig. Stuhlbeine scharrten, ein Glas klirrte zu Boden, harte Absätze hämmerten auf den Dielen. Bleischwer senkte sich Stille in den Schankraum.
Die drei Strolche wussten, was die Stunde geschlagen hatte. Ihre Hände sanken langsam nach unten und näherten sich den Revolverkolben.
Lances Lippen sprangen auseinander. Brechend rief er: „Ich fand den sterbenden Marshal, den ihr auf eurem Trail zurückgelassen habt. Und ich versprach, euch für diesen Mord zur Rechenschaft zu ziehen."
„Was willst du denn von uns?", blaffte einer der Burschen, und Lance, der ihre Steckbriefe kannte, identifizierte ihn als Tom Sanders. „Wir wissen nichts von einem toten Marshal. Hat dir der Regen vielleicht die Birne aufgeweicht?"
Unbeirrt erwiderte Lance: „Ich bringe euch nach Denver zum U.S. Marshal. Oder ihr verschwindet außerhalb des Forts in einem namenlosen Grab. Es wird an euch selbst liegen, wie dieser Tag für euch zu Ende geht."
Lopez 'Chico' Montoya, der den Beinamen Chico wegen seines jungenhaften Aussehens trug und dessen Wiege in der mexikanischen Provinz Sonora gestanden hatte, rief grinsend: „Madre de Dios, Amigo, willst du es wirklich mit uns dreien aufnehmen? Wenn du mit diesem Vorsatz hier hereingekommen bist, dann bist du entweder sehr dumm oder krankhaft arrogant"
„Ihr kommt aus Fort Lupton so oder so nicht mehr hinaus. Ich habe die Wachposten beim Tor über euch aufgeklärt. Und die haben es sofort dem Wachhabenden gemeldet."
Ihre Mienen ließen plötzlich Unruhe erkennen. Ihre Augen fingen an zu flackern und wurden unstet. Dennoch: das Verhältnis stand drei zu eins. Ein tödliches Verhältnis. Trotz ihrer jähen Rastlosigkeit waren sie sich ihrer Überlegenheit dem einzelnen gegenüber sehr sicher. Tom Sanders lachte scheppernd auf. Der giftige Laut sprengte die Stille, hohnvoll sagte er: „Möglich, dass wir dem Kommandanten eine Reihe von Fragen beantworten werden müssen. Du, mein Freund, wirst dann aber bereits an der Höllenpforte um Einlass bitten."
„Si", grunzte Montoya. „Er will sterben. Erfüllen wir ihm seinen Wunsch."
Wie auf Kommando zuckten ihre Hände zu den Eisen. Auch Lance zog. Es war eine huschende Bewegung von Arm und Schulter, gleichzeitig ließ er sich fallen. Sein Colt schwang hoch und brüllte auf. Wie bösartige Hummeln pfiffen die Geschosse der Outlaws über ihn hinweg. Er feuerte in rasender Folge. Der Donner staute sich im Raum und drohte ihn aus allen Fugen zu sprengen. Die Banditen wurden von den Einschlägen herumgerissen und geschüttelt und taumelten zu Boden. Ihre Schießeisen polterten auf die Dielen. Pulverdampf wallte nebelhaft, und ätzender Geruch legte sich auf die Schleimhäute.
Lance erhob sich. Noch immer zeigte sein Gesicht keinen Ausdruck. Ein Raunen ging durch den Schankraum. Mit dem angeschlagenen Colt ging Lance vorsichtig auf die Banditen zu. Von Kerlen dieser Gattung ging erst dann keine Gefahr mehr aus, wenn sie tot waren. Das war bei dem Mexikaner und Jeff Doolin der Fall. Lance hatte einen blutigen Schlussstrich unter ihr unseliges Dasein gezogen.
Tom Sanders hatte seine Kugel in die Schulter bekommen. Er setzte sich ächzend und stöhnend auf und presste die Hand auf seine Verletzung. Blut quoll zwischen seinen Fingern hervor. Der Schmerz trieb ihm die Tränen in die Augen. Er atmete erstickend, als würgte ihn eine unsichtbare Hand.
„Okay, Sanders, das war's", murmelte Lance. „Deine Kumpane sind hinüber. Du wirst einsam und allein unter dem Galgen stehen müssen."
„Du elender Bastard!", zischte Tom Sanders wie eine Schlange. „Ich habe noch mehr Freunde auf der Welt, gute Freunde, und die werden ..."
„Gehört zu deinen Freunden auch John Prewitt?", stieß Lance schneidend hervor.
„Die Hölle verschlinge dich!", knirschte Sanders mit vom Schmerz verzerrter Stimme.
Das Trappeln vieler Schritte erklang. Ein halbes Dutzend Soldaten drängten in die Kantine. Mit den Karabinern im Anschlag verteilten sie sich an den Wanden zu beiden Seiten der Tür. Der wachhabende Lieutenant folgte ihnen. Mit einem Blick erfasste er, was geschehen war. Er schnarrte: „Die Waffe weg, Mister!"
Lance reckte seine Schultern, holsterte den Colt und erklärte kehlig. „Bei den dreien handelt es sich um Tom Sanders, Lopez 'Chico' Montoya und Jeff Doolin. Weshalb ich hinter ihnen her war, wissen Sie von den beiden Posten, Lieutenant. Gewiss existieren von ihnen auch in Fort Lupton Steckbriefe."
Der Offizier trat vor den Verwundeten hin. Sein forschender Blick tastete die schmerz- und hassverzerrten Züge des Banditen ab. Plötzlich rief er über die Schulter: "Reiter Morgan, holen Sie den Feldscher her." Der Soldat knallte die Hacken zusammen und rannte aus dem Schankraum. An Lance gewandt gab der Lieutenant zu verstehen: „Sie sind vorläufig festgenommen, Mister. Wie ist Ihr Name?"
„Lance Flannagan."