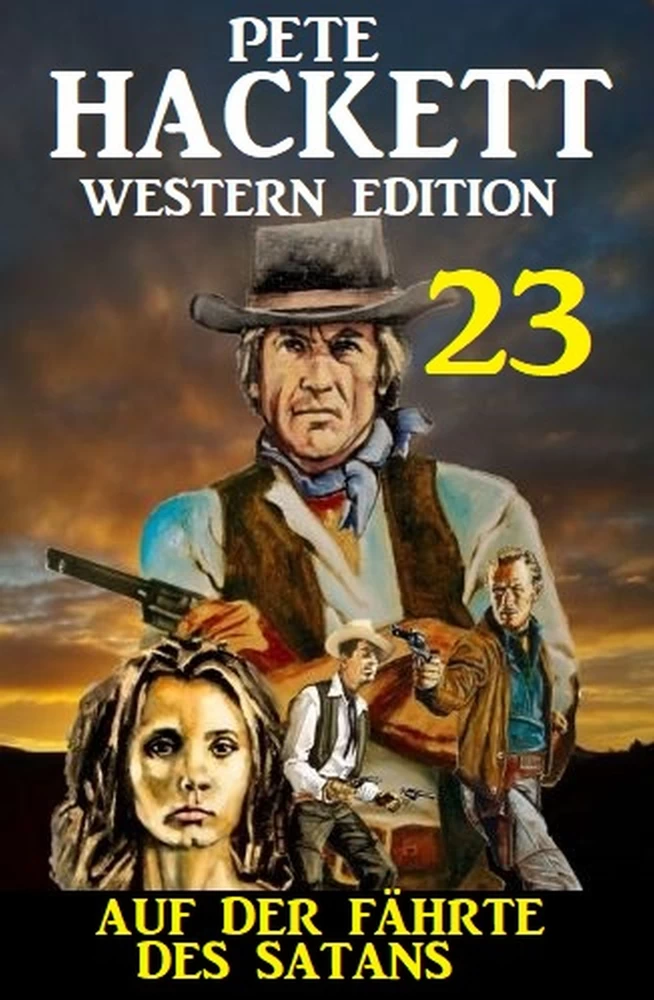Zusammenfassung
Es war August, die heißeste Jahreszeit, und die Sonne brannte heiß und erbarmungslos herab. Die Luft schien in der Hitze zu glühen und zu vibrieren. Das Atmen wurde zur Qual. Kein kühlender Windhauch regte sich, nirgends gab es Schatten.
Sie zogen durch das endlos anmutende San Bernardino Valley, am Ufer des Black Draw entlang, in nordöstliche Richtung, wo sich greifbar nahe die grünen Hügel und Felsen der Guadalupe Mountains erhoben. Nördlich von ihnen, in rauchiger Ferne, erhoben sich die Chiricahua Mountains wie eine grüne Insel inmitten des ausgebrannten, steppenhaften Graslandes, roter Felsen und gleißender Sandflächen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author / COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
Auf der Fährte des Satans: Pete Hackett Western Edition 23
Western von Pete Hackett
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war - eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung."
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress.
***
Gordon Sand führte den Bullen an der langen Leine. Ein Zuchtbulle mit zottigem Fell, einem mächtigen Schädel und weit ausladenden Hörnern. Mit gesenktem Kopf trottete das starke, prächtige Tier dahin, seine schweren Tritte verursachten ein dumpfes Rumoren auf der ausgedörrten Weide. Neben Gordon Sand ritt sein jüngerer Bruder Joey. Der Junge saß leicht vornüber geneigt im Sattel und wischte sich ein um das andere Mal den Schweiß von der Stirn und aus den Augenbrauen.
Es war August, die heißeste Jahreszeit, und die Sonne brannte heiß und erbarmungslos herab. Die Luft schien in der Hitze zu glühen und zu vibrieren. Das Atmen wurde zur Qual. Kein kühlender Windhauch regte sich, nirgends gab es Schatten.
Sie zogen durch das endlos anmutende San Bernardino Valley, am Ufer des Black Draw entlang, in nordöstliche Richtung, wo sich greifbar nahe die grünen Hügel und Felsen der Guadalupe Mountains erhoben. Nördlich von ihnen, in rauchiger Ferne, erhoben sich die Chiricahua Mountains wie eine grüne Insel inmitten des ausgebrannten, steppenhaften Graslandes, roter Felsen und gleißender Sandflächen.
»Wir hätten den Abend abwarten sollen, Gordon«, gab Joey mit staubheiserer Stimme zu verstehen. »Die verdammte Hitze macht mich fix und fertig.« Er blies die Wangen auf, ließ zischend die Luft entweichen.
»Du magst schon recht haben«, erwiderte Gordon und lächelte. »Abends wäre es bestimmt angenehmer für uns und die Tiere gewesen. Aber Vater wartet sicher voll Ungeduld auf den Bullen. Wir sind sowieso schon einen halben Tag überfällig. Und er wird sich Sorgen machen.«
»Ist schon in Ordnung. Ich weiß, dass wir Old Jims Geduld nicht länger auf die Probe stellen dürfen.«
Sie hatten den Zuchtbullen im Auftrag ihres Vaters bei einer Auktion in Douglas erstanden. Nahezu die gesamten Ersparnisse Old Jim Sands waren mit dem Kauf des Tieres draufgegangen. Wenn sie den Bullen verloren, wäre die JS-Ranch am Ende.
Viele Meilen zog Gordon Sand ihn nun schon hinter sich her. Der Bulle verursachte keine Probleme. Der Eisenring, der ihm als Kalb schon durch die Nase gezogen worden war, machte ihn ausgesprochen empfindsam, und so gehorchte er jedem Zug mit der Longe.
Obwohl sie müde und ausgelaugt waren, ritten die Brüder wachsam und mit angespannten Sinnen. Viel zu viel Gesindel trieb sich in diesem Land herum, in dem nur das Gesetz des Stärkeren galt und Recht und Ordnung auf den denkbar schwächsten Beinen standen.
Zwanzig Meilen weiter südlich begann Mexiko, und immer wieder fanden mexikanische Bravados den Weg über die Grenze, um zu rauben, zu morden und zu brandschatzen und schnell wieder in den Steinwüsten der Sonora unterzutauchen.
Vereinzelte hohe Kakteen säumten ihren Weg, zwischen Gesteinsbrocken wucherten dornige Comas und verstaubte Ocotillos.
Yard um Yard, Meile um Meile schmolz unter den Hufen der Tiere dahin, und am Spätnachmittag konnten die Brüder durch den Sonnenglast die Gebäude der väterlichen Ranch ausmachen.
»Endlich«, sagte Joey und es klang erleichtert. »Ich habe das Gefühl, in einer Wasserlache zu sitzen, so sehr schwitze ich.«
Grau in Grau schälten sich die Gebäude aus der flirrenden Luft. In der Nähe trabte ein Rudel Rinder zum Fluss.
Gordon starrte nach vorn. Mit einer knappen Handbewegung schob er sich den Hut aus der Stirn. »Komisch«, sagte er, und seine Augen wurden eng.
»Was?«
Gordon hob unbehaglich die Schultern. »Die Ranch liegt wie ausgestorben da. Eigentlich hatte ich erwartet, dass Vater …«
Er zerrte an den Zügeln, brachte seinen Falben zum Stehen. Ganz hinten in Gordons Hirnwindungen schrillte es Alarm. Denn er sah aus dem Ranchhaus einige Männer laufen. Vier, fünf Kerle in dunklen, eng anliegenden Anzügen und mit riesigen Sombreros auf den Köpfen. Sie verschwanden hinter einem Schuppen aus seinem Blickfeld.
Auch Joey war es nicht entgangen. Er verhielt neben Gordon. Der fragende Blick seiner rauchgrauen Augen ruhte auf dem älteren Bruder. »Verflucht«, entrang es sich ihm besorgt. »Was sind das für Männer?«
Gordon atmete schwer. Seine Brust hob und senkte sich. »Mexikaner. Und das hat nichts Gutes zu bedeuten«, sagte er ahnungsvoll.
»Du - du denkst …« Der Siebzehnjährige verstummte. Der schreckliche Gedanke allein trieb ihm den kalten Schweiß auf die Stirn.
Gordon nickte und sprach es aus. »Ja. Ich denke, dass unserer Ranch mexikanische Banditen einen Besuch abgestattet haben. O Gott, hoffentlich …« Sekundenlang versagte ihm die Stimme den Dienst, in seinem braungebrannten, schmalen Gesicht zuckte es. Ihm war plötzlich, als säße eine Eisenklammer in seinem Genick.
»Hier, Joey -«, er reichte dem Jungen die Longe -, »halt den Bullen fest und reite auf keinen Fall näher an die Ranch heran, solange wir nicht wissen, was es mit den Kerlen auf sich hat.«
»Was hast du vor?«, fragte Joey und starrte den großen Bruder bestürzt an.
Gordon befeuchtete sich die Lippen mit der Zungenspitze. »Wenn es Banditen sind, dann müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen«, antwortete er und war bemüht, seiner Stimme einen ruhigen Klang zu verleihen. »Ich reite hin, um es herauszufinden.«
»Das wäre verrückt, Gordon!«, rief der Junge entsetzt. »Lass uns lieber verschwinden und abwarten, bis sie außer Sichtweite sind. Wir können nichts …«
Gordon unterbrach ihn. »Sie haben uns wahrscheinlich längst bemerkt und würden uns sehr schnell eingeholt haben. Wenn es sich um Bravados handelt, werde ich sie aufhalten, Joey. Für dich heißt das, dass du mit Windeseile verduftest, wenn der erste Schuss kracht. Verstanden?«
»Was ist mit dem Bullen?«
»Wenn es so kommt, wie ich vermute, dann vergiss ihn und rette dein Leben.«
Gordon lüftete den Colt im Halfter, schaute den kleinen Bruder noch einmal an, dann gab er seinem Falben die Sporen. Das Pferd sprang aus dem Stand an und streckte sich. In diesem Moment brachen hinter dem Schuppen die fünf Männer auf ihren Pferden hervor. Klar zeichnete das Sonnenlicht die Konturen ihrer Gestalten nach. Der scharfe Reitwind bog die Krempen ihrer Sombreros vorn senkrecht nach oben.
Gordon lag fast auf der Mähne und riss den Revolver heraus.
Angst umkrallte Joeys Herz, als er das ganze Ausmaß der Gefahr begriff, in der sie sich befanden. Und es kostete ihn Mühe, den Anblick der herandonnernden Horde zu ertragen, ohne die Nerven zu verlieren.
Die fünf Reiter fächerten auseinander. Jetzt lagen auch in ihren Fäusten die Colts. Das Metall reflektierte das Sonnenlicht. Stampfende, wirbelnde Hufe rissen Staubfahnen in die heiße Luft. Der Strom des Vernichtungswillens, der von der heranbrandenden Schar ausging, war unverkennbar und erschreckend. Wie eine Meute Bluthunde jagte sie heran. In das Trappeln der Pferdehufe hinein fielen die ersten Schüsse. Die fahlen Mündungsblitze zuckten an den Pferdehälsen vorbei, mit lautem Knall übertönten die Detonationen alle anderen Geräusche.
Gordon trieb sein Pferd mit heiseren Zurufen an. Der Colt in seiner Rechten zielte auf einen der herangaloppierenden Bravados. Ein armlanger Mündungsstrahl stach aus dem Lauf. Im selben Augenblick wurde Gordons Falbe getroffen. Das Tier brach vorn ein. Gordon versuchte noch, es wieder hochzureißen, bewirkte aber nur, dass das Pferd zur Seite umkippte. Es gelang ihm nicht mehr, seinen Fuß aus dem Steigbügel zu befreien.
Der Falbe schlug wirbelnd mit den Hufen, warf den Kopf hoch und wieherte schrill und trompetend. In den Augen des Tieres standen quälendes Entsetzen und fürchterliche Todesangst. Gordon zog und zerrte, aber er brachte sein rechtes Bein nicht unter dem Pferdeleib hervor. Beim Sturz war ihm der Colt aus der Hand geprellt worden. Er streckte sich danach, erreichte ihn nicht. Nur wenige Handbreit fehlten …
Die Reiter stoben heran. Kugeln rissen um Gordon herum die Erde auf und wirbelten Staub und Dreck in die Höhe. Er griff nach der Winchester, deren Kolben unter dem Pferdekörper hervorlugte, bekam sie mit einem Ruck frei, repetierte, warf sich halb herum. Der Kolben flog an seine Schulter. Da traf ihn ein harter Schlag. Vor seinen Augen schien die Welt zu explodieren. Er fühlte keinen Schmerz, spürte nur noch eine grenzenlose Schwäche, und schließlich senkte sich undurchdringliche Dunkelheit vor seine Augen.
Joey sah es. Panik kam in ihm auf. Er wollte sein Pferd herumreißen, aber eine Erstarrung, die tief aus seinem Innersten kam, lähmte ihn. Seine Augen weiteten sich, sein Blick verkrallte sich an dem Bullen, der dumpf zu röhren begann. Plötzlich sank sein Brüllen herab zu einem ersterbenden Röcheln. Das wertvolle Tier knickte auf den Vorderbeinen ein, warf im letzten Aufflackern eines instinktiven Lebenswillen den kantigen Schädel in die Höhe, unvermittelt aber kippte es auf die Seite. Ein Zucken ging durch den mächtigen Körper, dann lag er still.
*
Joey Sand war wie versteinert. Nur unterbewusst nahm er wahr, dass die mexikanischen Outlaws das Feuer eingestellt hatten. Sein gehetzter Blick schnellte zwischen dem toten Bullen und dem wie leblos daliegenden Bruder hin und her. Der Falbe atmete stoßweise und rasselnd, versuchte voll Verzweiflung, sich mit den Vorderbeinen hochzustemmen. Seine Hufe kratzten und scharrten über den Boden, rissen die Grasnarbe auf. Dreck und Gras spritzten, Staub wallte auf.
Das Hufgetrappel näherte sich wie Sturmgebraus. Die dunklen Gesichter der Banditen wirkten wie aus Holz geschnitzt. Joeys Pferd tänzelte nervös zur Seite, spielte mit den Ohren, schnaubte erregt. Der Junge hob die Zügel, setzte die Oberschenkel ein und bannte das Tier mit harter Hand auf der Stelle.
Plötzlich wich die Erstarrung von ihm. Erst kam das Bewusstsein grenzenloser Einsamkeit, dann der Zorn, jäh und wild wie eine Springflut. Er ließ die Longe, die er bis dahin krampfhaft und unterbewusst festgehalten hatte, los. Seine Rechte zuckte zum Revolver. Nie vorher hatte er ihn auf einen Menschen gerichtet. Er versuchte nicht zu fliehen. Er schlug, was Gordon ihm geraten hatte, in den Wind. Es war, als erwachte in ihm ein bisher nie gekannter Kämpferinstinkt.
Heiseres Geschrei von den Banditen vermischte sich mit den donnernden Hufen. Zwei, drei Schüsse krachten. Joeys Pferd machte einen Satz nach vorn, als ihm eines der Projektile die Haut am Hals aufriss.
Joeys Schuss ging fehl. Er spürte den Rückschlag bis in die Schulter. Er zerrte am Zügel, hatte Mühe, sich auf dem Pferderücken zu halten. Sein Oberkörper pendelte nach hinten, im letzten Moment konnte er sich mit seiner Linken an das Sattelhorn klammern und wieder nach vorn ziehen.
Joey drückte erneut ab. Die Pulverdampfwolke nahm ihm für einige Sekunden die Sicht, und so jagte er die nächsten Schüsse blindlings der heranjagenden Meute entgegen.
Einer der Banditengäule rammte sein Pferd. Wie von einem Katapult geschleudert flog Joey aus dem Sattel. Sein Brauner wälzte sich mit keilenden Hufen auf der Erde, kam mit einem Ruck hoch. Joey hatte sich mit katzenhafter Gewandtheit abgerollt und sprang zugleich mit dem Pferd auf die Beine, fiel dem durchgehenden Tier in die Zügel, packte mit der Linken das Sattelhorn, schwang sich in den Sattel und riss das Tier auf der Hinterhand herum.
Vor ihm parierte einer der heranstiebenden Banditen hart sein Pferd. Joey sah das verzerrte Gesicht des Outlaws und trieb den Braunen mit einem wilden Schenkeldruck und einem gellenden Schrei an. Das erschrockene Tier sprang wie von der Sehne geschnellt los, prallte mit voller Wucht gegen den Banditengaul. Dessen Reiter sauste durch die Luft und überschlug sich am Boden. Joey drosch seinem Pferd die Sporen in die Seiten. Vor ihm war der Weg frei. In gestrecktem Galopp fegte er auf die Ranch zu.
Ein dramatischer Wettlauf mit dem Tod begann.
In breiter Front jagten die Mexikaner hinter ihm her. Sie lagen fast auf den Hälsen ihrer Pferde. Vereinzelt fielen Schüsse. Aber die Sprünge der Tiere, das Auf und Ab der Körper ließen keinen sicheren Schuss zu.
Das Hufgetrappel schwoll an zu einem erdbebenhaften Grollen. Der Braune unter Joey galoppierte gleichmäßig dahin. Unerreichbar schien dem Jungen die Ranch. Dabei lag sie in greifbarer Nähe vor ihm.
Er schaute über die Schulter nach hinten. Die Distanz zwischen ihm und den Outlaws betrug höchstens fünfzig Yards. Er konnte auf diese Entfernung ihre breitflächigen, bärtigen Gesichter sehen, in die Verkommenheit und Zügellosigkeit geschrieben standen. Sie bearbeiteten ihre Pferde mit den langen Zügelenden, den großen Radsporen und den Fäusten.
Joey wandte sich wieder nach vorn. Die Gebäude der Ranch flogen förmlich auf ihn zu. Dicht vor seinen Augen wehte die Mähne des Braunen. Der Reitwind trieb Schaumflocken von seinen geblähten Nüstern gegen Joeys Hosenbeine. Das Pferd stob wie ein Pfeil dahin, als spürte es, dass es von ihm abhing, ob Joey sein Leben retten konnte. Die wirbelnden Hufe schienen kaum mehr den Boden zu berühren.
Aber die Gäule der Verfolger waren mindestens ebenso gut und ausdauernd. Sie verloren keinen Yard an Boden, gewannen aber auch keinen.
Jedoch der unglückliche Zufall spielte Schicksal.
Joeys Brauner trat im vollen Lauf in einen Präriehundbau. Seine Vorderläufe knickten weg wie morsche Latten. Der Junge wurde wie von einer Riesenfaust geschleudert aus dem Sattel gehoben, flog einige Yards durch die Luft und stürzte Hals über Kopf auf die hartgebrannte Erde, überrollte sich einige Male und blieb liegen. Das Pferd hatte sich überschlagen, sein fanfarenhaftes Gewieher verschlang den herantosenden Hufschlag. Es kam hoch, stand mit zitternden Flanken und rollenden Augen. Der rechte Vorderhuf hing in der Luft und schien über dem Kronbein seltsam verdreht.
Joey lag mit dem Gesicht nach unten im Gras und kämpfte gegen die dunklen Schatten der Benommenheit an.
Ungnädig parierten die Mexikaner bei ihm ihre schaumbedeckten Pferde. Die Gäule wieherten schrill und steilten. Staub wölkte aus dem dürren Gras.
Ohne jede Regung und mitleidlos starrten fünf Augenpaare auf den halb besinnungslosen Jungen hinunter. Locker lagen die Colts in den Fäusten der Bravados. »Worauf wartest du, Miguel?«, rief einer in das Prusten eines Pferdes hinein. »Leg ihn um!«
»Porque, Amigo, weshalb soll ich ihn umlegen?«, knurrte Miguel und musterte starr den Jungen, der seinen Oberkörper mit den Armen von der Erde wegdrückte und dessen Kopf haltlos vor der Brust baumelte.
»Willst du ihn etwa leben lassen?«
»Lassen wir es Paco entscheiden.«
»Maldito! Paco befindet sich in Mexiko. Soll das heißen, dass du den jungen Gringo über die Grenze mitschleppen willst?«
»Si, Sanchez.« Miguel nickte bedächtig. »Wir nehmen ihn mit nach Mexiko. Vorher aber wird er uns sagen, wo sie auf dieser Ranch das Geld versteckt haben.«
Ein gemeines Grinsen schlich sich in ihre Gesichter. Miguel sprang vom Pferd, stieß seinen Colt ins Halfter und ging steifbeinig zu Joey hin.
In den Schläfen des Jungen hämmerte das Blut. In seinen Ohren rauschte und dröhnte es. Er atmete keuchend.
Miguel stieß ihn mit der Stiefelspitze in die Seite. »Gewiss hast du verstanden, Amigo, was ich von dir wissen will«, schnarrte er mit hartem Akzent. »Also spuck schon aus, wo ihr auf der Ranch eure Bucks versteckt habt!«
»Was - was habt ihr verdammten Halsabschneider mit meinem Vater und den beiden alten Cowboys gemacht?«, frage Joey mit matter Stimme, als kostete ihm jedes Wort übermenschliche Anstrengung.
Miguel zog die Brauen in die Höhe. »Die drei alten Muchachos«, dehnte er abfällig, »waren dumm und stur. Sie wollten uns das Versteck des Geldes nicht verraten. Sabe Dios, es waren sehr mutige Männer. Aber jetzt sind sie tot. Und ihr ganzer Mut macht sie auch nicht wieder lebendig.« Miguel begann nach diesen Worten auf selbstgefällige und schreckliche Art zu lachen, ein Lachen, das wie seine dunklen Kohlenaugen ohne jede Freundlichkeit war.
»Ihr elenden Schweine!«, brach es entsetzt über Joeys rissige Lippen. »Drei alte Männer … Sie konnten euch kein Geld geben. Die gesamten Ersparnisse meines Vaters steckten in dem Zuchtbullen, den ihr niedergeknallt habt wie einen tollwütigen Hund.«
Joey kämpfte sich auf die Beine, stand schwankend wie ein Schilfrohr im Wind. In seinem eingefallenen, von Erschöpfung und Schmerz gezeichneten Gesicht arbeitete es. Schweißperlen glitzerten auf seiner Stirn.
Miguels Lachen war weggewischt. In den stechenden Blick des Banditen war eine unheimliche Drohung getreten. Ein schneller Schritt brachte ihn ganz nahe an Joey heran, dann schlug er zu.
*
»Caramba!«, zischte Miguel ungeduldig und bleckte die Zähne wie ein angreifender Wolf. »Spiel nur nicht den Helden, Amigo. Heraus mit der Sprache, presto! Wo sind die Dollars deines Vaters?«
»Du solltest es ihm lieber sagen, Compadre!«, giftete der Bursche, der den Namen Sanchez trug, und starrte Joey dabei tückisch an. »Miguel ist der Bruder Paco Estebans. Vielleicht sagt dir der Name etwas, Muchacho. Wenn ja, dann weißt du sicherlich Bescheid. Wenn nicht, dann solltest du trotzdem reden. Du kannst dir dadurch eine Menge Schmerzen ersparen.«
Joey wischte sich mit flatternden Händen das Blut von Mund und Kinn, äugte nach seinem Colt, der irgendwo im Gras lag. Miguel entging es nicht. Er grinste gemein. »Wenn du lebensmüde bist, kannst du ja versuchen, ihn zu erreichen«, sagte er, und der bösartige Spott in seiner Stimme war unverkennbar.
Joey seufzte. Paco Esteban … Der Name hallte in ihm wider. Natürlich kannte er ihn. Paco Esteban war wohl der übelste Verbrecher, der je das Grenzland zwischen Mexiko und den Staaten unsicher gemacht hatte.
El Vengador nannten ihn seine Anhänger, der Rächer, weil sie seinen Beteuerungen glaubten, dass er für sie, die Armen und Schwachen, Krieg gegen die mächtigen und reichen Unterdrücker führte.
El Satanas nannten ihn die anderen, jene, über die er Angst und Schrecken, Tod und Verderben gebracht hatte. Der Name allein verbreitete Angst und Bestürzung und ließ so manchem harten Mann einen eisigen Schauer den Rücken hinunterlaufen.
Paco Esteban - unberechenbar wie eine Raubkatze, verschlagen wie eine Klapperschlange, grausam wie ein wildes Tier.
Und vor ihm stand El Vengadors Bruder. Ebenso skrupellos und brutal.
Joey blickte dem Bravado in das wüste, von Lasterhaftigkeit gezeichnete Gesicht, sah die mörderische Besessenheit in den gelblich schimmernden Augen, den brutalen Ausdruck um den Mund, schaute in einen Abgrund von Niedertracht und Heimtücke.
Eine zentnerschwere Last legte sich auf Joeys Schultern. Hinter seiner Stirn wirbelten verworrene Gedanken. Die bisher heile Welt des Jungen stürzte im Bruchteil eines Augenblicks in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Gordon lag wie leblos unter dem zwischenzeitlich verendeten Falben. Sein Vater und die beiden Cowboys waren tot, waren gnadenlos ermordet worden. Er sollte nach Mexiko, in die Einöde der Sonora verschleppt werden, in der neben verkommenen Gesetzlosen nur noch Wölfe, Kojoten, Schlangen und hasserfüllte Banden versprengter Apachen ihr Unwesen trieben.
Alles in Joey Sand schrie auf. Nie zuvor in seinem Leben war er von einer derart quälenden und schrecklichen Gemütsverfassung beherrscht worden wie in dieser Minute.
Dann aber wurde ihm die Unabänderlichkeit seiner Situation voll und ganz bewusst. Eine Einsicht, die schlagartig alle Furcht von ihm nahm. Seine Hände wurden ruhig, in seinem Blick flammte es auf. Seine hagere, mittelgroße Gestalt straffte sich.
»Und wenn ihr mich umbringt«, stieß er verächtlich hervor, »ich kann euch kein Geld geben und auch kein Dollarversteck verraten. Dort, der Bulle, er war das Kapital der JS-Ranch. Ihr …«
Joey brach ab, als Miguel Esteban den Kopf in den Nacken warf und lauthals seinen Hohn hinauslachte. Verblüfft beobachtete der Junge den Banditen, sein Blick glitt an dessen Gestalt vorbei und suchte die vier Kerle, die lässig in den Sätteln lümmelten und ihn eisig anstarrten. Miguel hatte die Arme in die Seiten gestemmt und schien sich vor Lachen zu biegen.
Aber es war nichts weiter als eine gemeine Finte. Denn mitten aus seinem gellenden Gelächter zuckte sein rechtes Bein vor und traf schmerzhaft Joeys Magen. Sein Oberkörper wurde nach vorn geworfen, mit einem gellenden Aufschrei quittierte der Junge diesen fürchterlichen Tritt. Wie ein Erstickender rang er dann nach Luft, sein Gesicht lief dunkel an.
Eine knallharte Linke des Banditen ließ den Kopf Joeys wieder hochfliegen. Eine Rechte zischte hinterher und schlug dumpf auf. Der Blick des Jungen wurde glasig. Joey taumelte, wankte einige Schritte zurück, hob verzweifelt die Arme, als der Bandit hinterher setzte und erneut seine Fäuste fliegen ließ.
Joey wollte schreien, seinen Schmerz hinausbrüllen, doch kein Laut drang aus seiner Kehle. Rote Kreise begannen vor seinen Augen zu tanzen. Seine Beine wollten ihn kaum noch tragen. Schmerzvoll beugte er sich einem mörderischen Aufwärtshaken entgegen, der ihn wieder aufrichtete. Er schien zu wachsen, stand sekundenlang auf den Zehenspitzen und sackte dann in sich zusammen. Auf den angewinkelten Ellbogen blieb er liegen, ächzte ersterbend und spürte die bleierne Benommenheit, die sich mit dumpfem Druck auf sein Gehirn legte. Ein zusammenhangloses Gemurmel brach über seine aufgeplatzten Lippen.
Joey Sand war am Ende. Verschwunden war die innere Kraft, die noch vor wenigen Minuten für einige Herzschläge lang aus jeder Linie seiner Gesichtszüge gesprochen hatte. Und dann war da noch die Erschöpfung, diese bleierne Schwäche, die tief aus seinem Innersten kam und der Gewissheit entsprang, dass er ihnen chancenlos ausgeliefert war. Unterbewusst nahm er wahr, dass sie anderen Banditen absaßen. Wie aus weiter Ferne vernahm er Miguels verschwommene Stimme: »Stellt den Narren auf die Beine und haltet ihn gut fest! Ich werde ihn zur Hölle schicken, wenn er nicht das Versteck der Dollars verrät.«
Sie zerrten ihn in die Höhe. Halb besinnungslos hing er in ihren harten Fäusten.
»Es - es gibt kein Geld auf der JS-Ranch«, quoll es müde und kratzend aus Joeys Mund.
Miguel Esteban hob eine Faust. Sein dunkles Gesicht hatte sich wieder zu einer bösartigen Fratze verzerrt. Joey schloss die Augen, erwartete mit angehaltenem Atem den Schlag, aber er kam nicht.
Die Lider des Jungen flatterten wie im Fieber. Er sah, dass Miguel die Faust wieder sinken ließ. Die Miene des Bravados glättete sich. Heiser lachte der Bandit auf. Dann sagte er: »Bueno, ich will dir glauben, Amigo. Also lassen wir es gut sein. Wir werden uns mit den Rindern und Pferden deines Vaters begnügen. Du wirst uns helfen, sie nach Mexiko zu treiben.«
Joey versuchte, sich den stahlharten Fäusten, die ihn festhielten, zu entwinden. Es gelang ihm nicht. Sie umklammerten ihn noch härter. »Und wenn ich das nicht tue?«, schnaubte er, und für Sekunden loderte das Feuer des Widerstands noch einmal in ihm auf.
»Dann werde ich dich zerbrechen!« Hart und kalt stieß Miguel es hervor. Er schnippte mit den Fingern, starrte Joey an, und seine Augen glitzerten wie die eines Reptils.
Joey stand wie gelähmt, während Verlorenheit und Verzweiflung in langen, heißen Wogen durch seinen Körper pulsierten. »Was habt ihr mit mir vor in Mexiko?«, entrang es sich ihm schließlich wie unter einem inneren Druck.
»Mein großer Bruder wird sich deiner annehmen, Hombre. Du bist jung, mutig und stark. Burschen wie dich richtet er ab wie Kampfhunde. Und wenn Paco dich eines Tages von der Leine lässt, bist du einer von uns.«
Der Bravado beobachtete höhnisch grinsend den Jungen, als machte es ihm Freude, ihn zu quälen. All die Skrupellosigkeit, all das Böse, das in Miguel Esteban steckte, kam in seinem Blick zum Ausdruck.
Joey schaute hinüber zu der kleinen Ranch, die friedlich im blutigen Schein der untergehenden Sonne lag. So, als wollte er noch einmal alles in sich aufnehmen, was sein bisheriges Leben ausmachte - die grauen, flachen Gebäude, den Brunnen in der Hofmitte, die Corrals, die alten hohen Eichen hinter dem Haupthaus …
Und plötzlich kamen wieder die höllischen Schmerzen, die dunklen Schleier vor seinen Augen, die Übelkeit, die seinen Magen zusammenkrampfte …
*
Gordon Sand schlug die Augen auf. Das linke war blind vom geronnenen Blut. In seinen Schläfen dröhnte es. Er war benommen, und nur mühsam erinnerte er sich, was vorgefallen war.
Es war Nacht. Ein kühler Wind strich über ihn hinweg. Sein Bein, das unter dem Pferdeleib eingeklemmt war, fühlte sich taub an. Um ihn herum herrschte tiefe Ruhe, und er kam sich unter dem blinkenden Sternenhimmel winzig und verloren vor wie ein Staubkorn. Gordon fuhr sich mit der Zungenspitze über die spröden Lippen, atmete tief durch. Pulsierender Schmerz wallte von seinem Kopf bis in den Nacken und zwischen die Schulterblätter und ließ ihn stöhnen.
Gordon drehte den Oberkörper so, dass er zur Ranch hinüberblicken konnte. Als schwarze Kleckse machte er die Gebäude vor dem Mond- und Sternenlicht aus. Er ließ sich wieder ins Gras zurücksinken. Wo war Joey? Konnte der Junge sich retten, oder …
Gordon Sand machte sich große Sorgen. Sie verlieh ihm aber auch ungeahnte Kräfte. Mit einem Ruck brachte er sein Bein unter dem leblosen Tierkörper hervor. Der rasende Schmerz drohte ihm erneut die Besinnung zu rauben. Er schloss die Augen und kämpfte sekundenlang gegen das heftige Schwindelgefühl an, dann rappelte er sich auf. Schwankend stand er. Sein rechtes Bein war wie abgestorben. Zu Gordons Füßen lag die Winchester. Matt glänzten die Metallteile im unwirklichen Licht. Mühsam bückte der Mann sich, hob sie auf und stützte sich darauf wie auf eine Krücke. Und immer wieder kam die bohrende Frage nach dem Verbleib Joeys.
Humpelnd setzte Gordon sich in Bewegung. Ein kaum erträglicher Schmerz lief in Wellen durch seinen Körper. In seinem Kopf stach es wie tausend Nadeln. Nie vorher war ein Weg Gordon Sands mit so vielen Schmerzen verbunden gewesen wie dieser kurze Weg zur Ranch. Aber er schaffte ihn, schleppte sich zur Veranda hinauf, hinein in die Wohnstube. In dem Raum war es stockfinster. Aber Gordon hätte sich hier mit geschlossenen Augen zurechtgefunden. Er zündete die Laterne an, die auf einem Tischchen gleich neben der Tür stand. Die kleine Flamme flackerte und rußte. Gordon stülpte den Glaszylinder darüber und drehte den Docht höher. Gelber Lichtschein flutete bis in die Ecken, warf Gordons Gestalt groß und verzerrt an die Wand. Er konnte sich jetzt ohne Zuhilfenahme der Winchester bewegen. Das Kribbeln und Ziehen in seinem Bein ignorierte er.
Im Ranch-Office fand er seinen Vater. Old Jim war tot. Er hing halb über dem Schreibtisch. Am Boden lag sein Colt. Gordon hob ihn auf, klappte die Trommel heraus. Keine Kugel fehlte. Die Bravados hatten dem alten Mann keine Chance gelassen.
Gordon presste die Zähne aufeinander. Sein Atem ging stoßweise, und das Herz wollte ihm zerspringen. »Oh, mein Gott«, entfuhr es ihm krächzend, und er spürte, wie es ihm heiß in die Augen stieg.
Er schaute sich um. In dem Büro sah es aus, als hätten die Vandalen gehaust. Schranktüren standen offen, Schübe waren herausgerissen, der Inhalt lag verstreut auf dem Fußboden herum.
Gordon fuhr sich über die Augen. Schwer und kühl lag der Colt seines Vaters in seiner Rechten. Hart umspannte seine Faust den Knauf. Würgend schluckte er. Dann stieß er das Eisen ins Halfter an seinem rechten Oberschenkel und starrte auf den Toten. In Gordon kam ein nie gekannter Grimm auf. Alles in ihm rief nach Vergeltung.
Es gelang ihm kaum, seinen Blick von dem Getöteten zu lösen. Wie in Trance verließ er das Büro. Es trieb ihn in den Hof hinaus, hinüber in die Mannschaftsunterkunft. Er ahnte, was ihn erwartete, wollte aber dennoch Gewissheit haben.
Seine Ahnung hatte ihn nicht getrogen. Matt Banks und Jack Miles, die beiden grauhaarigen Cowboys, waren tot, erschossen wie sein Vater, wie Old Jim Sand. In Gordons Kopf schwirrte es. Er war wie betäubt. Wie im Fieber schlugen seine Zähne aufeinander. Die Schwäche kam zurück, und Übelkeit befiel ihn. Er taumelte nach vorn und sank auf die Knie. Vor seinem Blick schien der Boden zu wanken. Er riss ihn wieder in die Höhe.
Du darfst jetzt nicht schlappmachen! Du musst Joey suchen. Was ist aus ihm geworden? Du musst Joey finden.
Aber Joey war verschwunden. Schmerzhaft begriff es Gordon. Er begab sich in sein Zimmer. Im Spiegel betrachtete er sein Gesicht. Es sah furchtbar aus. Eingetrocknetes Blut, Schmutz und Schweiß bildeten eine Schicht auf der fahlen Haut und verliehen seinen Zügen etwas Unmenschliches, Dämonisches. Das fiebrige Glühen seiner rauchgrauen Augen verstärkte diesen Eindruck noch. Seine dunklen Haare waren verklebt vom geronnenen Blut. Er wusch sich. Schließlich tasteten seine Fingerkuppen die Ränder der gesäuberten Wunde auf seinem Schädel ab. Die Banditenkugel hatte eine tiefe Spur gezogen. Eine schmerzhafte, stark blutende Verletzung, aber harmloser, als er zunächst angenommen hatte.
Gordon holte Verbandszeug. Bald lag er auf dem Bett. Aber er fand keinen erholsamen Schlaf. Unruhig, von schlimmen Träumen gequält, warf er sich schweißgebadet auf seinem Lager hin und her.
Etwas in ihm war an diesem Tag zerbrochen, an diesem schicksalhaften Tag, der ihn auf die Fährte einer skrupellosen Mörderbande, auf die Fährte des Satans, treiben sollte. Immer weiter, ohne Erbarmen, ohne Gnade.
*
Über der weitläufigen, zerklüfteten Felswand im Osten färbte sich der Himmel von Rosa zu Gold, und der neue Tag brach mit prachtvollem Licht an. Auf den Gräsern lag frischer Tau, und der Morgendunst, der die Gebäude der JS-Ranch einhüllte, kündete glühende Tageshitze an.
Unruhe, Ungeduld und Rastlosigkeit hatten Gordon Sand noch vor Tagesanbruch aus dem Haus getrieben. Und als der kühle Morgenwind den Dunst zerpflückt und fortgetrieben hatte und nur mehr aus dem Fluß die Nebel wie weißer Rauch stiegen, hatte er in schweißtreibender Arbeit drei Gräber ausgehoben. Nacheinander holte er die Toten ins Freie. Er schlug ihre steifen Körper in Segeltuchplanen und legte sie in die Gruben. Dann sprach er ein kurzes Gebet. Sein Mund formte die Worte, aber seine Gedanken waren nicht dabei. Sie waren finster wie ein Höllenschlund. Während er betete, schien sich sein Blick in weiter Ferne zu verlieren, und als das »Amen« über seine Lippen war, kerbte wilde Entschlossenheit scharfe Linien um seinen Mund.
Er schaufelte die Gräber zu, fertigte aus Brettern drei Kreuze und stieß sie in das lose Erdreich. Dann stand er noch eine Weile vor den flachen Hügeln. Nichts war Gordon Sand geblieben, außer seinen Waffen und seinem Leben. Rinder und Pferde hatten die Bravados weggetrieben. Joey hatten sie verschleppt, seinen Vater ermordet. Es gab nichts mehr, was ihn hier hätte halten können.
Mit brennenden Augen starrte er auf die drei Gräber. Dann wanderte sein Blick hinüber zu den wie ausgestorben anmutenden Ranchgebäuden. Die letzten Beweisstücke einer Illusion, die vor vielen Jahren seinen Vater bewogen hatte, in diesem Teil des Landes Fuß zu fassen und zu ranchen. Hier wollte Old Jim Sand nach dem Tod seiner Frau Ruhe und Frieden finden und einem geruhsamen Lebensabend entgegensehen. Mörderhand hatte diese Illusion brutal zerstört und Gordon Sands Leben innerhalb weniger Stunden von Grund auf verändert.
Kurze Zeit verloren sich Gordons Überlegungen in der Vergangenheit. In sie hinein drängten sich aber bald die Gedanken an die Zukunft. Sie allerdings zeigte sich ihm finster wie die Nacht, die hinter ihm lag.
Sein Mund trocknete aus. Langsam, fast schwerfällig, wandte er sich ab. Er holte seine Winchester aus dem Wohnhaus. Ohne sich noch einmal umzuwenden marschierte er davon, hinein in die Schwaden der Flussnebel, die vom Black Draw her wallten. Er nahm dem toten Falben den Sattel ab und warf ihn sich auf die Schulter.
Langsam stieg die Sonne höher. Bald war Gordon unter seiner Kleidung klatschnass vom Schweiß. Bis Douglas lagen noch nahezu fünfundzwanzig Meilen vor ihm.
Am Stadtrand von Douglas brach Gordon Sand zusammen. Sein ausgemergelter, vom Blutverlust geschwächter Körper hielt den Strapazen nicht mehr länger stand. Er stürzte mit dem Gesicht in den knöcheltiefen Staub, und um ihn herum versank alles.
Es war später Nachmittag. Menschen scharrten sich um ihn, standen bald Schulter an Schulter, stellten Vermutungen an und gestikulierten.
Ein Mann bahnte sich einen Weg durch die Menge. Der Sheriffstern zierte sein Hemd. Er beugte sich über Gordon Sand, erkannte ihn und rief in die Menge: »Den Doc! Schnell! Doc Corby muss her!« Ein Halbwüchsiger rannte davon. Sheriff Ron Flaherty richtete sich auf, fixierte herausfordernd einige Männer. »Tragt ihn ins Jail und legt ihn auf eine der Pritschen. Aber geht vorsichtig mit ihm um. Der Junge sieht aus, als wäre er mehr tot als lebendig.«
Sie hoben Gordon hoch, brachten ihn fort. Ein junger Kerl schleppte die Winchester und den verstaubten Sattel hinterher. Sheriff Flaherty folgte. Die Menge verlief sich. Nach einer halben Stunde hatte Doc Corby den Ranchersohn versorgt. Ein sauberer weißer Verband wand sich um seinen Kopf. Der Sheriff gab Gordon zu trinken, indem er ihm mit einer Hand den Kopf stützte und ihm mit der anderen die Flasche an die Lippen hielt. Gordons Kehlkopf bewegte sich auf und ab. Plötzlich verschluckte Gordon sich und hustete. Sein Gesicht lief dunkel an. Der Sheriff zog die Hand mit der Flasche zurück und ließ Gordons Kopf zurücksinken.
Nach und nach kam Gordon zu sich. Seine entzündeten Lider flatterten. Seine Nasenflügel begannen zu zittern, er öffnete den Mund, wollte etwas sagen, aber die Stimme gehorchte ihm nicht.
»Er ist fertig«, murmelte Doc Corby und warf dem Sheriff einen viel sagenden Blick zu.
»Ja. Kein Wunder, wenn er den ganzen Weg von seiner Ranch bis in die Stadt zu Fuß zurückgelegt hat. Möchte wissen, was da draußen passiert ist.«
»Er hat den Weg zu Fuß zurückgelegt«, knurrte der Arzt und betonte das Wörtchen »hat« ganz besonders. »Die Haut an seinen Füßen hängt in Fetzen und der Sonnenbrand in seinem Gesicht … He, er ist wach. Haben Sie einen Brandy, Sheriff? Ein Schluck wird seine Lebensgeister endgültig zurückholen.«
»Natürlich habe ich welchen.« Der Gesetzeshüter nickte. »Machen Sie Licht, Doc. Dort steht die Laterne, auf dem Regal. Streichhölzer liegen daneben. Ich hole den Schnaps.«
Fußbodendielen und Stiefelsohlen knarrten, harte Lederabsätze tackten. Eine Schranktür quietschte in den Angeln, Lichtschein flackerte, schwankte wie gelber Nebel vor Gordons Augen und blendete ihn. In seinem Schädel klopfte und hämmerte es.
Sheriff Flaherty flößte ihm einen Schluck Brandy ein. Die scharfe Flüssigkeit trieb Gordon das Wasser in die Augen und nahm ihm sekundenlang die Luft. Aber sie riss ihn endgültig aus seiner Betäubung. Er sah die starren, verschwommenen Gesichter Sheriff Flahertys und Doc Corbys über sich, nahm den erwartungsvollen Ausdruck in ihren Augen wahr, atmete tief durch und flüsterte brüchig: »Greaser — mexikanische Bravado — haben die Ranch …« Würgend schluckte er, der Rest seines Satzes hatte sich in unverständlichem Gemurmel verloren.
»Weiter, Sand, rede!«, drängte der Sheriff und rüttelte leicht an den Schultern des völlig erschöpften Mannes, weil er befürchtet, Gordon könnte wieder besinnungslos werden.
»Yeah«, krächzte Gordon. »Yeah, Sheriff, Sie werden alles erfahren. Alles … Hören Sie, mein Dad und die beiden Cowboys sind tot. Joey haben die Hundesöhne verschleppt.« Gordon räusperte sich. Seine Stimme hatte an Kraft gewonnen. »Die Rinder und Pferde der JS-Ranch haben sie abgetrieben.« Er verstummte keuchend.
»Gütiger Himmel«, flüsterte der Doc.
Das war der Augenblick, da wieder der lodernde Hass Gordon übermannte, jäh und wild wie eine Sturmwoge.
»Ich werde die Kerle zur Rechenschaft ziehen«, schwor er, und jedes seiner Worte fiel wie ein Schlag in die Stille. »Und wenn es das letzte ist, was ich in meinem Lebe tue. Ich vergelte es diesen Schuften, was sie an Unglück über uns Sands gebracht haben.«
Es hatte wie eine düstere Prophezeiung geklungen. Lähmende Stille trat ein. Es war, als wäre der kalte Hauch des Todes durch die Zelle und das Office gezogen. Betroffen sahen sich Sheriff Flaherty und der Arzt an.
*
Einsam und verloren durchstreifte Gordon Sand monatelang das bizarre Grenzland auf der Suche nach Joey und den Banditen. Er fand heraus, dass der Anführer der Bravados Paco Esteban war. Wo immer er in Mexiko aber nach ihm fragte, erntete er nur ein nichts sagendes Achselzucken als Antwort, begegnete er Angst und Schrecken. Es trieb ihn weiter, immer weiter.
Die Entbehrungen furchten sein Gesicht und ließen es bald älter wirken, als es tatsächlich war. Abgemagert und stoppelbärtig kehrte er nach Douglas zurück. Er fragte Sheriff Flaherty nach neuesten Meldungen über die Grenzbanditen.
Der Gesetzeshüter schüttelte nur den Kopf. Dann meinte er: »Gib es endlich auf, Gordon. Wahrscheinlich lebt dein kleiner Bruder längst nicht mehr. Du jagst einem Phantom hinterher und machst dich dabei fertig. Heavens, kehr auf deine Ranch zurück und bewirtschafte sie. Alle Rinder haben die Bravado nicht fortgetrieben. Sie streunen herrenlos durchs Valley, und jeder verdammte Viehdieb sieht sie als sein Eigentum an. Gib deinen irrsinnigen Vorsatz auf, Gordon und vergiss Joey.«
Gordon schaute den Sheriff an, als zweifelte er an dessen Verstand. Und dann erwiderte er: »Niemals, Sheriff. Wenn Joey noch lebt, dann finde ich ihn. Und ich bringe ihn nach Hause.«
»Ich werde dich nicht aufhalten können, Gordon. Aber du wirst aufpassen müssen, dass du nicht an deinem eigenen Hass erstickst. Hass führt einen Mann leicht in den Abgrund.«
Gordon verließ ihn. Und Flaherty schaute hinter ihm her, als Gordon über die Main Street stapfte und seine Stiefel den knöcheltiefen Staub schaufelten.
Wenige Stunden später versank hinter Gordon wieder die Stadt im flirrenden Sonnenglast. Die Nase seines Pferdes zeigte nach Süden. Und was Gordon Sand im Herzen trug, war gefährlicher und tödlicher als der schwere 45er, der tief an seiner rechten Hüfte im Halfter steckte.
*
Als die Sonne im Westen versank, erreichte er Agua Prieta, ein ödes, mexikanisches Grenzdorf. Er steuerte die Pulqueria an. Fünf Sattelpferde waren am Hohn angeleint. Sie waren verstaubt, verschwitzt und abgetrieben, und es war deutlich, dass sie noch nicht versorgt worden waren.
Gerade, als Gordon absaß, bog ein Peon hinter dem flachen Adobebau hervor und kam auf die Pferde zu. Überrascht starrte er den Amerikaner an.
»Buenas Noches«, grüßte Gordon und fixierte seinerseits ebenfalls den Jungen. »Wem gehören diese Pferde?«
Der Peon kratzte sich hinter dem Ohr, dann antwortete er: »Sie gehören einem Rurales-Capitán und vier seiner Leute. Wenn Sie gescheit sind, Señor, dann reiten Sie auf der Stelle weiter. Vielleicht haben Sie Glück, und die Rurales haben Ihre Ankunft noch nicht bemerkt. Andernfalls werden sie Ihnen eine Menge unangenehmer Fragen stellen.«
Gordon zog seinen Vierbeiner näher an den Holm heran. »Versorgst du ihre Pferde?«
»Si, Señor.«
»Gut. Versorge meins auch gleich mit.« Er langte in die Tasche und warf dem Burschen einen Vierteldollar zu. Der Peon fing ihn geschickt auf und ließ ihn schnell in der Tasche seiner zerschlissenen Leinenhose verschwinden. »Gracias, Señor. Aber der gute Rat, den ich Ihnen gegeben habe, wäre umsonst gewesen.« Ängstlich blickte er zur Tür der Kneipe.
»Das ist schon in Ordnung, mein Junge«, murmelte Gordon und reichte ihm die Zügel.
Steifbeinig ging er hinein, der sorgenvolle Blick des Jungen folgte ihm, schließlich aber seufzte der Pferdeboy und er machte sich an den Zügelleinen der Ruralesgäule zu schaffen.
Hinter der Theke hantierte ein fetter, schmieriger Bursche mit herausquellenden Froschaugen. An einem der Tische saßen die fünf Grenzreiter. Ihre dunklen Uniformen waren verstaubt. Sie tranken Bier. Der blakende Schein des Talglichts in der Tischmitte warf zuckende, geisterhafte Reflexe über ihre dunklen Gesichter und ließ die Schatten ihrer Gestalten nach allen Seiten auf den Fußboden fallen. Andere Gäste waren nicht anwesend.
Ohne zu zögern strebte Gordon der Theke zu. Die Rurales beobachteten ihn unter halb gesenkten Lidern hervor. Und in ihren Blicken war nicht ein Hauch von Freundlichkeit. Gordon legte die Hände flach auf den Tresen und sah den Wirt an. Er erkannte die Unruhe in dessen Miene und fragte: »Können Sie mir ein Zimmer vermieten, Señor? Nur für diese Nacht. Morgen reite ich weiter. Ich zahle mit guten, amerikanischen Dollars.«
Der Kneipenbesitzer riss seinen Blick von Gordons Gesicht los, ließ ihn zu den Rurales hinüber wechseln, und im gleichen Moment vernahm Gordon das Rascheln von rauem Stoff, das Rücken eines Stuhls und dann tackende Stiefeltritte, die sich ihm von hinten näherten. Seine Hände glitten vom Tresen, langsam wandte er sich um. Der Rurales-Capitán blieb zwei Schritte vor ihm stehen. Er maß Gordon von oben bis unten, dann fragte er barsch: »Woher kommst du, Americano, und was ist dein Ziel?«
Gordon fixierte den Mann. »Ich komme geradewegs aus den Staaten, Capitán«, erwiderte er gleichmütig.
Der Rurales strich über seinen Schnurrbart, legte den Kopf ein wenig schief. »Du bist illegal über die Grenze gekommen, nicht wahr?«
»Vielleicht habe ich allen Grund dazu«, gab Gordon grimmig zurück.