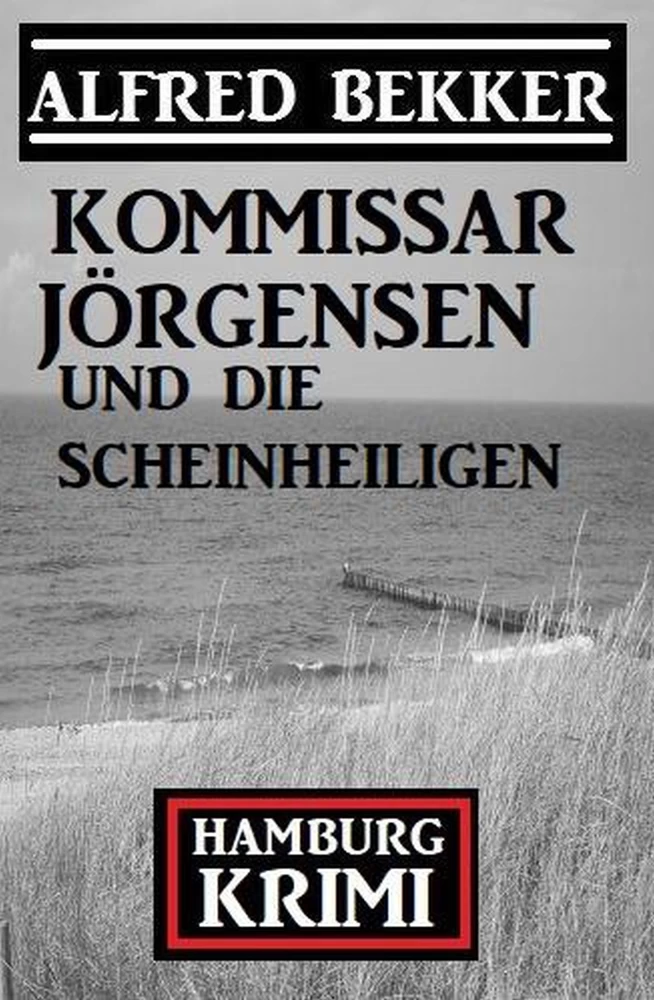Zusammenfassung
Rücksichtslose Anschläge auf Kliniken fordern Menschenleben. Die Ermittler kommen einer radikalen Sekte auf die Spur, die die moderne Welt ablehnt und in ihr nur einen Ort der Sünde und Gottlosigkeit sieht. Doch dann stellt sich heraus, dass dahinter nicht nur eine kleine Gruppe fehlgeleiteter Fanatiker steckt, sondern eine Verschwörung, die tief in die Kreise des organisierten Verbrechens hineinreicht ...
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton Reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
 |  |

Copyright

Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Alles rund um Belletristik!
 |  |

Kommissar Jörgensen und die Scheinheiligen

von Alfred Bekker
 |  |

1

Die Grenze zwischen heilig und scheinheilig ist manchmal fließend.
»Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind, Herr Kriminalhauptkommissar«, sagte der Pastor, nachdem der Gottesdienst vorbei war.
Ich war noch ein bisschen sitzen geblieben.
Niemand nennt in Deutschland jemanden ‘Herr Kriminalhauptkommissar’.
Nicht mehr jedenfalls.
Das ist lange her, dass sowas üblich war.
Man sagt den Namen und Herr oder Frau davor. Aber keinen Rang.
Das hat sich nur bei der Bundeswehr und in der Seefahrt gehalten.
Aber sonst nirgendwo.
Dass der Pastor es trotzdem tat, hatte seinen Grund.
Er hätte auch sagen können: »Herr Jörgensen, schön, dass Sie mal wieder hier sind.« Aber das tat er nicht.
Und so, wie ich ihn kannte, wollte er mir durch seine Ausdrucksweise etwas deutlich machen. Zum Beispiel, dass ich es überwiegend mit der dunklen Seite der irdischen Welt zu tun hatte und es mir vermutlich deshalb schwerfiel, an einen guten Gott zu glauben. Wir hatten uns darüber mal länger unterhalten, der Pastor und ich. Dass ich trotzdem ab und zu in die kalten dicken Mauern der Kirche fand, hatte mit der Atmosphäre zu tun, die hier herrschte. Die mochte ich. Und vielleicht tröstete sie mich sogar ab und zu.
»Ein echter Hamburger geht nicht zur Kirche«, sagte der Pastor und lächelte hintergründig.
»Wer hat das gesagt?«, fragte ich.
»Mein Vater.«
»Ach!«
»Der war Hafenarbeiter. Und Kommunist. Und ziemlich früh tot.«
»Das tut mir leid.«
»Er ist vom Kran gefallen.«
»Oh.«
»Tja, so ist das eben.«
»Dann sind Sie was ganz anderes geworden, als Ihr Vater.«
»Richtig. Man muss ja nicht die Fehler anderer wiederholen.«
»Da gebe ich Ihnen Recht.«
»Besser, man macht seine eigenen - Fehler.«
»Auch da gebe ich Ihnen Recht.«
»Auf jeden Fall war es kein Fehler, hierher zurückzukehren«, sagte der Pastor. »Zum Vater.«
»Mit meinem Vater habe ich keine Probleme.«
»Ich meinte den himmlischen Vater.«
»Mit dem hätte ich schon das eine oder andere Hühnchen zu rupfen.«
»Sehen Sie!«
*

Dies ist ein Ort Satans, flüsterte die Stimme in Robin Dehmelts Hinterkopf. Der Mann im blauen Overall trug einen Werkzeugkoffer in der Rechten. Er blieb kurz stehen, blickte sich um. OP – KEIN ZUTRITT stand auf einer grauen Tür, die sich automatisch öffnete. Zwei Krankenschwestern im lindgrünen Dress schoben ein Pflegebett auf den Flur. Eine junge Frau lag darin. Sie hatte die Augen geschlossen, hing am Tropf. Dehmelt betrachtete sie kurz.
Wahrscheinlich auch eine dieser Frauen, die nichts dabei finden, die ungeborene Seele in ihrem Bauch zu töten, durchzuckte es ihn. Rob Dehmelt war überzeugt davon, dass Gott ihn dazu ausersehen hatte, dieser Sünde Einhalt zu gebieten.
»Sodom und Gomorrha hat der Herr gerichtet«, murmelte er kaum hörbar vor sich hin. Wie eine Beschwörungsformel klang es. Auch die Hure Hamburg, das neue Babylon, wird dem Zorn des Herrn nicht entgehen!, durchfuhr es ihn. Und ich bin sein blutiges Richterschwert ...
 |  |

2

»Hier ist kein Zutritt!«, sagte eine der Schwestern.
»Ich muss in Raum 324. Wegen der Klimaanlage!«
»Nächste Tür rechts«, rief sie im Vorübergehen. Dann setzte sie noch lächelnd hinzu: »Aber Vorsicht! Das ist die Umkleide der Krankenschwestern auf dieser Station.«
Aber Rob Dehmelt lächelte nicht zurück. Sein Gesicht blieb eine starre Maske.
Unzüchtige Huren!, durchzuckte es ihn. Ausgeburten der Sünde. Kein Wunder, dass es ihr nichts ausmacht, an einem Ort zu arbeiten, an dem täglich Kinder ermordet werden.
Die junge Frau im lindgrünen Schwestern-Dress bemerkte das nicht. Sie war schon an ihm vorbeigeeilt.
Dehmelt setzte seinen Weg fort.
Einen Augenblick später stand er vor Nummer 324.
Er klopfte.
Keine Antwort.
Dehmelt öffnete die Tür.
Der Umkleideraum war gut zwanzig Quadratmeter groß und fensterlos. Das Licht wurde automatisch durch einen Bewegungssensor aktiviert. Ein Großteil der Wandflächen war von verschließbaren Kleiderschränken verdeckt. Bis auf eine Nische auf der linken Seite.
Dort befand sich ein etwa ein Meter mal ein Meter großes Rost, hinter dem sich der Zugang zu einem Belüftungsschacht befand. Dehmelt ging dorthin, kniete nieder.
Aus der Beintasche seines Overalls zog er einen Schraubenzieher hervor. Das Metallgitter war schnell gelöst. Dehmelt stellte es zur Seite, öffnete dann den Werkzeugkoffer. Ein kastenförmiger Apparat befand sich darin. Dehmelt hob ihn heraus, schob ihn ein Stück in den röhrenförmigen Schacht hinein.
Euer sündiges Handwerk wird euch gelegt werden, ging es Robin Dehmelt grimmig durch den Kopf. Der Herr hat Sodom und Gomorrha mit Feuer und Schwefel gestraft, weil sich keine Gerechten in ihren Mauern finden lassen wollten. So ist es auch hier ...
Dehmelt aktivierte den Apparat, in dem er einen kleinen Hebel umlegte. Eine Anzeigennadel schlug aus, ein Lämpchen blinkte.
Die starken elektromagnetischen Impulse, die dieses Gerät abgab, würden ihr Werk schon vollenden.
In Sodom und Gomorrha war das Schwefelfeuer vom Himmel gefallen, in diesem Fall blieb es sogar unsichtbar.
Einen Moment lang dachte Dehmelt an das, was nun geschehen würde. An die Störung oder sogar den Ausfall von elektronisch gesteuerten medizinischen Geräten. Daran, dass Herz-Lungen-Maschinen zum Stillstand kamen, dass Ultraschall und Röntgengeräte ausfielen, dass Patientendaten nicht mehr abrufbar waren. Selbst die Pieper der Ärzte arbeiteten bald innerhalb eines gewissen Bereichs nicht mehr zuverlässig.
Vielleicht werden auch Unschuldige zu leiden haben, dachte Dehmelt. Er atmete tief durch. Blick nicht zurück, wie Lots Frau, die zur Salzsäule wurde, durchzuckte es ihn. Was jetzt geschieht, ist gerecht! Kein Erbarmen mit der Sünde!
Mit ein paar Handgriffen setzte Dehmelt das Metallgitter wieder an seinen Platz, erhob sich, nahm den Werkzeugkoffer und ging hinaus auf den Flur.
Dehmelt hatte den Aufzug noch nicht erreicht, da sah er bereits alarmierte Ärzte und Schwestern durch die Flure eilen.
Auf den Mann im blauen Overall achtete niemand.
 |  |

3

Zwei Wochen später ...
»Scheiße, ich mag weder Cappuccino, noch kann ich diese verdammten Itaker ausstehen!«, sagte der Mann mit den gelockten Haaren. Er saß Roy und mir an einem der kleinen runden Tische von Antonio's Coffee Shop in der Elisabeth Straße in Hamburg gegenüber.
»Warum haben Sie dann ausgerechnet diesen Ort als Treffpunkt angegeben?«, fragte ich.
Der Lockenkopf beugte sich vor.
Er kicherte.
»Weil jeder, der mich kennt, das weiß und niemals vermuten würde, dass ich mich ausgerechnet hier mit Kriminalhauptkommissar Uwe Jörgensen und seinem Kollegen Kriminalhauptdingsbums Roy Müller treffen würde!«
Ich sagte: »Behalten Sie Ihre Ansichten über Italiener hier trotzdem besser für sich!«, erwiderte ich.
Der Lockenkopf hieß Ronny Ochmann. Er war Mitbesitzer eines Clubs namens ,VENGA‘ in Altona und darüber hinaus in alle möglichen undurchsichtigen Geschäfte verwickelt. Als Informant bot er sich uns allerdings zum ersten Mal an.
»Kommen wir zur Sache!«, forderte mein Freund und Kollege Kriminalhauptkommissar Roy Müller. »Angeblich wissen Sie etwas über bevorstehende Terroranschläge in Hamburg und Umgebung.«
Ronny Ochmann lächelte dünn.
»Sie müssen mir erst garantieren, dass Sie den Mann, um den es geht, umgehend aus dem Verkehr ziehen. Sonst ist mein Leben keinen Cent mehr wert.«
»Dazu müssten wir erst einmal wissen, ob an Ihren Aussagen etwas dran ist«, erwiderte Roy.
Ronny Ochmann setzte ein Pokerface auf.
Ich fragte mich, was dieser Mann für ein Motiv haben mochte, sich mit uns an einem Tisch zu setzen. Finanzielle Forderungen hatte er bislang nicht gestellt. Nach allem, was wir über Ochmann wussten, war er auf die paar Euro, die sich ein Informant bei uns verdienen konnte, auch nicht angewiesen. Es musste einen Grund dafür geben, dass dieser krumme Hund auf einmal seine Pflichten als gesetzestreuer Staatsbürger entdeckt hatte. Entweder er saß selbst in der Klemme oder er wollte jemand anderem schaden.
»Sie wissen, wie das in einem Club wie dem ,VENGA‘ ist«, erklärte er. »Da gehen viele Leute ein und aus, der Champagner, die Girls ... Da redet der eine oder andere schon mal ein bisschen mehr, als er es unter normalen Umständen tun würde ...«
»Verstehe«, nickte ich. Im Klartext hieß das wahrscheinlich, dass Ochmann jemanden abgehört hatte. Zumindest lag diese Vermutung nahe.
»Ich möchte betonen, dass ich mit der Sache, um die es geht, nicht das Geringste zu tun habe und nur durch Zufall darauf gestoßen bin.«
»Ich hoffe, es kommt noch etwas mehr als heiße Luft, sonst vertun wir hier nur unsere Zeit«, warf Roy ein.
Für Wichtigtuer war uns die Zeit zu schade.
Ochmann verzog das Gesicht.
»Da war ein Mann bei mir im Club, der über einen Deal sprach, bei dem es um sehr starke Mikrowellen-Sender ging. Verdammt, ich hatte es nie so mit der Schule und hab' keine Scheiß-Ahnung von Physik oder solchem Zeug! Für's Leben reicht es doch, wenn man die Wörter HERREN und DAMEN lesen kann, damit man die richtige Toilette findet.« Er kicherte dreckig. »Ich gehe natürlich dahin, wo DAMEN steht ...«
»Sehr witzig, Herr Ochmann«, erwiderte ich kühl.
»Ja, nicht wahr?«
»Naja...«, sagte ich.
Roy Müller sagte: »Humor ist, wenn man trotzdem lacht.«
Ochmann beugte sich vor, sprach in gedämpftem Tonfall und schob den Cappuccino zur Seite.
»Ich bin erst stutzig geworden, als der Typ über die Wirkungsweise dieser Mikrowellensender schwadronierte. Er faselte etwas in der Art daher, dass die Impulse, die diese Dinger abgeben, alles stören, was irgendwie mit Computern zu tun hat. Wenn es einem gelingt, so etwas in einen Flughafen hineinzubringen, dann lässt sich die Leitzentrale derart stören, dass ein Chaos entsteht. Kollisionen und Abstürze sind die Folge.« Er kicherte erneut und fuhr fort: »Oder stellen Sie sich mal vor, die Rechner im Polizeipräsidium arbeiten nicht mehr und Sie können Ihre Fahndungsdateien nicht mehr zuverlässig abrufen!«
Ich wechselte einen kurzen Blick mit Roy.
Alles heiße Luft, schien der Blick meines Kollegen zu sagen.
Ich war mir noch nicht sicher.
Es gab Leute, die sogar einen Mord gestanden, den sie nicht begangen hatten, um sich sich wichtig zu machen. Aber in die Kategorie der Wichtigtuer gehörte Ochmann für meine Begriffe nicht.
»Bis jetzt ist das alles etwas dünn, was Sie uns da präsentiert haben«, erklärte ich. »Wie heißt der Typ?«
»Jimmy Tillner.«
»Jimmy? Echt jetzt?«
»Ja.«
»Sagt mir nichts.«
»Eine aufstrebende Nummer auf St. Pauli. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er den Deal auch nur vermittelt und dafür Provision kassiert. Nehmen Sie ihn hops und fühlen Sie ihm auf den Zahn. Dann wissen Sie mehr!«
»Der Besitz und Verkauf von derartigen Sendeaggregaten ist nicht strafbar«, stellte ich klar.
»Nein, das nicht. Aber überlegen Sie mal, wer so etwas brauchen könnte! Ich habe mich ein bisschen informiert. Normalerweise versucht man die elektromagnetischen Abstrahlungen von elektronischen Geräten wie Computern oder Handys so gering wie möglich zu halten, damit sich die Dinger nicht gegenseitig stören. Aber wenn jemand sich ein Gerät zusammenbasteln lässt, dass genau das Gegenteil bewirkt, dann ist doch klar, was der will.«
»Was Sie nicht sagen ...«
»Es gibt übrigens eine Video-Aufzeichnung, auf dem ein Teil des Gesprächs drauf ist.«
»Habe ich es mir doch gedacht, Sie hören Ihre Gäste ab«, sagte ich. »Erpressen Sie sie hinterher mit den Aufnahmen?«
»Die Aufnahmen entstehen nur aus Sicherheitsgründen.«
»Darum sind die Kameras auch vermutlich so angebracht, dass man sie nicht sieht.«
»Nein, das hat ästhetische Gründe.«
»Ach!«
»Hören Sie, Herr Jörgensen, man kann das meiste, was die beiden Männer auf dem Video sagen, nicht verstehen, aber Sie werden sicher über Spezialisten im Lippenlesen verfügen, so dass Sie noch mehr herausfinden könnten.«
»Wo ist das Video?«
»An einem sicheren Ort.«
»Und Sie geben es nur heraus, wenn wir auf Ihre Bedingungen eingehen.«
»Jimmy Tillner bringt mich um, wenn er davon erfährt. Und wenn es nicht möglich ist, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, dann muss ich eben verschwinden.«
»Sie sprechen vom Zeugenschutzprogramm?«
»Ja.«
Ich lehnte mich zurück. Dabei fragte ich mich, ob Ochmann uns am Ende nur dazu missbrauchen wollte, ihm bei seinen Schwierigkeiten mit Jimmy Tillner zu helfen, die im Hintergrund offenbar irgendeine Rolle spielten.
Eine Art roter Blitz zuckte durch die Luft. Der Strahl eines Laserpointers wurde durch die große Fensterscheibe gebrochen. Ich zuckte herum, instinktiv glitt die Hand zur Dienstwaffe vom Typ SIG Sauer P 226. Ich sah zum Fenster, hatte einen freien Blick auf die von zahllosen Passanten belebte Elisabeth Straße.
Bevor ich irgendetwas tun konnte, durchschlug ein Projektil die Scheibe. Von einem daumennagelgroßen Loch aus verzweigten sich spinnennetzartig die Risse durch das Glas.
Die Kugel traf Ronny Ochmann mitten in die Brust. Sein Körper zuckte zusammen.
Er öffnete den Mund, so als wolle er schreien.
Ein zweiter Schuss bohrte sich mitten zwischen die Augen.
Er sackte zu Boden.
Fast gleichzeitig brach aus der Reihe der am Straßenrand parkenden Fahrzeuge ein Ford Maverick heraus und brauste mit quietschenden Reifen davon.
Ich sprang auf, zog die SIG und sprang mit der rechten Schulter voran durch das Fenster. Das durch die Einschüsse beschädigte und von langen Rissen durchzogene Glas setzte mir keinen Widerstand mehr entgegen. Ich schützte meine Augen mit dem Arm vor dem Scherbenregen. Hart kam ich auf dem Asphaltboden auf, rollte mich ab. Passanten stoben zur Seite, starrten mich an.
Ich rappelte mich auf, schüttelte mir notdürftig die Scherben aus den Haaren und sprintete los. Eine Phalanx aus parkenden Autos verhinderte, dass ich dem Ford Maverick auf der Stelle mit meiner SIG ein Loch in den Hinterreifen brennen konnte.
Mit einem Satz war ich auf dem Kofferraum eines Mercedes, mit einem weiteren stand ich auf dem Dach.
Die SIG fasste ich mit beiden Händen, legte an.
Feuerte.
Der erste Schuss kratzte am Kotflügel des Maverick, der zweite ließ den Reifen hinten links platzen, kurz bevor der Wagen die nächste Kreuzung erreichte.
Der Maverick brach zur Seite aus, krachte in einem am Rand abgestellten Lieferwagen hinein. Ich sprang von dem Mercedes-Dach, rannte in geduckter Haltung auf den Maverick zu.
Dessen Tür ging auf.
Ein Mann mit Baseballkappe und einem Scharfschützengewehr vom Typ K16 stürzte hervor.
Der Strahl des Laserpointers tanzte durch die Luft, als er anlegte.
Ich duckte mich.
Der Schuss ging knapp an mir vorbei. Bevor mein Gegenüber ein zweites Mal abdrücken konnte, feuerte ich zurück, traf ihn in die Schulter. Die Wucht, mit der das Projektil seinen Körper durchschlug und auf der anderen Seite wieder austrat, riss ihn zurück.
Ein Schuss löste sich aus seinem K16-Gewehr, ging aber ins Nichts. Er taumelte zurück, prallte gegen den Maverick. Ich setzte nach, den Lauf der SIG immer in seine Richtung gewandt.
»Kriminalpolizei! Waffe fallen lassen!«, schrie ich.
Aber daran dachte der Killer nicht im Traum. Er ließ den Lauf des K16-Gewehrs wieder hochzucken, versuchte einen Schuss aus der Hüfte und ließ mir damit keine andere Wahl. Bevor er abzudrücken vermochte, feuerte ich meine SIG ab. Die Kugel traf den Killer mitten in der Brust. Er rutschte am Blech des Maverick hinunter und zog eine blutige Schmierspur hinter sich her. Seine Augen waren starr.
Ich senkte inzwischen den Lauf meiner SIG.
Mein Kollege Roy Müller tauchte hinter mir auf, ebenfalls mit der SIG in der Hand.
»Alles klar, Uwe?«
»Wie man's nimmt.«
Fragen würde uns der Killer auf jeden Fall nicht mehr beantworten können.
Ich ging auf die Leiche zu.
In seiner rechten Jackentasche steckte ein Führerschein. Ich nahm ihn heraus. Er war auf den Namen Georg Braun ausgestellt. Darunter war eine Adresse in Veddel angegeben.
Eine Viertelstunde später war die Elisabeth Straße von den Kollegen der Polizei für den normalen Verkehr gesperrt worden. Gut ein Dutzend Einsatzfahrzeuge drängelten sich in der Nähe von Antonio's Coffee Shop. Kollegen von der Zentralen Spurensicherung waren ebenso eingetroffen wie unsere eigenen Erkennungsdienstler Frank Folder und Martin Horster. Die gehörten zu der Sonderabteilung, für die auch Roy und ich tätig waren. Dazu weitere Fahrzeuge unserer Fahrbereitschaft und der Wagen des Gerichtsmediziners, mit dem die Leichen von Ronny Ochmann und dem Killer namens Georg Braun abtransportiert wurden.
»Scheint mehr dran zu sein an der Geschichte, die Ochmann uns da erzählt hat, als ich erst dachte«, meinte Roy.
Mein Kollege klang ernst.
»Jedenfalls war es jemandem verdammt viel wert, ihn aus dem Weg zu räumen«, murmelte ich.
»Du gehst davon, dass der Kerl mit der K16 ein Profi war.«
»Das ist das einzige, was mir ziemlich sicher scheint. Und ich wette, dass seine Identität falsch ist.«
»Abwarten!«
»Wir können drauf wetten.«
»Hast du schon mal was von diesem Jimmy Tillner gehört, mit dem Ochmann seine Schwierigkeiten hatte?«
»Nein. Aber wir werden ihn wohl in Kürze näher kennenlernen, Roy.«
 |  |

4

Später saßen wir im Büro von Herrn Kriminaldirektor Bock, dem Chef unserer Sonderabteilung. Kriminalpolizeiliche Ermittlungsgruppe des Bundes nennen wir uns. Und wir beschäftigen uns vor allem mit den großen Fällen und mit organisierter Kriminalität. Man hat uns in in Hamburg angesiedelt und rein organisatorisch haben wir unsere Büros um dortigen Polizeipräsidium. Außer Roy und mir waren auch die Kollegen Stefan Czerwinski und Oliver 'Ollie' Medina anwesend sowie unsere Innendienstler Max Warter und Christian Schmitt.
Christian Schmitt war unser Computerspezialist, der an dieser Sitzung teilnahm, um uns etwas über die Auswirkungen von starken elektromagnetischen Impulsen auf Computer und elektronische Bauteile aller Art zu berichten.
»Wie Sie alle wissen, sind seit einigen Jahren Handys in Flugzeugen und Krankenhäusern verboten, weil es zu unerwünschten Wechselwirkungen kommen kann«, erklärte Schmitt. »Theoretisch ist es natürlich möglich, dieses Phänomen als Waffe zu benutzen. Die gesundheitlichen Wirkungen von Mikrowellen sind umstritten. Bei Computerbildschirmen gelten seit einigen Jahren strenge Grenzwerte. Es gibt Studien, die behaupten, dass durch die Emissionen von Handys Krebs ausgelöst werden kann, allerdings gibt es andere Studien, die das Gegenteil behaupten. In geringen Dosen ist die Wirkung also umstritten, bei hohen Dosen lassen sich allerdings Veränderungen der Gehirnströme als Folge nachweisen. Die Regierung der ehemaligen Sowjetunion hat seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts versucht, elektromagnetische Kraftfelder als Waffe gegen Regimegegner zu benutzen. Deren Wohnungen wurden einer intensiven Bestrahlung ausgesetzt, ohne dass die Betroffenen davon ahnten. Manche der Betroffenen wurden psychisch krank oder erlitten Herzinfarkte und Schlaganfälle. Ob das in einem direkten Zusammenhang steht, ist letztlich nicht bewiesen. Aber sicher ist, dass das Tests waren, um auf dieser Basis Waffen zu entwickeln. Mit sehr mäßigem Erfolg allerdings. Seitdem jedoch unsere Welt mehr und mehr von Computern geprägt wird, ergibt sich ein neuer Ansatzpunkt für Mikrowellen-Waffen. Ich bin mir sicher, dass die Militärs in mindestens einem Dutzend Staaten damit experimentieren.
Und für Terroristen sind sie geradezu ideal: Leicht herzustellen und preiswert. Die Technologie ist nicht besonders anspruchsvoll und unterliegt keinerlei Restriktion. Aber der Effekt ist verheerend! Ein entsprechend starkes Aggregat in der Nähe der Börse könnte für Kursstürze und eine Wirtschaftskrise sorgen. Die Flugsicherung wäre derartigen Anschlägen praktisch schutzlos ausgeliefert. Und ein Angriff auf Behördenrechner oder Computer von Polizei und Armee wären jederzeit denkbar, da mit dieser Gefahr nicht gerechnet wird.«
»Atomkraftwerke?«, fragte Ollie Medina. »Werden die nicht auch durch Computer gesteuert?«
Christian Schmitt nickte.
»Wir wollen hoffen, dass es niemand schafft, einen entsprechenden Impulsgeber in den inneren Bereich einer solchen Anlage zu bringen. Die Folgen wären unabsehbar...«
Herr Bock nippte an seinem Kaffeebecher und hob die Augenbrauen.
»Sämtliche Stellen, die in irgendeiner Weise etwas mit öffentlicher Sicherheit zu tun haben, sind inzwischen mehr als vorsichtig. Niemand will sich vorwerfen lassen, Hinweise nicht ernst genug genommen zu haben.«
»Das gilt auch für uns«, mischte sich Stefan Czerwinski ein, der Herr Bocks Stellvertreter im Hamburger Büro war.
Herr Bock nickte.
»Richtig. Es kann natürlich sein, dass gar nichts dahintersteckt, aber das Risiko müssen wir eingehen.«
»Nach dem Mord an Ronny Ochmann glaube ich das - ehrlich gesagt - nicht mehr«, erklärte Roy.
Herr Bock hob leicht die Schultern.
»Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Personen, bei denen sich ein Grund denken lässt, Ochmann aus dem Weg zu räumen.« Er wandte sich an Kollege Max Warter aus unserer Fahndungsabteilung.
»Kennen wir inzwischen die Identität des Killers?«
Max nickte.
»Der Mann hieß Georg Braun, hat für ein paar üble Leute in Altona und auf St. Pauli gearbeitet.«
»Besteht eine Verbindung zu Jimmy Tillner?«, hakte Herr Bock nach.
Max bestätigte das.
»Die beiden waren mal angeklagt, in einem Club Feuer gelegt zu haben. Sie arbeiteten damals für Benny Jordan. Seit Jordan den Kollegen der Drogenfahndung in die Arme gelaufen ist und die nächsten dreißig Jahre im Gefängnis verbringen wird, sind Jimmy Tillner und Georg Braun wohl eigene Wege gegangen.«
»Der Kontakt scheint offenbar nicht abgebrochen zu sein«, stellte ich fest und genehmigte mir einen Schluck aus meinem Kaffeebecher.
Herr Bock stellte seinen Kaffeebecher auf den Tisch.
Er wandte sich an Christian Schmitt: »Versuchen Sie herauszufinden, ob es in letzter Zeit irgendwelche Vorkommnisse gibt, die sich auf die Wirkung von starken Mikrowellen-Sendeaggregaten zurückführen lassen!« Er wandte den Kopf in Stefans Richtung. »Sie nehmen sich das ,VENGA‘ vor. So hieß doch Ochmanns Club!«
»Ja«, bestätigte Stefan.
»Machen Sie eine große Aktion draus! Diese Videoaufzeichnung muss ja irgendwo stecken. Und dem Mitbesitzer des ,VENGA‘ müssen wir auch auf den Zahn fühlen. Uwe?«
»Ja, ...?«
Herr Bock sah mich einen Augenblick lang nachdenklich an und meinte: »Nehmen Sie sich Ochmanns Privatwohnung vor!«
»Und was ist mit Jimmy Tillner?«, fragte ich.
Max Warter meldete sich an Stelle unseres Chef zu Wort.
»Tillner ist extrem misstrauisch. Er hat mehrere Nester über ganz Hamburg verteilt, wo er untertauchen kann. Wohnungen, die unter falschem Namen angemietet wurden. Aber die Fahndung nach ihm läuft.«
 |  |

5

»Ich habe dich bereits erwartet, Robin«, sagte der Mann mit den hart geschnittenen Zügen. Das Kaminfeuer prasselte und ließ Schatten auf seinem Gesicht tanzen. Der schwarze Vollbart und die starken, in der Mitte zusammenwachsenden Augenbrauen gaben ihm ein düsteres Aussehen.
Robin Dehmelt näherte sich vorsichtig.
Er hatte gewaltigen Respekt vor Nathan Brohmer, dem Mann, der von einer kleinen Schar von Anhängern als leibhaftiger Heiliger angesehen wurde.
Brohmer deutete auf den zweiten Sessel in der Nähe des Kamins.
»Setz dich, mein Sohn!«
»Ja.« Dehmelts Stimme klang heiser und fast tonlos. Er setzte sich zögernd.
Brohmer warf ihm eine Zeitung hin.
»Sieh dir an, was die Diener des Heidentums und der Sünde über uns schreiben, mein Sohn!«
Dehmelt faltete die Zeitung auseinander.
SKANDAL IM MARIENKRANKENHAUS titelte das Blatt. DREI PATIENTINNEN STARBEN DURCH TECHNISCHE FEHLFUNKTIONEN IM OP. GIBT ES NOCH MEHR OPFER? SCHLAMPEREI BEI DER GERÄTE-WARTUNG NICHT AUSGESCHLOSSEN.
Dehmelt schluckte.
Die zehn Gebote waren immer die moralische Grundlage seines Lebens gewesen. Wichtiger noch als selbst die Worte des neuen Heiligen Nathan Brohmer, der gegen das auf dem Boden Hamburgs wiedererstandene Babylon wetterte. Und gegen eines dieser Gebote hatte er verstoßen. 'Du sollst nicht töten ...' So gut es ging, versuchte Dehmelt, diesen Gedanken zu verscheuchen.
»Das Beste steht auf der nächsten Seite«, sagte Nathan Brohmer. Ein zufriedenes, triumphierendes Lächeln spielte um seine Mundwinkel. »Dutzende von Operationsterminen - Abtreibungen zumeist, mein Sohn! - sind auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Klinikleitung steht vor einem Rätsel. Von elektromagnetischer Wechselwirkung ist die Rede, aber natürlich gibt es da Dutzende von Möglichkeiten. Stört der Wehenschreiber das EKG-Gerät oder umgekehrt? Sie wissen nicht, woran es liegt. Und natürlich fürchten sie sich vor den Regressansprüchen von Hinterbliebenen und Geschädigten ...« Der selbsternannte Heilige lachte auf. Er beugte sich vor. Der intensive Blick seiner sehr suggestiv wirkenden dunklen Augen schien Robin Dehmelt geradezu durchbohren zu wollen. »Drei Kliniken haben wir in den letzten Wochen auf diese Weise lahmlegen können, Robin! Drei Orte der Sünde, Orte an denen unschuldige Seelen dem Moloch geopfert werden sollten! Die Angst geht unter den Sünderinnen um. Auch wenn es nicht die Furcht vor dem Herrn ist, sondern nur die Angst vor dem Versagen medizinischer Geräte. Es ist eine heilsame Angst, sage ich dir. Wahrlich heilsam für diese verlorenen Seelen ...«
»Die Frauen werden in andere Kliniken gehen, um abtreiben zu lassen«, gab Robin Dehmelt zu bedenken.
»Ja, viele von ihnen werden das tun. Aber dadurch wird unser Kampf gegen das Böse nicht sinnlos. Oder zweifelst du daran?«
»Nein«, murmelte Robin Dehmelt. »Aber ...« Er stockte.
»Aber was?«
Robin Dehmelt zögerte, ehe er weiter sprach. Er wusste, dass es sinnlos war, dem Heiligen seine Zweifel verbergen zu wollen.
»Nicht alle verstorbenen Patientinnen wollten eine Abtreibung vornehmen.«
»Der Kampf gegen das Böse erfordert bedauerlicherweise Opfer, mein Sohn.«
»Ja, ich weiß.«
»Diese Kliniken sind Orte der Sünde, Robin! Nicht allein der Abtreibungen wegen. Sie nehmen dort Bluttransfusionen vor. Auch das ist gegen den Willen des Herrn, denn das Blut ist der Sitz der Seele ...«
»Ja.«
»Es ist viehisch!«
»Das ist es.«
»Eine Sünde gegen Gott und seine heilige Schöpfung!«
»Amen.«
Eine Pause folgte. Der selbsternannte Heilige musterte Robin Dehmelt mit einem Stirnrunzeln. »Hast du irgendwelche Zweifel an unserer Mission, mein Sohn?«
Dehmelt schüttelte den Kopf. Er wich dabei dem Blick seines Gegenübers aus. Sein Mund öffnete sich ein wenig, aber kein Ton kam über seine Lippen.
»Ich muss dich noch einmal um deine Hilfe bitten, Robin. Es geht um das Asklepios-Krankenhaus ... Ich kann mich doch auf dich verlassen, mein Sohn?!«
»Ja!«, stieß Robin Dehmelt hervor und schloss die Augen dabei.
»Der Herr stehe dir bei bei allem, was du tust. Aber sei gewiss: Er wird gnädig auf dich von seinem Thron herabschauen, denn du bist einer der wenigen Gerechten, die sich in die Mauern des neuen Babylon gewagt haben!«
»Amen«, flüsterte Dehmelt und wiederholte es gleich darauf, wie um sich selbst Mut zu machen: »Amen!«
 |  |

6

Ronny Ochmanns Wohnung lag im dritten Stock eines Apartmenthauses in der Barbachstraße. Mit Hilfe des Schlüssels, der bei Ochmanns Leiche von den Kollegen des Erkennungsdienstes sichergestellt worden war, traten wir ein.
Ich ließ den Blick durch ein sehr großes Wohnzimmer schweifen. Mindestens hundert Quadratmeter, so schätzte ich. Der Rest der Wohnung hatte noch einmal dieselbe Größe. Damit war sie für Hamburger Verhältnisse geradezu gigantisch.
Roy sah mich an. Er hatte offenbar gerade denselben Gedanken wie ich.
»Ochmanns Geschäfte müssen ziemlich gut gegangen sein, wenn er sich so etwas leisten konnte«, meinte er.
Ich zuckte mit den Achseln.
»Wenn das ,Venga‘ tatsächlich so ein Superclub ist, verwundert das niemanden.«
»Ein getarnter Drogenumschlagplatz - darum handelt es sich beim ,VENGA‘.«
»Die Kollegen der Drogenfahndung konnten das leider nie beweisen ...«
»Aber die Spatzen pfeifen es von den Dächern.«
»Spatzen werden vor Gericht leider nicht als Zeuge zugelassen.«
Ich umrundete die Sitzgarnitur aus Leder. Ein Fernseher inklusive DVD-Player standen dort. Der Bildschirm war riesig. Video-Bänder suchte ich da wohl vergeblich.
Roy nahm sich unterdessen die Nebenräume vor. Zuerst die Küche, dann das Bad.
Ich untersuchte einen der Schränke aus dunklem Holz. Hinter einer der Schiebetüren fand ich einen Ordner mit Kontoauszügen. Ronny Ochmanns Geschäfte schienen gar nicht so gut zu gehen, wie wir zuerst geglaubt hatten. Jedenfalls war sein Konto mit einem fünfstelligen Betrag in den Miesen.
Beim Telefon fand ich ein Adressbuch. Die Namen darin waren nur abgekürzt. Aber mit den Telefonnummern würden unsere Innendienstler einiges anzufangen wissen.
»Ich habe hier was!«, hörte ich Roy sagen und drehte mich herum. Er hielt einen feuchten Plastikbeutel in der Hand. Darin befand sich eine Automatik mit zwei Magazinen zum Wechseln. Außerdem ein paar Briefchen, die vermutlich Kokain enthielten.
Und ein Schlüssel.
»War in der Klospülung«, erklärte Roy.
»Kein besonders originelles Versteck!«
»Umso besser für uns, sonst hätten wir hier lange herumsuchen können.«
Ich nahm Roy den Beutel aus der Hand, tastete von außen nach dem Schlüssel, drehte ihn herum. Der Name der Schlüsselfirma stand darauf. Außerdem eine Nummer.
»Könnte zu einer Schließfachanlage gehören«, meinte Roy.
»Fragt sich nur, zu welcher! Jede Bank in Hamburg hat doch so etwas! Mal ganz abgesehen von den Postfachanlagen, den Schließfächern in Bahnhöfen und Flughäfen ...«
Roy nickte.
»Da sitzen dreihundert Polizisten zehn Jahre dran, bis das richtige Fach gefunden wurde.«
»So viel Zeit haben wir leider nicht ...« Ich sah auf das Emblem der Schlüsselfirma. Vielleicht kamen wir darüber weiter. »Ich bin überzeugt, dass das Video-Band, das wir suchen, in diesem Fach zu finden ist.«
»Vorausgesetzt, es existiert überhaupt, Uwe. Was, wenn dieser Ochmann einfach nur in Schwierigkeiten war und uns dafür missbrauchen wollte, ihm seine Feinde vom Leib zu halten?«
»Wenn das seine Absicht war, ist sie gründlich misslungen, Roy.«
Ein Geräusch ließ uns zusammenzucken. Jemand machte sich an der Tür zu schaffen, schloss sie auf.
Eine junge Frau in einem eng anliegenden blauen Kleid trat ein. Das blauschwarze Haar fiel ihr bis weit über die Schultern. Sie stutzte, als sie uns sah. Ich hielt ihr meinen Ausweis hin und stellte uns vor.
»Kriminalpolizei, Kriminalhauptkommissar Uwe Jörgensen. Dies ist mein Kollege Roy Müller.«
Sie schluckte, schien einen Augenblick lang zu erwägen, sofort davonzulaufen.
Ich machte einen Schritt auf die junge Frau zu, so dass sie meinen Ausweis besser sehen konnte.
Sie atmete tief durch.
»Was tun Sie hier?«, fragte sie kühl.
Ich trat neben sie, schloss die Tür. Ich wollte verhindern, dass sie uns doch noch durchbrannte. Denn das war zweifellos ihr erster Gedanke gewesen. Ihre vollen Brüste hoben und senkten sich recht schnell. Die Atemfrequenz musste immer noch weit über dem Normalwert liegen.
»Ich habe Ihnen gesagt, wer wir sind«, wich ich ihrer Frage aus. »Eigentlich wüsste ich umgekehrt auch ganz gerne, mit wem ich es zu tun habe.«
»Isabel Norales.«
»Sie hatten offenbar einen Schlüssel zu dieser Wohnung.«
»Ich lebe hier.«
»Diese Wohnung gehört Herrn Ronny Ochmann.«
»Ich bin vor drei Monaten bei ihm eingezogen.« Sie schluckte, wich meinem Blick aus. Irgendetwas verheimlichte sie dabei.
»Sie haben zusammengelebt?«
»Sagte ich doch.«
»Wir müssen Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen.«
»Ist etwas mit Ronny?«
»Er wurde aus einem fahrenden Wagen heraus erschossen, als er sich mit uns traf.«
Ihr Gesicht blieb unbewegt. Im nächsten Moment bedeckte sie die Augen mit ihrer Hand.
»Das ist furchtbar«, sagte sie. Sie ging zur Sitzecke, ließ sich in einen der Sessel fallen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2022
- ISBN (ePUB)
- 9783738958553
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (Februar)
- Schlagworte
- kommissar jörgensen scheinheiligen hamburg krimi